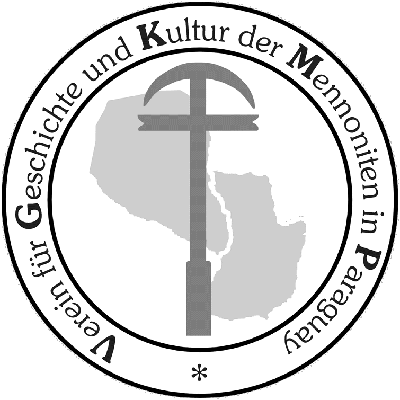Im Christentum wie auch im Islam oder anderen monotheistischen Religionen geht es um die Wahrheit. Die Suche nach Wahrheit ist tief im Menschen verankert und in der eigenen Glaubenstradition sieht man normalerweise die letztendliche Wahrheit über sich selbst, über Gott und die Welt artikuliert. Religiös bekennende Menschen – und Christen bilden da keine Ausnahme – halten meist mit einer stark emotional verankerten Überzeugung an ihrem jeweils besonderen eigenen Glaubensbekenntnis fest, wobei die Toleranzschwelle für alternative Sichtweisen meist nicht sehr hoch ist. Es rüttelt an die Grundfesten der eigenen Identität, wenn man anderen Bekenntnissen auch ein gewisses Maß an Gültigkeit zugestehen soll. Im Verlauf der Kirchengeschichte waren Reformbewegungen daher auch oft mit einem Konfliktpotenzial geladen, welches nicht selten zu einer sichtbaren, institutionellen Spaltung der Kirche geführt hat. In der prämodernen Welt, als Exklusivitätsansprüche noch selbstverständlicher aufrecht erhalten und verteidigt wurden, führten solche Konflikte auch zu offener Gewalt, was offensichtlich mehr Feindschaft als Verständigung oder Versöhnung schuf.
Eine weitere Eigenart des christlichen Glaubens besteht darin, dass er über Generationen ein jeweils kulturspezifisches Gesicht annimmt. Diese an sich notwendige und begrüßenswerte Eigenschaft hat jedoch des Öfteren dazu geführt, dass Kirchen sich “auseinander leben”, dass Verständigung und somit auch gegenseitiges Interesse füreinander nachlassen. Der Konfessionalismus hat also nicht notwendigerweise seinen Ursprung immer in Konflikten oder Gewaltakten.
Unabhängig von jeder Analyse zu Ursache und Wirkung ist es die nüchterne Feststellung, dass die christliche Kirche in der westlichen Welt sich seit dem 16. Jahrhundert in recht viele Richtungen aufgespalten und verzweigt hat, was sogar für den aufgeklärten Insider verwirrend wirkt. Die missionarische Bewegung, die vor allem im 19. Jahrhundert von Europa und Nordamerika ausgehend die Weltmission betrieb, musste jedoch feststellen, dass die Spaltungen und Verfeindungen der missionierenden Kirchen unter den Heidenvölkern geradezu skandalös wirkten. Das offensichtliche Gebot der Stunde war, dass einzelne Missionare, Missionsbehörden, entsendende Kirchen usw. ihre Arbeitsfelder, ihre Methoden, Visionen und Tätigkeiten irgendwie koordinierten. Die Bemühungen einer derartigen Verständigung führten 1910 zur Gründung einer formellen ökumenischen Bewegung. Durch die politische und humanitäre Not des Zweiten Weltkriegs rückten viele Kirchengemeinschaften noch enger zusammen und schufen den Weltkirchenrat, der zum Sprecher für Kooperationsbemühungen wurde, jedoch nicht alle ökumenischen Bestrebungen in sich vereint. Es sind vor allem die hierarchisch geprägten Landeskirchen, deren Delegierte in diesem Forum verbindliche Entscheidungen treffen können, die sich mit dieser Institution identifizieren. Freikirchen, deren Vertreter meist nur sehr begrenzte Befugnisse haben, sind bislang eher schwach vertreten, obwohl es deutliche Anzeichen gibt, die eine Änderung dieser Tendenz versprechen. Jedoch ist es nicht nur die institutionelle Prägung oder die Methode der Entscheidungsfindung, sondern auch die Sorge um die Wahrheit, oder alt eingeprägte Feindschaften bzw. Exklusivitätsansprüche, die manche Kirchen auf die Teilnahme an ökumenischen Prozessen verzichten lässt.
In Lateinamerika, einem stark katholisch geprägten Kontinent, waren die Verständigungsversuche zwischen der dominanten Staatskirche und den evangelischen Freikirchen, die als Resultat von Einwanderung und Missionierung entstanden, bisher besonders schwierig. Individualismus und exklusive Ansprüche einerseits, stark unterschiedliche kulturelle Eigenarten und religiöse Weltanschauungen andererseits zusammen mit einem Verkündigungsstil, der stark auf Polemik aufbaut, haben bisher die Öffnung und Begegnung erschwert.
Mennoniten in Paraguay waren als evangelische Freikirche trotz ihres pazifistischen Charakters keine wesentliche Ausnahme in diesem Szenario. In der missionarischen Verkündigung hat man gemeinhin stark auf den Gegensatz zur katholischen Kirche gebaut. Der Dialog, die Begegnung, die gegenseitige Bereicherung waren die seltene Ausnahme. Eine solche Ausnahme war die Kirchenkommission, die für die Erarbeitung der neuen Staatsverfassung 1991 – 1992 gegründet wurde (>Coordinadora de Iglesias Cristianas para la Asamblea Nacional Constituyente). Neben der erfolgreichen Verankerung des Artikels über die Gewissensfreiheit beim Wehrdienst u. a. entwickelte man bei den Arbeitssitzungen eine Atmosphäre des Dialogs, dessen Weiterführung zwar von manchen gewünscht wurde, jedoch nicht zustande kam.
Der im Rahmen der >MWK 1998 begonnene Dialog mit der katholischen Kirche hat zwar zu interessanten Resultaten geführt, ist aber wiederum, besonders in Lateinamerika, bei manchen Gemeinden auf Widerstand gestoßen, so dass eine Realisierung dieser Begegnung auf lokaler Ebene bislang nur sehr begrenzt stattfindet. Eine Besinnung auf unser mennonitisches Erbe als Friedenskirche, die von ihrem ekklesiologischen Selbstverständnis her nicht die Konfrontation, sondern den Dialog sucht, nicht Spaltung, Polemik und Polarisierung, sondern Verständigung, Versöhnung und Shalom – eine solche Besinnung dürfte motivierend wirken, um bisher tief eingebürgerte Haltungen zu hinterfragen.
Gundolf Niebuhr
Jahrbuch für Geschichte und Kultur der Mennoniten in Paraguay, Filadelfia, 2000 und 2001; Called together to be Peacemakers. MWK, 2003.