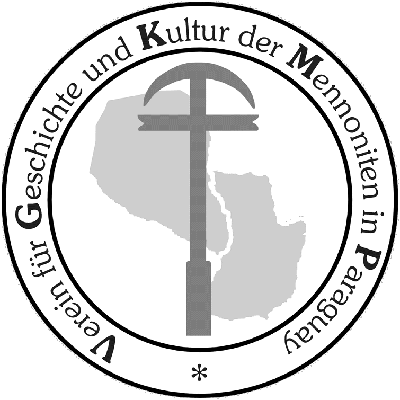In der Geschichte der >Kolonie >Fernheim ist im Bereich Gesundheitswesen der Name keines anderen Arztes so bekannt gewesen wie der von Dr. G. Dollinger. Seine Tätigkeit hier begann 1951 und erstreckte sich über 13 Jahre. Damit gehört er zu den Ärzten, die hier am längsten in verantwortlicher Stellung gearbeitet haben.
Geboren wurde Gerhard Dollinger im Jahre 1914 im Schwabenland in Baden Württemberg.
Zu Ende des Krieges war er in amerikanische Gefangenschaft geraten. Dort hatte er den auch gefangenen Dr. Wilhelm Rakko, der aus den Mennonitensiedlungen in der Ukraine stammte und später in Neuland arbeitete, kennen gelernt. Die Kolonie Fernheim suchte einen Arzt, möglichst einen Chirurgen. Durch Vermittlung von Dr. W. >Rakko wurde der Kontakt zwischen ihm und dem >MCC in Frankfurt hergestellt. Das MCC hatte seit Beginn des Krieges nach Möglichkeit die Kolonie Fernheim mit Ärzten versorgt. Die notwendigen Vereinbarungen wurden getroffen und das Ehepaar Dollinger, damals noch ohne Kinder, trat die Reise an, zunächst per Schiff nach Buenos Aires, dann mit dem Flussschiff bis Asunción und von dort per Flugzeug nach Filadelfia. Auf dem Rückflug verließ der bisher in Filadelfia tätige Arzt Dr. A. Wägele seine Stelle und ging nach Brasilien.
Dr. Dollinger hatte die Aufgabe, den Krankenhausbetrieb weiterzuführen. Dazu gehörten auch die Schwesternkurse, alleiniger Zuständigkeitsbereich der Ärzte damals. Manche Absolventen blieben im Betrieb, andere heirateten bald und so entstand ständig neuer Bedarf an Schwestern auf Missionsstationen oder in anderen Kolonien. Dr. Dollinger sorgte für ein gutes Arbeitsklima und nicht weniger auch für Abwechslung in der Freizeitgestaltung – bis dahin hier unbekannt.
Durch seine spontane, freundliche Art, auf jeden zuzugehen, hatte das Ehepaar bald einen großen Bekannten- und Freundeskreis. Die inzwischen “Familie” gewordenen Dollingers waren ganz in die Koloniegemeinschaft integriert.
Dr. Dollinger nahm Kontakt zu den Ärzten der Nachbarkolonien auf und entwickelte daraus eine durchaus effiziente Zusammenarbeit. Man traf sich in monatlichen Abständen. Dr. Dollinger nutzte seine Urlaubsaufenthalte in der Heimat immer dazu, bei befreundeten Kollegen anderer Fachgebiete noch etwas dazuzulernen. So hielt er sich medizinisch und auch sonst auf dem Laufenden.
Sein Einkommen hier stand in keinem Verhältnis zu dem, was seinesgleichen in der Bundesrepublik hatten. Mal wurde er mit Geld, mal mit Rindern bezahlt. Anscheinend waren beide Teile zufrieden, denn es hat (heute nicht nachweisbar) geheißen, dass die Vereinbarung auf lebenslänglich gelten sollte.
Aus seiner außerberuflichen Tätigkeit ist sein Einsatz damals für die als staatenlos geführten Siedler der Kolonie zu erwähnen. So konnte durch seine Vermittlung ein Teil der Bürger die deutsche Staatsangehörigkeit erlangen. Dabei wurde er von deutscher amtlicher Seite zum Ehrenkonsul ernannt – mit dem Wappen über der Tür und der deutschen Fahne vor dem Hauseingang.
Nach dreizehnjähriger Tätigkeit entschlossen Dollingers sich, in die Heimat zurückzukehren. Es folgten eine Tätigkeit in einem deutschem Krankenhaus, ein Einsatz in einem Missionskrankenhaus in Syrien und dann ließen Dollingers sich in einer Privatpraxis in Ittersbach, in der Nähe von Karlsruhe, nieder. Hier hat Dr. Dollinger dann noch mehr als zwei Jahrzehnte sehr intensiv gearbeitet, um dann die letzten Lebensjahre zurückgezogen am Rande der Ortschaft zu verbringen. Dr. Dollinger erzählt von seinen Erfahrungen im >Chaco in mehreren Büchern: Dollinger, Gerhard: In meine Heimat kam ich wieder. Stuttgart: Betulius, 1989. Ders: Ein Landarzt erzählt. Stuttgart: J. F. Steinkopf, 1991. Ders.: Das Paradies in der grünen Hölle. Was ein Landarzt erlebte. Stuttgart: J. F. Steinkopf, 1992. Ders: Im Land der Papageien. Wuppertal: R. Brockhaus, 2002.
Rudolf Dyck
Rudolf Dyck: Aus dem Leben eines Arztes im Chaco. [Selbstverlag] Filadelfia 2007.
Dorf
Für die Mennoniten war das Dorf schon von Preußen her eine Siedlungsform, die auch ihrem Gemeindeverständnis entgegenkam. Es war die kleine, überschaubare und kontrollierbare Landgemeinde mit der Kirche und der Schule.
Das Dorf als Siedlungsform hatte sich in Russland so eng mit dem mennonitischen Gemeindeverständnis verbunden, dass es den Auswanderern, die 1874 nach Kanada zogen, schwer wurde, sich auf das dortige „home steading” einzustellen, wo jeder Farmer auf seinem eigenen Land wohnte. In Manitoba suchten die mennonitischen Siedler einen Ausweg, indem zum Beispiel sechzehn Farmer ihre Landkomplexe so zusammenlegten, dass auf der Mittelachse ein Straßendorf wie in Russland angelegt werden konnte.
Auch in den mennonitischen Kolonien in Paraguay sind die Dörfer Straßendörfer, die ursprünglich in Ost-West- oder Nord-Süd-Richtung über einen Kamp gelegt wurden. Sehr bald passte man jedoch bei der Anlage der Dörfer in Fernheim und vor allem in Neuland den Verlauf der Dorfstraße dem Verlauf des Kamps an, so dass die einzelnen Hofstellen ungefähr dieselbe Fläche an beackerbarem Boden umfassten. Zu jedem Dorf gehörte in der Regel in der Mitte des Dorfes ein Grundstück, auf dem die Schule gebaut wurde. Diese diente gleichzeitig als Andachts- und Versammlungsraum für das ganze Dorf. Da hier die Gottesdienste abgehalten wurden, lag in der Nähe der Schule auch der Dorfsfriedhof. In der Anfangszeit hatten manche Dörfer auch einen gemeinschaftlichen Brunnen und gemeinschaftlich genutztes Weideland.
Die einzelnen Grundstücke waren in der Regel gleich groß und hatten eine Straßenfront von zwischen 100 und 200 Metern und eine Länge von ein bis zwei Kilometern. Die Höfe waren in der Regel so angelegt, dass entlang der Straße ein Obstgarten (Zitrusfrüchte, Dattelpalmen, Guayaba) angelegt war, darauf folgten Wohn- und Wirtschaftsgebäude, der Korral und daran schlossen sich Garten und Felder und Weiden an.
Verwaltet wurden die Dörfer vom Dorfschulzen, der zur Beschlussfassung alle Haushaltsvorstände zum „Schultenbott“ zusammenrief. Alle Schulfragen wie Schulbau, Gebäudeunterhalt, Anstellung und Entlohnung des Lehrers, außerdem der Unterhalt des Weges und der Zäune waren vom Dorf zu regeln. Sach- oder Dienstleistungen (>Zechenarbeit, >Scharwerk) wurden zu gleichen Teil von jedem Wirt erbracht. Der Dorfschulze führte hierüber Buch.
Da viele Funktionen des Dorfes wie der Wegebau und die Schulverwaltung an die Kolonie übergegangen sind, haben die Dorfverwaltung und der Dorfschulze an Bedeutung eingebüßt. Da manche Wirtschaften zusammengelegt wurden, viele Wirte durch Zukauf von Land außerhalb des Dorfes oder gar der Kolonie ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt nicht mehr innerhalb des Dorfes haben, verliert das Dorf weiter an Bedeutung. Hinzu kommt, dass viele Dorfbewohner, vor allem in der Nähe der Zentren, gar nicht mehr Bauern sind, so dass die Dörfer zu Wohndörfern werden, während mancher Bauer auf seine Estancia außerhalb des Dorfes zieht. Dennoch besteht das Dorf als soziale Einheit innerhalb der Kolonie weiter, wenn sich auch die Lebensformen innerhalb des Dorfes diversifiziert haben.
Michael Rudolph