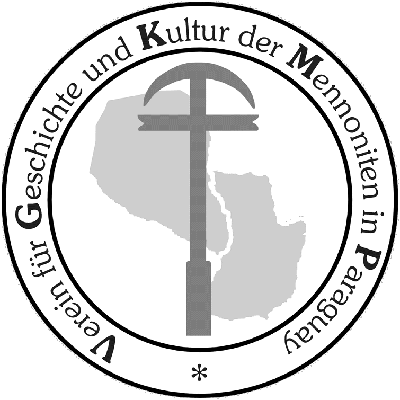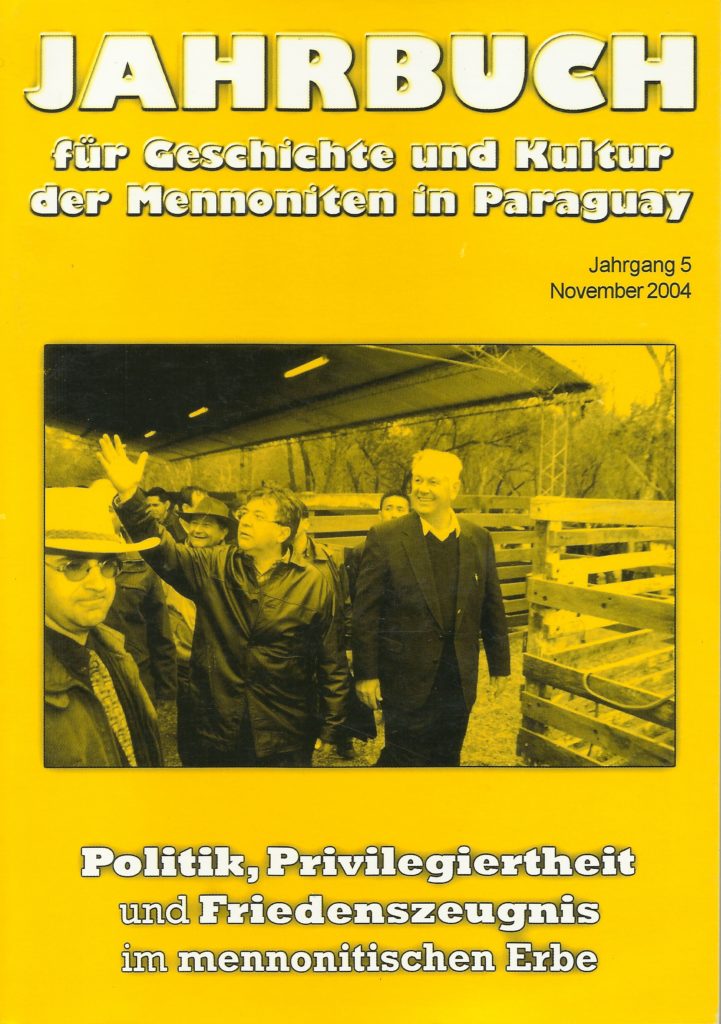
Inhaltsverzeichnes
Begleitwort zu dieser Nummer
„Mennoniten und Politik“ war für die Mennoniten in Paraguay lange kein Thema, dem man große Aufmerksamkeit schenkte. Meistens begnügte man sich mit der Feststellung, dass die Mennoniten hier apolitisch seien, der jeweiligen Regierung den geforderten Gehorsam entgegenbrachten und ansonsten sich unter dem Schutz des Privilegiums – Gesetz 514 – sicher und geborgen fühlten. Sie mischten sich nicht in die Landespolitik ein, sondern waren nur darauf bedacht, dass ihre administrative und ökonomische Unabhängigkeit möglichst gewährleistet blieb.
Das änderte sich, als mit dem Sturz des langjährigen Präsidenten Alfredo Stroessner im Jahre 1989 sich die politische Landschaft im Sinne der Demokratisierung zu verändern begann. Die einzelnen Departamentos sollten nun nicht mehr von einem Regierungsbeauftragten, sondern von einem von der Bevölkerung gewählten Gouverneur regiert werden. Die Munizipalitäten ebenso. Hinzu kam, dass die traditionelle Parteienlandschaft durch die Bildung der politischen Sammelbewegung Encuentro Nacional aufgelockert wurde und die Stimmabgabe bei den landesweiten Wahlen für die Mennoniten dadurch an Bedeutung gewann. So wurde damals ein mennonitischer Gouverneur im Departament Boquerón sowie ein mennonitischer Abgeordneter desselben Departaments für das Abgeordnetenhaus gewählt. Damit standen die „Stillen im Lande“ plötzlich im Licht der Öffentlichkeit, und die Gemeinden taten sich schwer, sich mit dieser neuen Situation abzufinden.
Inzwischen ist die mennonitische Beteiligung an der Regierung fast zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Die Mennoniten haben inzwischen nicht nur einen mennonitischen Gouverneur, sondern auch einen Minister, einen Vizeminister, einen Präsidentenberater, einen Abgeordneten sowie einen Senator. Grund genug, sich einmal intensiv mit der Frage „Mennoniten und Politik“ zu befassen. Der Verein für Geschichte und Kultur der Mennoniten in Paraguay hat diesen Gedanken aufgegriffen und ihn zum Thema des diesjährigen Geschichtssymposiums, das am 21./22. Mai dieses Jahres in Filadelfia stattfand, gemacht. Die Vorträge dieses Symposiums sind in diesem Jahrbuch abgedruckt.
Der Vorstand des Geschichtsvereins wollte das Thema nicht auf die Mennoniten in Paraugay beschränken, sondern der Frage in Form einer Längsschnittanalyse nachgehen, die mit den Täufern beginnt, dann die Situation in Preußen und Russland schildert, um sich dann den Mennoniten in Paraguay zuzuwenden.
Diesem Konzept folgend behandelt Abraham Friesen, langjähriger Reformationshistoriker an der Universität in Santa Barbara, Kalifornien, zunächst die politische Haltung der Täufer, um sich dann in einem zweiten Vortrag den Mennoniten in Russland zuzuwenden. Er weist nach, dass die politischen Normen im 16. Jahrhundert für die Beteiligung der Mennoniten an der Politik ungünstig waren, so dass sie eine solche Partizipation weitgehend ablehnten. Anders gestaltete sich die Situation in Russland, wo sich nach anfänglicher Isolation zwei Gruppierungen bildeten. Die einen traten für die weitgehende Absonderung ein und, als diese nicht mehr aufrecht zu erhalten war, setzten sie sich für die Auswanderung ein. Die anderen befürworteten eine Assimilierung der Mennoniten in Russland und traten daher für die Beteiligung an der Politik ein. Welchen Wechselbädern die Mennoniten dabei ausgesetzt waren, zeigt Friesen in seinen inhaltsreichen Ausführungen.
Gerhard Ratzlaff stellt detailliert die schwierige politische Situation der Mennoniten in Preußen dar. Bald waren sie unter polnischer, bald unter preußischer Verwaltung. Gebraucht wurden sie von beiden Regierungen, aber sowohl der evangelischen als auch der katholischen Kirche waren sie ein Dorn im Auge. Das führte wiederholt zu Einschränkungen, so dass die Einladung von Katharina der Großen, nach Russland zu kommen, bei den Mennoniten auf fruchtbaren Boden fiel und zu einer großen Auswanderung führte. Sehr ausführlich schildert Ratzlaff dann die Erfahrungen der Mennoniten mit der Politik in Paraguay, wobei er einen Wandel in der Einstellung festgestellt hat. Die Mennoniten sind offensichtlich nicht mehr bereit, dass man mit ihnen eine Politik treibt, auf die sie keinen Einfluss haben, sondern treten bewusst aus der Isolation heraus und setzen sich nicht nur für die eigenen Interessen, sondern für die Belange aller Bürger in Paraguay ein.
Jakob Warkentin geht unter sozialpsychologischer Fragestellung den Nachwirkungen der Erfahrungen während der „völkischen Zeit“ in Fernheim nach und kommt zu dem Schluss, dass man auf Grund der schmerzlichen Trennungserlebnisse in den dreißiger und vierziger Jahren auf kritische und von der Mehrheit abweichende Meinungen sowie auf mögliche Gruppenbildung überempfindlich reagiert. Es hat den Anschein, als wolle man die Einheit der Gemeinschaft um jeden Preis erhalten und versuche daher, den Kultursektor unter kirchlicher und administrativer Kontrolle zu halten.
Gundolf Niebuhr fragt nach dem christlichen Friedenszeugnis, dem auch die Mennoniten in Paraguay verpflichtet sind. Dabei arbeitet er John Howard Yoders Grundgedanken einer Friedenstheologie heraus und bezieht sie dann auf die Mennoniten in Paraguay. Aufschlussreich und anregend sind vor allem seine „Impulse aus Yoders Denken für uns.“
Die Zusammenfassung der Podiums- und Plenumsdiskussion von Beate Penner zeigt, dass die Mennoniten in Paraguay dabei sind, ihren Standpunkt bezüglich ihrer Beteiligung an der Politik zu finden. Es gibt Befürworter, die davon überzeugt sind, dass der gute Einfluss der Mennoniten sich auch in der Staatspolitk bemerkbar machen müsse, während andere vor zuviel Euphorie und Optimismus warnen.
Im kulturellen Teil sind wir bemüht, Berichte und Erzählungen zu veröffentlichen, die informativ und unterhaltend sind und gleichzeitig zum Nachdenken anregen. Es ist nicht leicht, mennonitische Autoren aus Paraguay für diesen Teil zu gewinnen. Umso dankbarer sind wir für die Beiträge, die uns zugeschickt werden. Dieser Dank gilt vor allem Eugen Friesen, der sich wiederholt zu Wort gemeldet hat und auch dieses Mal interessante Geschichten liefert.
Einen informativen Bericht liefert Cornelius J. Dyck, der seinerzeit MCC-Direktor in Asunción war und zusammen mit Dr. John Schmidt selber maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Leprastation Km 81 für viele Menschen zum Segen geworden ist, sowohl für die zahlreichen CD-Arbeiter als auch für die dort betreuten Patienten.
Wir danken allen Teilnehmern des Geschichtssymposiums für ihre Beiträge und wünschen den Lesern, dass die vorliegenden Aufsätze und Geschichten als Anregung für eine vertiefte Beschäftigung mit der behandelten Thematik dienen.
Jakob Warkentin

Staatspräsident Nicanor D. Frutos und Gouverneur von Boquerón, David Sawatzky beim Rodeo Trébol, 2004.
Foto von Hans Dürksen
Foto von Hans Dürksen
Vorträge
Die politische Haltung im Täufertum
Abraham Friesen
Wenn man das Täufertum richtig verstehen will, muss man es im größeren Rahmen der europäischen Geschichte des Spätmittelalters untersuchen. Das gilt besonders, wenn man seine politische Haltung richtig einschätzen will. In letzter Hinsicht gibt es verschiedene weitere sowie auch mehr lokale Kontexte, die man in Acht nehmen sollte. An erster Stelle wäre ohne Zweifel die Beziehung von Kirche und Staat im ausgehenden Mittelalter zu untersuchen; zweitens die Verschiebungen in diesen Beziehungen, verursacht durch die Reformation; drittens die politische Entzweiungen zwischen Reformatoren und Täufern über Politik und Religion; und viertens die Unterschiede in der politischen Haltung zwischen friedlichen und revolutionären Täufern. Wir beginnen mit dem politischen Kontext des späten Mittelalters.
Kirche und Staat im späten Mittelalter
Im späten Mittelalter sprach man allgemein von einem Sacerdotium und einem Imperium: einer universalen Kirche, die ihren Sitz in Rom hatte, und einem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, dessen Sitz in Deutschland war. Diese zwei universalen Mächte stritten sich immer wieder während des Mittelalters über die Frage, wer der Größere im christlichen Reiche – in dem berüchtigten corpus christianum -sei. Und obwohl der Papst – wahrscheinlich in Anlehnung an Jesu Antwort auf die Frage seiner Jünger, wer der Größte unter ihnen im Reiche Gottes sein würde – sich servus servorum dei (der Diener der Diener Gottes) nannte, strebte er unaufhaltsam nach der plenitudo potestatis im corpus christianum – also, der Vollmacht im christlichen Reich.
Die Päpste benutzten zwei Gleichnisse, um dieses Streben zu rechtfertigen: zuerst das Gleichnis von den zwei Schwertern (das geistliche und das weltliche Schwert), und zweitens das Gleichnis von der Sonne und dem Mond, wo der Papst die Sonne darstellte und der Kaiser den Mond. In beiden Fällen wurde der Papst als höchste Macht im corpus christianum proklamiert, dem der Kaiser und die aufsteigenden Könige sich unterordnen sollten. Der Höhepunkt dieser päpstlichen Aussagen wurde in der Bulle Unam Sanctam des Bonifacius VIII. im Jahre 1302 erreicht.
Aber trotz dieser vielen päpstlichen Proklamationen war man sich immer bewusst, dass es zwei Machtbereiche in diesem christlichen Reiche gab, die ihre verschiedenen Aufgaben hatten und die zusammen arbeiten sollten.
Der Griff der mittelalterlichen Päpste nach der Weltmacht scheiterte aber an den politischen Entwicklungen der frühen Neuzeit. In dieser Zeit, ungefähr 1300 bis 1600, entwickelten sich die verschiedenen Königreiche Europas, vor allem die in England, Frankreich und Spanien zu selbständigen Mächten. Beeinflusst durch das Wiederaufblühen des Römischen Rechts, die Wandlung der wirtschaftlichen Verhältnisse, die auf Geld anstatt Tausch basierten, stehende Heere und anderes mehr, fingen die Könige an, fremde Einflüsse in ihren Königreichen auszuschließen, um ihre Selbständigkeit zu behaupten – auch über die Kirche und ihrem Reichtum. Diese Entwicklung begann um 1309, als der Papst Clemens V. seinen Sitz von Rom nach Avignon (in Frankreich), wegen verschiedenen Zwistigkeiten mit dem französischen König, verlegte. Von 1309 bis 1378 residierte der Papst in Avignon, anscheinend unter dem Einfluss des französischen Königs. Man nennt diese Zeit die Zeit der babylonischen Gefangenschaft der Römischen Kirche. England und Deutschland, die sich gelegentlich während dieser Zeit mit Frankreich stritten, behielten ihr Kirchengeld im Lande und versuchten ihre Kirchen zu nationalisieren.
1378 folgte das große westliche Kirchenschisma, wo zuerst zwei Päpste sich bekämpften, und dann, nach 1409, sich drei stritten. Wer war nun unter diesen der eigentliche Vikar Christi? Ein Land hielt zu dem Einen, das andere Land zu dem Zweiten, und noch ein anderes zu dem Dritten. Erst 1415 kam das Schisma zu Ende. Inzwischen aber besuchte der Schwarze Tod – beginnend 1347 – die europäischen Länder mit seinem Trauma, ein Trauma, das die Kraft der Kirche als Vermittler zwischen Gott und Mensch in Frage stellte, denn die Kirche konnte die Seuche nicht aufhalten.
Verschiedene Könige haben diese Zeit der Kirchenschwäche benutzt, um ihre Macht über die Kirche in ihren Ländern zu erweitern und die Macht der Päpste zu schwächen. So kam es, dass der spanische König die Kirche im Lande in seiner Hand hatte, der französische König von einer gallischen Kirche in seinem Lande sprechen konnte, und der englische, im Jahre 1534, eine anglikanische Kirche proklamieren konnte, in der der Papst seiner Macht beraubt war. In mancher Hinsicht machen diese Entwicklungen zum Staatskirchentum deutlich, warum – mit Ausnahme von England – keine Reformationen in diesen Ländern stattfanden.
Die Politik der Reformationszeit
In Deutschland, Heimat der Reformation, kam es anders. Dort gab es während des Mittelalters keine starke zentrale politische Macht, denn der Kaiser – seit 1356 und der Goldenen Bulle – verlor allmählich seine Macht an die Kurfürsten und Fürsten des Reichs. Die Letzteren aber waren der Kirche umso mehr ausgeliefert. Und so kam es, dass die schlimmsten kirchlichen Mißbräuche im deutschen Reich stattfanden, am sichtbarsten in der Institution des Ablasskaufs. Aus Protest gegen diesen schlug Luther 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche. Seine soeben erworbene Überzeugung, dass die Erlösung des Menschen nur durch den Glauben zu erlangen sei, drängte ihn dazu.
Von seinem Angriff auf den Ablasskauf ging Luther über zu der Messe, die er nun einen Greuel vor Gott schalt. Wenn man schon den Ablass abschaffen konnte, konnte man die Messe auch abschaffen, eine Messe, die das Hauptstück des katholischen Gottesdienstes war und noch ist. Schon zu Beginn des Jahres 1519 fingen er, Karlstadt, Melanchthon, Amsdorf und verschiedene andere an, eine „evangelische“ – also eine gereinigte – Messe privatim zu feiern, und zwar in beider Gestalt. Man musste ja Wort Gottes und Kirchenbrauch in Übereinstimmung bringen. Und so kam es, dass Karlstadt die Einwohner Wittenbergs zu einer evangelischen Messe für den 1. Januar 1522 in des Kurfürsten Schlosskirche, einlud. Als der Kurfürst davon hörte, verbot er die Feier am 1. Januar (Luther war zu der Zeit auf der Wartburg, wo der Kurfürst ihn nach dem Wormser Reichstag in Schutz genommen hatte). Karlstadt aber vorverlegte die Feier auf den 25. Dezember 1521. Es kam zu Unruhen und Beschwerden, denn der Kurfürst hatte schon lange gewarnt, dass die Wittenberger Reformatoren, obwohl sie das „heilige Evangelium“ predigen durften, vielleicht auch sollten, keine Änderungen in dem Gottesdienst oder dem Kirchenbrauch einführen sollten.
Aber gerade hier lag das Problem: Auf der einen Seite schützte der Kurfürst Luthers Recht, das Evangelium frei zu predigen; auf der anderen Seite, weil er die Intervention in seine politischen Interessen von Seiten des Kaisers fürchtete, wollte er keine Kirchenänderungen zulassen. Karlstadt aber hatte jetzt eine solche eingeführt, und zwar in Bezug auf eine der wichtigsten kirchlichen Zeremonien. Und, wie gefürchtet, blieb die kaiserliche Intervention nicht aus. Schon am 20. Januar 1522 kam ein Mandat von dem Reichsregiment aus Esslingen, das unter Drohungen einen Rückzug in Wittenberg verlangte. Während die Reformatoren vor dem Mandat gesagt hatten, dass Friedrich der Weise die Folgen davon auf sich nehmen müsste, weil Gott das klare Evangelium in des Kurfürsten Land hatte aufgehen lassen, sahen sie jetzt die Konsequenzen. Und der Kurfürst machte ihnen klar, dass ihr ganzes reformatorisches Streben untergehen würde, wenn sie hartnäckig auf ihrer Sache bestehen blieben. So wurden die Messereformen rückgängig gemacht und die Hand des Kurfürsten gestärkt. Und so kam es auch, dass der Kurfürst die Frage der Reformation in seinen Ländern in dieser Weise löste – Wort Gottes predigen, aber keine Änderungen in den Kirchenbräuchen und Zeremonien zulassen.
Das Nürnberger Mandat vom 6. März 1523
Obwohl der Wormser Reichstag durch das Edikt vom 9. April 1521 Luther in Acht und Bann gestellt hatte, war das Problem der Reformation im Heiligen Römischen Reich nicht gelöst. Denn Luthers Schriften wurden immer noch gedruckt und in alle Welt geschickt und die Zahl seiner Nachfolger wurde immer größer. So kam es in den Jahren 1522-1523 zu einem zweiten Reichstag, der die Lutherfrage regeln sollte. Weil der Kaiser aber in Spanien war, musste das Reichsregiment, das 1521 stellvertretend die exekutive Macht im Reich ausübte, die Leitung übernehmen. Zwanzig führende Männer des Reichs machten das Reichsregiment aus; zwei Präsidenten – Friedrich der Weise und Friedrich von der Pfalz – wechselten sich alle sechs Monate ab.
In diesem Reichsregiment führte Friedrich der Weise, Kurfürst von Sachsen, durch seinen Stellvertreter Hans von der Planitz seine Reformationspolitik durch. Und am 6. März 1523 wurde diese Politik durch ein Reichsmandat Gesetz für das ganze Reich. Die Schwerpunkte des Gesetzes waren: 1) Es befahl, dass alle politischen Instanzen im ganzen Reich darauf achten sollten dass alle Prediger nur das heilige Evangelium nach der Deutung der besten Kirchenlehrer predigen sollten. Obwohl solch ein Gebot der Reformation zugute kam, kam die Reformation – und allmählich die reformatorischen Kirchen – dadurch unter die Kontrolle der politischen Mächte. (Im Jahre 1530 sagte der Straßburger Gesandte Jakob Sturm von den Predigern auf dem Augsburger Reichstag, dass sie alle die Theologie ihrer Fürsten predigten) 2) Obwohl alle Priester und evangelischen Prediger nur das heilige Evangelium predigen sollten, konnten sie keine Änderungen in den Gottesdiensten einführen, bevor nicht ein Kirchenkonzil die ganze Sache der Reformation untersucht hatte. Solch ein Konzil sollte in einem Jahr stattfinden – aber erst 1545 kam das Konzil zustande. „Mittlerweile“ aber sollte man nur das heilige Evangelium nach der Deutung der von der christlichen Kirche anerkannten Kirchenlehrer predigen. Wer waren diese Lehrer? Katholiken behaupteten die Letzten, wie Duns Scotus, Thomas von Aquin usw. Protestanten meinten die Frühesten, die großen Kirchenväter des 3. und 4. Jahrhunderts. Man konnte sich in dieser Frage nicht einigen, und so wurde der Satz ohne Namen in das Reich geworfen. Zuletzt war der Streit zwischen Katholiken und Protestanten ärger als zuvor.
Das Mandat in Wittenberg und Zürich
a) Wittenberg
Obwohl Luther, nachdem er von der Wartburg im März 1522 zurück kam, Karlstadts Reformen unter Friedrichs Anleitung abschaffte, wurde ihm innerhalb eines Jahres klar, dass er dem Mandat nicht gehorchen konnte, denn während er die Messe einen Greuel vor Gott schalt, musste er sie jeden Sonntag als Priester öffentlich feiern. Er tat es, weil Friedrich ihn überzeugt hatte, dass die Leute für eine solche Änderung im Gottesdienst nicht genügend vorbereitet seien. Aber als Albrecht von Mansfeld ihn im April 1523 fragte, ob ein Fürst die Messe feiern könne wenn er überzeugt sei, dass sie ein Greuel vor Gott sei, musste er es verneinen. Als er daraufhin selber die Messe in Wittenberg abschaffen wollte, stand ihm Friedrich der Weise mit seinem Nürnberger Mandat im Weg. Erst am 10. Mai 1525, nachdem Friedrich gestorben war, wurde die Messe in Wittenberg abgeschafft und weitere Änderungen in den Gottesdienst eingeführt.
Hier nun lag die große Schwierigkeit: Auf Grund des Evangeliums schalt man, schon mindestens seit 1521, die Missbräuche in der Kirche von der Kanzel als Greuel vor Gott, und besonders die Messe. Aber man musste sie trotzdem alle beachten und feiern, weil das Mandat Änderungen verbot, bis ein Konzil sie abschaffen oder ändern würde. Das Konzil aber ließ auf sich warten, weil der Papst und der Kaiser sich nicht einigen konnten, wo und wie das Konzil einberufen werden sollte und was es zuerst behandeln sollte. Und so wurde es erst 1545 einberufen, und zwar in der Grenzstadt Trient.
Dieser Sachverhalt führte zu einer Scheidung der theologischen Geister: Radikale Reformatoren meinten, die Politiker sollten mit kirchlich-theologischen Fragen nichts zu tun haben; wenn man überzeugt sei dass der kirchliche Brauch nicht auf einer biblischen Basis ruhe, müsse man ihn sofort ändern. Änderungen aber waren durch das Nürnberger Mandat gesetzlich verboten.
b) Zürich
In der Fastenzeit vor Ostern 1522 hatte Ulrich Zwingli, Reformator von Zürich, an einer Veranstaltung teilgenommenn auf der gegen das Kirchengesetz Fleisch gegessen wurde. In seiner nächsten sonntäglichen Predigt rechtfertigte er die Übertretung. Der Bischof von Konstanz aber, der die Aufsicht über Zürich hatte, konnte Zürichs Verbrechen nicht übersehen. Er griff ein, schrieb dem Rat und verlangte einen Rücktritt. Der Rat dagegen, veranstaltete Ende Januar 1523 ein öffentliches Gespräch über die Frage. Inzwischen wurde das Nürnberger Mandat vorbereitet. Schon im Januar war es an die Öffentlichkeit gekommen in Form eines Reichsabschieds. Und Zürich wusste wohl, was sich in Nürnberg abspielte – sie hatten ihre Emissäre am Platz.
Das Gespräch also, das in Zürich Ende Januar 1523 zwischen Zwingli und Johann Fabri stattfand, musste auf Grund der Bibel – da nichts als das heilige Evangelium in solchen Gesprächen zu gelten habe – geführt werden. Das kanonische Recht der katholischen Kirche sowie ihre Tradition und die Erlasse der Päpste und Konzilien waren in den Predigten und Gesprächen plötzlich ungültig geworden. Und so kam es, dass das Zürcher Gespräch vom 29. Januar 1523 auch die Entscheidung traf, nur das heilige Evangelium müsse gepredigt werden. Es blieb aber nicht bei der Entscheidung derer, die am Gespräch teilgenommen hatten: der Bürgermeister und Rat griffen zu und gaben ein Mandat heraus, das befahl, dass alle Priester in Zürich und seiner Umgebung von nun an nur das heilige Evangelium predigen sollten, und zwar nach der Auslegung Zwinglis!
Der Bruch der Täufer mit Zwingli
a) Das Zweite Zürcher Gespräch – Oktober 1523
Soweit waren Zwinglis Nachfolger mit ihm zufrieden, und sie fingen an das Evangelium in Stadt und Land zu predigen. Aber um in den Gottesdiensten Änderungen einzuführen die mit der neuen Proklamation des Evangeliums übereinstimmen würden, ordnete man ein zweites Gespräch für Oktober an, wo man die Missbräuche der Kirche besprechen könnte. In diesem zweiten Gespräch wurden Messe und Heiligenbilder verurteilt, aber irgendwelche Reformen in diesen Sachen wurden „meinen Herren vom Stadtrat“ überlassen. Dies war Zwinglis Entschluss; viele seiner Jünger wollten ihm aber hierin nicht folgen. So sprach Simon Stumpf, einer der Letzteren: „Meister Ulrich, wir können diese Reformen den Herren vom Stadtrat nicht überlassen, denn der Heilige Geist hat gesprochen.“
Eine Änderung in der Messe wurde aber erst Ostern 1525 eingeführt, nachdem der Bürgermeister gestorben war. Und so mussten Zwingli und seine Mitarbeiter die Messe bis zu dieser Zeit feiern, obwohl sie die Messe als einen Greuel vor Gott verdammten. Solche Kompromisse wollten Zwinglis radikale Jünger nicht mitmachen. Sie kamen daher zu ihm und sagten, dass sie es so tun wollten, wie es die Apostel in der Zeit Christi getan hatten – eine freiwillige Kirche wahrer Nachfolger Christi zu errichten. Zwingli aber wehrte sie ab mit Augustins Deutung des Gleichnisses vom Weizen und dem Unkraut, und sagte ihnen, dass Christen auch unter dem Unkraut leben könnten. So wählten die Jünger Zwinglis den Weg der Freikirche, und am 21. Januar 1525 vollzogen sie die erste Glaubenstaufe nach vielen Hunderten von Jahren.
b) Die Verfolgung der „christlichen Brüder“
Und nun zeigte sich, was für ein Staat der sogenannte protestantische „christliche Staat“ eigentlich war, denn unter Zwinglis eigener Anleitung fing er an, anders Glaubende zu verfolgen und ums Leben zu bringen. Schon im September 1524 hatte Konrad Grebel, Führer der radikalen Gruppe, Thomas Müntzer geschrieben, dass wahre Christen „schaffe der schlachtung“ seien, die in „angst und not, trübsal, verfolgung, liden und sterben getaufft“ werden müssten. Auch sie wussten, wie alle Protestanten im 16. Jahrhundert, dass die wahre Kirche nur eine verfolgte Kirche sein konnte. Wenn eine Kirche anfing andere zu verfolgen, war sie schon eine abgefallene Kirche; eine Kirche, die sich mit der Welt vermählt hatte. Welcher wahre Christ konnte nun irgend etwas mit diesen beiden Institutionen zu tun haben?
Aus obigen Gründen machten die ersten Täufer so einen starken Unterschied zwischen Reich Gottes (Kirche) und dem Reich dieser Welt (der Staat). Nach ihrer Ansicht konnte der Christ keine Kompromisse mit solch einem Staate machen. Also sagten sie in ihrem Schleitheimer Bekenntnis von 1527:
- Über die Absonderung von dem Übel und der Gottlosigkeit, die der Teufel in der Welt gepflanzt hat, die [unter Christen] stattfinden soll, nur soviel: dass wir mit ihnen keine Gemeinschaft pflegen, laufen auch nicht mit ihnen in den Verwirrungen ihrer Greuel. So ist es: da alle die nicht in den Gehorsam des Glaubens getreten sind und nicht mit Gott vereinigt so dass sie seinen Willen tun, eine großen Greuel vor Gott sind, so kann aus ihnen nichts wachsen oder vorkommen als greuliche Sachen. Nun gibt es in der Welt und unter allen Creaturen nichts anderes als gut und böses, glaube und unglaube, Finsternis und Licht, die Welt und die, die aus ihr heraus gekommen sind, der Tempel Gottes und der Abgötter, Christus und der Teufel, und keiner wird mit dem Anderen irgendwelchen Anteil haben.
Am 5. Januar 1525 wurde Felix Mantz in Zürich ertränkt. Konnte Zwingli, der dieses verursacht hatte, ein Christ sein? Der Staat war zwar gegen die Täufer, aber es waren die evangelischen Prediger – wie die Täufer überall beteuerten – die den Staat zur Verfolgung der Täufer hetzten. Und diese selben evangelischen Prediger, wie Sebastian Castellion in seinem Buch über die Verbrennung der „Ketzer“ schrieb, hatten zuerst selber – als sie gegen die katholische Kirche auftraten – für ihre Religionsfreiheit plädiert. Er verglich sogar ihre frühen Schriften in dieser Beziehung mit den späteren, in denen sie dieselbe Freiheit ihre protestantischen Gegnern verweigerten – nachdem sie die Gunst des Staates durch ihre Kompromisse erworben hatten.
Es ist kein Wunder, dass die Täufer von solch einer Kirche, von solch einem Staate, nichts wissen wollten. In solch einem Staate konnte kein wahrer Christ dienen, keinen Posten bekleiden. Und obwohl in dessen Kirchen die Prediger das Wort Gottes rühmten, zeugten diese Predigten keine geistliche Frucht. „Von all diesem,“ sagten sie, „sollen wir getrennt leben und keine Beziehungen zu ihnen haben, denn sie sind lauter Greuel, die uns gehasst machen wollen vor unserm Herrn Christus, der uns von der Knechtschaft des Fleisches befreit hat und uns für den Dienst Gottes geeignet hat, und den Geist den er uns gegeben hat.“
Luther und viele andere hatten die katholische Kirche die Hure Babylons gescholten, weil sie die wahren Christen töteten; ja, sagten die Täufer, wie kann die evangelische Kirche besser sein?
Trennung von Kirche und Staat
Hätte Friedrich der Weise nicht in der Luthersache eingegriffen, wären zwei Ergebnisse möglich gewesen: 1) Entweder hätte die lutherische Bewegung sich zur Freikirche entwickelt – die ersten Anfänge dazu waren schon vorhanden, als Friedrich eingriff; oder 2) die Bewegung wäre von ihren katholischen Gegnern vernichtet worden. Das Letztere fürchteten sie. Aber es hätte auch nicht so kommen müssen, denn die Täuferbewegung blieb trotz der schwersten Verfolgungen von außen, und die schlimmsten Anfechtungen von innen durch die Gewaltanwendung der Münsteraner bestehen.
Die Frage für uns ist aber: Welche Konsequenzen haben die friedlichen Täufer aus diesen Umständen für ihr politischen Handeln gezogen? Die erste Konsequenz war, dass man eine scharfe Trennung ziehen musste zwischen Kirche und Staat. Die Täufer sind die ersten gewesen, die eine solche Scheidung verlangten. Hier spielten theologische wie zeitlich-politische Faktoren eine Rolle. Der amerikanische Täuferforscher Franklin H. Littell hat so darüber geschrieben:
- „Religiöse Freiheit ist grundlegend für den Fortschritt der Freiheit und Selbstverwaltung überhaupt, für das Wohl der wahren Religion, und für die Gesundheit der Staatenbildungen. Nichts verdirbt Kirchen oder Regierungen grundsätzlicher als das Bündnis zwischen religiösen Bekenntnissen und Regierungszwang, bei dem die Politiker vorgeben, endlichen Zwecken zu dienen in ihrer Ausübung der politischen Macht. Und nichts zerfrisst eine erhabene Religion vollständiger als wenn die Macht des Staates sich ihrer bedient um ideologische Ziele zu erreichen. Gewissenszwang ist ein dürftiges Fundament für Kirche oder Staat, wie die radikalen Protestanten ganz richtig behauptet haben seit der Zeit der Täufer des sechzehnten Jahrhunderts – Pioniere in der Scheidung von Kirche und Staat“.
Das war die eigentliche Politik der Täufer – diese Trennung zustande zu bringen. Als sie das nicht tun konnten, wandten sie sich von dem „christlichen“ Staat und der „staatlichen“ Kirche ab und wollten mit beiden nichts zu tun haben.
Was hätten die Täufer getan, wenn die Kirche vom Staat im 16. Jahrhundert getrennt gewesen wäre? Hätten sie den Staat und die bestehende Staatskirche so schroff abgelehnt? Und wenn sich in dieser Hinsicht vieles in den Ländern der Welt geändert hat – in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern der westlichen Welt – müssen wir uns an ihre schroffe Ablehnung binden lassen? Auch ist es in einem demokratischen Staate anders als in den Staaten des 16. Jahrhunderts. Ändert das die Einstellung eines Christen zur politischen Welt? Ich glaube schon. Das täuferische Prinzip ist hier Trennung von Kirche und Staat; wenn solch eine Trennung vorhanden ist, kann auch die Stellung eines Christen zum Staat positiver sein. Man könnte sogar in einem demokratischen Staate, in dem Kirche und Staat getrenntn sind, einen politischen Posten bekleiden. So tun es zumindest viele kanadische und auch einige amerikanische Mennoniten.
Politik und Wehrlosigkeit
Als ich noch ein junger Dozent war – etwa drei Jahre im Beruf – bekam ich eine Einladung, einen Vortrag über Reformation und soziale Ethik an einem christlichen (evangelischen) College zu halten. In dem Referat kam ich auch auf die Wehrlosigkeit der Täufer zu sprechen. Nach dem Vortrag wurde ich über diese Wehrlosigkeit befragt. In meiner Antwort sagte ich ganz offen, dass ich Mennonit sei und an die Wehrlosigkeit des Christen glaubte – und sie auch übte. Noch hatte ich keinen Menschen erschlagen!
Da kam es sofort: Wenn ich zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt werden sollte, was würde ich tun – also, mit der Armee. Ohne mich auch nur eine Sekunde zu bedenken, sagte ich: Ich würde sie abschaffen! Da konnte man ein schweres Seufzen in dem Saal hören. Ich meinte aber, dass sie keine Furcht haben sollten. Wäre ich ein Kandidat für die Präsidentenwahl, so würde ich den Wählern frei heraus sagen, was ich im Sinn hätte. Deshalb würde meine eventuelle Kandidatur nur von kurzer Dauer sein.
Aber nun zur Sache. Kann ich als wahrer Mennonit überhaupt einen Posten in einer Regierung bekleiden, die das Schwert braucht, um Verbrecher zu strafen und Krieg gegen „enemies foreign and domestic“ zu führen, wie es in dem Präsidenteneid der USA heißt? Wenn man die Wehrlosigkeit aufgegeben hat, wie es die meisten europäischen Mennoniten schon um die Zeit der napoleonischen Kriege getan haben, dann kann man sogar als Mennonit Kriegsminister werden, wie vor Kurzem in den Niederlanden. Kann man einen Regierungsposten bekleiden, zwar nicht den des Kriegsministers, wenn man wehrlos sein will? Ist man nicht von der Kriegseinstellung aller Regierungen kompromittiert, wenn man irgendeinen Regierungsposten bekleidet? Die Täufer sagten, ja. Es gibt aber in Kanada und auch anderswo, Personen die in solchen Posten dienen und gedient haben.
Reicht es aus, dass man vielleicht den Kriegsenthusiasmus mildert? Hätte ein Mennonit in George W. Bushs Regierungskabinett seinen Hunger nach Rache bremsen oder den Präventivkrieg gegen den Irak aufhalten können? Im 16. Jahrhundert wollten die Täufer überhaupt nichts mit einer weltlichen Regierung zu tun haben; sie sagten frei heraus, dass ein Christ keinen Regierungsposten bekleiden dürfe. Aber die Verhältnisse waren zu der Zeit auch anders. Und diese veränderten Verhältnisse muss man doch in Betracht ziehen. Es gab ja schon unter den Täufern Männer wie Felix Mantz die sogar die amtliche Todesstrafe einer Regierung verneinten, und Männer wie Balthasar Hubmaier, die meinten, der Christ müsse der Regierung in den Kampf folgen.
Der Eid
Im 16. Jahrhundert, in einer Welt, in der die meisten Leute nicht lesen noch schreiben konnten, war der geleistete Eid der Klebstoff, der die Gesellschaft zusammenhielt. Überall wo gesellschaftliche Obligationen vorhanden waren mussten die Parteien einen Eid ablegen, um ihr Versprechen zu erhärten oder zu konfirmieren. Wenn man unter diesen Umständen einen Eid verweigerte – wie es die Täufer taten nach Christi Wort: Euer Ja sei Ja und Euer Nein, Nein – so wurde man als ein Umstürzler angesehen. Die Täufer verweigerten ihn trotzdem, nach dem Wort, man müsse Gott mehr als den Menschen gehorchen.
Aber auch in dieser Hinsicht hat sich manches geändert. In den Vereinigten Staaten darf man an Eides statt eine feierliche Erklärung leisten. Auch dieses ändert das Verhalten eines Christen zum Staat. Mir will also scheinen, dass die Linie zwischen Gut und Böse in vielen modernen Staaten nicht mehr so markant ist, wie sie im 16. Jahrhundert den friedlichen Täufern vorkam. „The times they are a-changing“ sagt ein altes amerikanisches Volkslied, und der Staat steht vielfach nicht mehr in Konflikt mit dem Christentum, wenigstens nicht prinzipiell. Und so kann – oder sollte – der moderne Mennonit das politische Handeln der Täufer nicht so einfach übernehmen und auf seine eigene Zeit anwenden. Denn das politische Handeln der Täufer bezog sich auf ihre Welt, nicht auf unsere. Wir sollten eher ihre christlichen Prinzipien prüfen, und wenn sie die Probe bestehen, für unsere Zeit und Verhältnisse anwenden.
Was kann man nun zur Politik der Täufer, der friedlichen Täufer, sagen? Vielleicht zuerst, dass die politischen Normen, die in den verschiedenen Ländern maßgebend waren, sich über die Zeiten geändert haben. Solche Änderungen können die Lage bessern oder verschlechtern. Im 16. Jahrhundert waren sie besonders schlecht, und die Täufer lehnten deshalb jegliche Beteiligung an der Politik ab. Anhand derselben täuferischen Prinzipien, glaube ich, könnte der Mennonit heute eine andere Stellung zum Staat einnehmen. Weil die politische Lage sich zum Besseren – ich mache ein Fragezeichen – geändert hat. Man muss sich aber seiner Prinzipien sicher sein, und sie immer wieder anhand der Heiligen Schrift prüfen. Man muss auch die politischen Zustände immer wieder untersuchen, um zu prüfen, ob der Christ zum Guten des Landes und seiner Einwohner in der Politik arbeiten kann, oder ob er von den nicht-christlichen Mächten überwältigt wird. Die Täufer aber sagten sich: „Christus, durch seinen Missionsbefehl in Mt. 28, hat uns berufen, das Evangelium in aller Welt zu predigen. Also, wir haben eine höhere Berufung als uns in die Politik einzumischen. Wir sind berufen, das Evangelium von Jesus Christus, die frohe Botschaft, in alle Welt zu tragen“. Das, sagten sie, ist des Christen eigentliche Berufung. Alles andere ist viel weniger wichtig. Und so haben sie es anfänglich gemacht.
Die Politik der Mennoniten in Russland: Verfolgung und Lebensmöglichkeiten
Abraham Friesen
Die Verfolgungen der Täufer, besonders nach der münsterischen Katastrophe, beschränkten das politische Handeln der Täufer auf Appelle an die Obrigkeiten um Religions- und Gewissensfreiheit. So schrieb Menno in den fünfziger Jahren an die „christliche Obrigkeit“, in der Schweiz, wo die Verfolgungen vielfach am schwersten waren, schrieben die Täufer noch 1575 und 1585 zwei größere Bittschriften, „Einfältige Bekenntnisse“ genannt. Die eine ist etwa 460 Manuskriptseiten lang! Ihr Hauptargument war, wie sie selbst schrieben: Wir würden wohl zufrieden sein, wenn die (Zürcher) Obrigkeit uns an Hand der frühen Schriften ihrer eigenen Reformatoren leben ließe. Damit wollten die Täufer sagen, dass die magistralen Reformatoren selber – Luther, Zwingli, Bullinger, Bucer, Melanchthon, und wie sie noch alle hießen – ihre ersten, besten Einsichten in das „heilige Evangelium“ kompromittiert hatten, um die Gunst ihrer Obrigkeiten zu gewinnen. Wie wir gestern Abend sahen, geschah dies an Hand des Nürnberger Mandats vom 6. März 1523. Als diese Reformatoren die Gunst der Obrigkeiten gewonnen hatten, verlangten sie die Verfolgung ihrer Gegner: Luther die Verfolgung Thomas Müntzers und Zwingli die von Felix Mantz.
Auf dem zweiten Reichstag zu Speyer im Jahre 1529 wurde dann ein allgemeines Verbot gegen die Täufer herausgegeben, dass sie zum Tode verurteilte. Wer sollte sie weiterhin schützen? Wie Konrad Grebel in seinem im September 1524 an Thomas Müntzer verfassten Brief schrieb, in dem er Müntzers revolutionäre Ansätze verwarf:
- Man soll ouch das evangelium und sine annemer nit schirmen mit dem schwert oder sy sich selbs, alss wir durch unseren bruder vernommen hand dich also meinen und halten. Rechte gleubige Christen sind schaff mitten under den wölfen, schaff der schlachtung, müssend in angst und not, trübsal, verfolgung, liden und sterben getoufft warden, in dem für probiert warden, und das vatterland der ewigen rüw nit mit erwürgung liplicher finden, sunder der geistlichen erlangen. Sy gebrauchend ouch weder schwert noch krieg, wann bei inen ist das töten gar abgetan, wol aber wir werend noch des alten gsatzes, in welchem ouch (so fer wir uns bedenkend) der krieg, nach dem sy das gelobt land erorbert hattend, nun ein plag gewesen ist. Von dem nit me.
Von der Welt, ja, sogar von den Reformatoren selber, kam die Verfolgung. Die Täufer aber sahen sich als „schaffe der schlachtung.“
Das Überleben der Täufer
Wo konnten sich die Täufer in solch einer Welt halten? Gewiss nicht in den habsburgischen Ländern, wo der Kaiser direkte Kontrolle über die Kirche ausübte – also weder in Österreich, den Niederlanden (vor der Revolution von 1559), noch in anderen katholischen Teilen des Reichs. Und meistens auch nicht in den Städten, wo sie durch den Einfluss katholischer oder evangelischer Prediger verketzert wurden – und es waren hauptsächlich die Theologen, die die Obrigkeiten gegen die Täufer hetzten. Vereinzelt konnten die Täufer – wie in Ostfriesland – gnädige Landesfürsten finden, die sie schützten, aber auch hier nur unter strengen Bedingungen. Diese Bedingungen wurden oft in Schutzbriefen niedergelegt. Es gibt eine Reihe solcher Schutzbriefe, und zwar ist der erste – soweit wir jetzt wissen – der ostfriesische Schutzbrief vom Jahre 1623. Die Hauptbestimmungen waren immer dieselben: 1) Die Täufer/Mennoniten durften keine Kirchen haben und auch keine öffentlichen Gottesdienste halten; 2) sie durften keine Proselyten machen, niemanden für ihre religiösen Ansichten zu gewinnen suchen; und 3) sie mussten auch außerordentliche Steuern zahlen usw.
Durch solche Verträge wurden die Täufer oder Mennoniten „die Stillen im Lande.“ Sie wurden dazu durch die Verfolgungen gedrängt, denn in der Reformationszeit und im ganzen 16. Jahrhundert waren sie aggressive Missionare gewesen. Jetzt aber, machten sie Kompromisse mit dem Missionsbefehl Christi: „Gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium allen Kreaturen,“ um ihr Leben zu retten, und dann später den Kriegsdienst zu vermeiden. So blieben sie im Schatten der Politik und hingen an ihren Prinzen, die ihnen ihre werten Schutzbriefe gegeben hatten. Das politische Leben war ihnen verboten; sie hatten nur ihre Schutzbriefe, die später in Privilegien verwandelt wurden, als die Zeiten sich änderten.
In Polen bekamen die Mennoniten eine ganze Reihe solcher Privilegien von den Königen. Aber wenn ein König starb, verlangten sie von seinem Nachfolger entweder eine Bestätigung ihrer alten Privilegien oder ein neues Privilegium. Solch ein Privilegium schützte sie – so glaubten die Mennoniten wenigstens – vor dem Neid und dem Hass der Umwelt und der Laune des Prinzen-Königs selbst. Aber als Polen durch die drei Teilungen von Polen ab 1772 in die Hände der preußischen Herrscher kam, wurden ihre Privilegien – besonders ihre Befreiung vom Kriegsdienst – allmählich angegriffen. Die Mennoniten wandten sich an den preußischen König, in dessen Land sie sich nun befanden. Dieser aber wollte keine Kriegsverweigerer in seinem Lande dulden. Ihr Recht, Land zu kaufen, wurde eingeschränkt und ihre Privilegien in Frage gestellt. Da griffen die polnischen Mennoniten zu ihrer altehrwürdigen Politik – zur Auswanderung – und zwar dieses Mal nach Russland.
Die Mennonitenpolitik in Russland vor der Februar-Revolution von 1905
Zarin Katharinas erstes Landangebot von 1763 wurde von den preußischen Mennoniten ignoriert. Aber ihr zweites, nach den Teilungen von Polen, wurde angenommen. Sie sandten ihre Männer – Höppner und Bartsch – nach Russland, um das Land an Ort und Stelle zu untersuchen. Sie verhandelten über Privilegien mit Potemkin und auf die Versicherung Katharinas, dass die mennonitischen Privilegien von kaiserlicher Hand selbst geschrieben, ihnen zugestellt werden würde, nahmen sie das Angebot an. So wurde ihnen im Jahre 1800 das Große Privilegium, von Paul I. selbst geschrieben, zugestellt. Im Chortitzer Gebietsamt aufgehoben, versicherte das Große Privilegium den Mennoniten ihre Sonderstellung im Reich „auf ewige Zeiten.“
Das mennonitische Vertrauen auf die autokratischen Mächte der Zeit hatte sich gelohnt, denn hier nun im Land der Zaren und der orthodoxen Kirche wurde ihnen 1) die freie Ausübung ihre Religion versichert (es gab in Russland aber keine Trennung von Kirche und Staat, obwohl eine Art von Religionsfreiheit existierte); 2) der Kriegsdienst auf ewige Zeiten erspart; 3) verschiedene Steuern zeitweilig erlassen; 4) sie konnten in geschlossenen Ansiedlungen leben (warum ist umstritten; wahrscheinlich wollte die Landeskirche – wie schon alle anderen Landeskirchen vorher – keine Konkurrenz von ihnen dulden); 5) sie konnten sich selbst regieren und ihre eigenen Schulen aufbauen; aber 6), war ihnen verboten Proselyten unter den Orthodoxen zu machen. Also, obwohl sie Religionsfreiheit hatten, existierte keine Gewissensfreiheit in Russland, und jeder Austritt aus der Landeskirche wurde hart bestraft. 7) Die Mennoniten durften auch keine richtigen Kirchen mit Glocken und Türmen bauen, sondern nur schlichte und einfache Bethäuser.
Obwohl nun das Große Privilegium den Mennoniten Russlands viele Vorteile bot, so schränkte es sie doch in der Verkündigung des Wortes Gottes auf ihre eigenen Leute ein. Aber das waren sie doch schon lange gewohnt; dies war ihnen überall geschehen, wo eine Landeskirche herrschte. In den Akten gibt es auch keine Diskussion unter den auswandernden Mennoniten über dieses Verbot. Im Jahre 1800 war dies schon lange kein Hindernis mehr. Erst als die Mennoniten Brüder 1860aufkamen wurde das Proselytenverbot problematisch. Und zwar unter den beiden mennonitischen Gruppen, weil die Mennoniten Brüder das Verbot überschritten; und zwischen den Mennoniten als solchen und der Regierung.
Trotzdem könnte man die mennonitische Politik in Russland von 1800 bis 1905 eine Politik der Erhaltung des Großen Privilegiums nennen. Denn sie bestand hauptsächlich in der Einreichung von Bitten um die Erhaltung ihrer Privilegien, wenn ein neuer Zar den Thron bestieg, weil sie in der Vergangenheit des Öfteren die Erfahrung gemacht hatten, dass Regierungs- oder Königswechsel althergebrachte Verträge aufheben konnten. Und sie spürten ganz klar, wenn sie die Gunst des Zaren verlieren sollten, hätten sie keinen Halt im Lande mehr. Sie waren ja eine sehr kleine Minderheit in einem großen, fremden Völkerreich. Konnte man sich als eine kleine religiöse und ethnische Gemeinschaft in solch einem großen Reiche erhalten, wenn man das Wohlwollen des Kaisers verlieren sollte?
Kirche und Staat in den mennonitischen Kolonien
Diese religiöse und ethnische Gemeinschaft war auch eine politische Gemeinschaft, die sich selbst verwaltete. Abgeschlossen von der größeren Gesellschaft, arbeiteten Kirche und Staat zusammen, ohne viel Aufsicht von Seiten der russischen Regierung. So verschmolzen im kleineren Rahmen mennonitische Kirche und mennonitischer Staat zu einem corpus mennoniticum, der sich im Jahre 1860, als die Mennoniten Brüder sich von ihm trennten, in der Sprache der lutherischen Landeskirche verstand als eine „gemischte“ Kirche von Weizen und Unkraut. Ältester Lenzmann von Gnadenfeld hat die mennonitische Kirche mit diesem Gleichnis 1860 gerechtfertigt, spätere Konferenzen haben es in ihren Resolutionen bestätigt, und Ältester Heinrich Dirks hat es im Jahre 1892 in seinem Buch Das Reich Gottes im Lichte der Gleichnisse theologisch schriftlich aufgearbeitet. Aber hier ist nicht der Platz, wo man die innere Politik der mennonitischen Kolonien Russlands untersuchen kann. Vor Jahren schon hat Robert Kreider einen Aufsatz darüber geschrieben wie auch vor kurzem James Urry in seinem Buch None but Saints.
Um die Zeit der Gründung der Mennoniten Brüdergemeinde fingen in Russland auch die großen Reformen an: die Emanzipation der leibeigenen Bauern; die Errichtung von eigenständigen Gerichten; die Verleihung von demokratischen Institutionen an das ländliche Volk in den Zemstvos. Diese Zemstvos, die den Rahmen der mennonitischen Politik erweiterten, weil sie größere Landesteile repräsentierten, brachen die Geschlossenheit der mennonitischen Kolonien zum Teil auf und wollten sie dadurch stärker in die breitere Gesellschaft integrieren.
Die Russifizierung der mennonitischen Schulen, in denen die Fächer in der russischen Sprache unterrichtet werden sollten, in denen russische Lehrer in den Kolonien von der Regierung eingesetzt wurden, hatten denselben Zweck – also die Minderheitsgesellschaften Russlands in den russischen mainstream einzufügen.
In den Zemstvos machten die Mennoniten mit, aber sie sträubten sich gegen die Russifizierung ihrer Schulen. Peter Braun schreibt darüber:
- Durch diese Politik wurden Freunde der Sache [also die Einführung der russischen Sprache in den mennonitischen Schulen] zu ihren Gegnern. So geschah es auch im Schulrat. Wer z.B. den Ältesten Görz nur aus dieser späteren Zeit kennt, wo er immer wieder für Wahrung der religiösen Interessen und der Muttersprache eingetreten ist und eintreten musste, der könnte meinen, dieser Mann sei immer ein eingefleischter, ausgesprochener Nationalist gewesen. Und doch war gerade dieser Älteste Görz in den 70er und 80er Jahren ein eifriger Förderer des russischen Unterrichts. Als einer der ersten hatte er den Unterricht in der russischen Sprache eingeführt zu einer Zeit, als noch nur wenige daran dachten, und hatte in der Gesellschaft Stimmung dafür gemacht. Und seine Verdienste in dieser Beziehung waren auch anerkannt worden. Jetzt aber war eine andere Zeit angebrochen, die ihm andere Aufgaben stellte und ihn in eine andere Richtung drängte. Eine ähnliche Wandlung haben auch Männer wie W. Neufeld, K. Unruh u.a. durchgemacht.
Die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht
Die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in Russland im Jahre 1873 sollte Russland mit den anderen Ländern Europas militärisch gleichstellen; aber sie hatte auch einen anderen Zweck. Dieser andere Zweck war die Sozialisierung oder Vergesellschaftung der Soldaten in Russland. Das hat Eugene Weber schon 1976 für Frankreich gezeigt und jetzt Josh Sanborn auch für Russland behauptet. Also war die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht auch ein Bestandteil der Russifizierung. Ob das die russischen Mennoniten wussten oder nicht, sie reagierten darauf mit der Drohung der Auswanderung. (Also wieder die Politik der Auswanderung.) Auf keinen Fall wollten sie ihre Söhne in die russischen Kasernen schicken, wo die rauhesten Menschen lebten. Die Regierung gab nach, und die Mennoniten – wenigstens die, die nicht auswanderten – kamen mit ihrem Forsteidienst davon, den sie selber unterhielten und in dem ihre Söhne von der Armee abgesondert waren, und in dem sogar Mennoniten mit Predigt und Seelsorge dienen konnten.
So haben sich die Mennoniten in diesen Jahren gegen die meisten Aspekte der Russifizierungspolitik des Kaisers erfolgreich behauptet. Aber indem sie dieser Politik der Regierung widerstanden, entfremdeten sie sich von der Macht in Russland, die sie schützen und schirmen konnte. Und sie würden solchen Schutzes immer mehr bedürfen, denn das nationale Gefühl in Russland wurde immer stärker, und die Erznationalisten griffen die „Fremden im Lande“ immer härter an, besonders solche, die schon 100 Jahre das Wohlwollen der Regierung genossen hatten und immer noch abgeschlossen lebten, die Landesprache unzureichend handhabten, mit den Russen wenig oder nichts zu tun hatten, und das Vaterland im Krieg nicht schützen wollten. Dieses Dilemma sollte sich im Ersten Weltkrieg in den Land Enteignungsgesetzen gegen deutsche und mennonitische Kolonisten zuspitzen. Im Vorwort zum ersten dieser Gesetze vom 9. Oktober 1414 hieß es, wie David Epp darüber im Botschafter schrieb: Dem Vorworte nach, hat die russische Regierung den Landankauf von Ausländern schon dreißig Jahre untersucht. Dieser Ankauf und ihre Ausdehnung war solcher Art, dass man die Sache angreifen musste . . .
Das Vorwort behauptet weiter, dass, aus politischer Sicht, diese deutschen Ansiedler durchaus [dem Vaterland] untreu sind. Die Zahl derer unter ihnen, die die Wehrpflicht verweigern, ist immer enorm gewesen. 1906 waren es 13,5%; 1907, 19,5%; 1908, 20,5%; und 1909 22,5%. [Wahrscheinlich alle Mennoniten.] Zu gleicher Zeit gehören sie Organisationen an, die Deutschland und Österreich unterstellt sind, und dienen in dessen Armeen.
An Hand solcher Beobachtungen hat die Regierung gefolgert, dass die ausländischen Siedler, obwohl sie schon so lange in russischen Ländern leben, nicht nur keinen Versuch gemacht haben mit dem russischen Volk zu verkehren, sondern dass sie hartnäckig an ihren Sitten festhalten und sich von dem russischen Volke fern halten, auf das sie herunterschauen und das sie mit einer beinah bösartigen Einstellung behandeln. Diese ausländischen Ansiedler können nur formal als russische Untertanen gelten. Ja, was ihre Überzeugung, Gewohnheiten und Religion angeht, so fühlen sie sich zu ihren rassischen Brüdern jenseits unserer Grenzen, und zu dem Zentrum einer ausländischen Zivilisation, hingezogen.
Die Mennoniten Russlands hatten sich zwar gegen die Russifizierungsversuche der Regierung behaupten können, aber dadurch hatten sie auch das Wohlwollen der Regierung eingebüßt.
Die Wende zur Demokratie – so meinten wenigstens die Mennoniten
Russlands Wende zu einer begrenzten Demokratie im Oktober 1905, nach der Niederlage im Kriege gegen Japan und der darauffolgenden Revolution, brachte den Russen eine Duma (eine Abgeordnetenkammer), eine Repräsentivverfassung und die drei großen Freiheiten – wie Heinrich Braun die Gewissensfreiheit, die Pressefreiheit und die Versammlungsfreiheit nannte. Die Zensur wurde aufgehoben und die Mennoniten gründeten sofort ihre Zeitschriften: der Botschafter und die Friedensstimme. Obwohl die Mennoniten – wie auch die anderen Einwohner Russlands – jetzt mehr Freiheiten besaßen, war ihre Sonderstellung – ihre Privilegien – in Frage gestellt. Denn in einer Demokratie sollen keine Privilegien existieren: ein jeder ist vor dem Landesgesetz ebenbürtig, und hat gleiche Rechte als Bürger (er ist nicht länger Untertan). Mennoniten mussten jetzt also in ihrer ganzen Einstellung zum Staate umdenken, vielleicht sogar in der Tagespolitik der Duma mitmachen. Abram Kröker, Schriftleiter der Friedensstimme, machte immer wieder darauf aufmerksam, dass die Mennoniten entweder Freunde in der Duma haben oder sonst ihre eigenen Abgeordneten dort haben müssten. Sie haben beides getan, um ihre Interesse als kleine Minderheit soweit wie möglich zu wahren. 1907 wurde Hermann Bergmann in die Duma gewählt; später, im Jahre 1910, wurde Peter Schröder noch dazu gewählt. An den Duma Debatten aber haben sie kaum teilgenommen, doch waren sie in verschiedenen Dumaausschüssen tätig, wie Bergmann im Religionsausschuss. So wusste er mindestens, was die Regierungsminister dort vortrugen und wie die Duma darauf reagierte. Und dieses Wissen hat den Mennoniten in der ganzen Sekten bzw. Konfessionsdebatte der Jahre 1908 bis 1914 viel geholfen.
Die Friesen Partei
Andere Mennoniten, wie P. M. Friesen, schlugen einen anderen Weg ein: er gründete seine eigene politische Partei, die Friesen Partei genannt wurde. Zu dieser Zeit waren die russischen Mennoniten schon in der russischen politischen Welt ziemlich aktiv. Sie kannten sich in St. Petersburg gut aus, denn seit 1873 hatten sie sich dort gute Kontakte erworben, um ihre Sonderstellung zu schützen. Große Gutsbesitzer, wie Hermann Bergmann, hatten schon vor 1907, als er in die Duma kam, verschiedene politische Ämter – große und kleine – bekleidet. Es gab mennonitische Bürgermeister wie Johann Esau in Ekaterinoslav. Und, wie gesagt, waren viele in den Zemstvos tätig.
Friesens Partei wurde „die Vereinte Partei der Freiheit, Wahrheit und des Friedens: Feinde aller Gewaltanwendung und Förderer dauernden bürgerlichen, ökonomischen und moralisch-geistlichen Fortschritts,“ genannt. (Kein Wunder, dass sie bald einging!) Friesen versuchte in seiner Partei die verschiedenen evangelischen Gruppen in Russland zu vereinigen: die Mennoniten Brüder, die Stundisten, denen er so oft schon geholfen hatte, die Baptisten, die mit den Brüdern viel gemein hatten, und die Evangelischen Christen unter der Leitung Prochanovs. Auch hatte die Partei ihr eigenes Programm, wie folgt
- sie forderte eine verfassungsmäßige Monarchie;
- das allgemeine Wahlrecht;
- das Recht zur Beibehaltung ihrer eigenen Sprachen für Minderheitsgruppen;
- Selbstverwaltung für kleinere Orte;
- freie Gerichte;
- Arbeiterrechte;
- allgemeine Schulbildung;
- die Abschaffung der Armut; und
- die Gewissensfreiheit, Sprachfreiheit, Versammlungsfreiheit und persönliche Freiheit.
Die Friesen Partei stand den Kadetten (Konstitutionelle Demokraten) am nächsten, und ging nach kurzer Zeit in ihr auf. Im Jahre 1908 verwandelte sich diese Gruppe in eine Religionsgemeinschaft mit der Gründung der Raduga Verlagsgesellschaft, die eine allgemeine Reformation in Russland zuwege bringen wollte.
An erster Stelle in dieser Gesellschaft standen Heinrich Braun als Leiter des Verlags und Prochanov als Vorsitzender der russischen Evangelischen Christen. Sie waren überzeugt, dass das Oktober Manifest totale Glaubensfreiheit versprochen hatte. Und in Wirklichkeit hatte es das auch. Nur wurde diese Glaubensfreiheit nie in einem förmlichen Gesetz niedergelegt. Als man dieses allmählich in den mennonitischen Kolonien inne wurde, kam der alte Streit über das Proselytenverbot wieder auf; und besonders nachdem der Raduga Verlag vom tauridischen Vizegouverneur im März 1910 untersucht wurde.
Die Kontroverse um die Frage: Sekte oder Konfession
Ungefähr zu derselben Zeit wurde in den mennonitischen Kreisen bekannt, dass die Regierung ihre religiöse Stellung als protestantische Konfession in die einer Sekte umwandeln wollte. Um mit der Regierung über diese und auch andere aufkommenden Fragen zu verhandeln, stellten die Mennoniten – auf der ersten Bundeskonferenz im Jahre 1910 in Schönsee – eine Kommission für kirchliche Angelegenheiten auf, in die Heinrich Braun, David Epp und Abram Görz gewählt wurden. Sofort reisten sie nach Petersburg, um in der Religionsabteilung des Ministeriums des Inneren vorstellig zu werden. Sie schrieben, das heißt David Epp schrieb, lange Aufsätze über die Herkunft der Mennoniten, in denen er behauptete – an Hand Ludwig Kellers Deutung der Täufergeschichte – dass Mennoniten keine Sekte sein könnten, da sie die ununterbrochene Fortsetzung der apostolischen Kirche darstellten. Sie waren also die einzig wahre Kirche; alle anderen – sogar die katholische Kirche – hatten sie verlassen. Solch eine Deutung ist wohl bei den Orthodoxen nicht gut angekommen. Immer wieder kamen Krisen in dieser Sache, aber die Regierung hat nie ein förmliches Gesetz darüber herausgegeben, und so blieb man in dauernder Unruhe darüber, bis der Weltkrieg die Regierung vor andere Probleme stellte.
Die Landenteignungsgesetze
Im Februar und wieder im Dezember 1915 gab die Regierung ihre berüchtigten Landenteignungsgesetze heraus, die die Russlanddeutschen im Auge hatten. Zuerst auf die Grenzgebiete gerichtet, erfuhren die Mennoniten in den Kolonien schon im April/Mai 1915, dass sie nicht verschont bleiben sollten. Die Gutsbesitzer mussten zuerst dran. Schon vor dem Kriege behaupteten viele von ihnen – Heinrich Braun an erster Stelle – dass Mennoniten nicht Deutsche seien. Ursprünglich seien sie aus den Niederlanden gekommen, um der spanischen Inquisition zu entfliehen. Zuflucht hätten sie unter den Königen von Polen gefunden, und als Preußen ihre Länder durch die Teilung Polens an sich gerissen habe, seien sie nach Russland geflohen. Sie hätten also unter dem militärischen preußischen Staat so sehr gelitten wie jetzt Russland im Weltkrieg.
Im Sommer 1915 trafen sich in Melitopol eine große Menge dieser mennonitischen Bauern, wählten Heinrich Braun als ihren Bevollmächtigten und schrieben dann ungefähr 5000 Bittgesuche an den Kaiser worin sie um Befreiung von dem Gesetz baten. In den Bittgesuchen sagten sie, dass kein deutsches Blut in ihren Adern fließe, und dass sie sich von allem Deutschen lossagten. Da Heinrich Braun wegen Religionspropaganda um diese Zeit verhaftet werden sollte, floh er nach der Versammlung der Bauern nach Moskau, wo er Briefe an hohe Beamte in Petersburg erhielt. In der Hauptstadt, geschützt von einem Prinz Volkonsky, fand er Zuflucht und erfüllte seine Aufgabe als Bevollmächtigter der mennonitischen Bauern.
Ab Sommer 1916 fingen die eigentlichen Enteignungen an. Noch ungefähr 3000 Bittgesuche wurden eingereicht. Diese sowie die Bittgesuche vom Jahre 1915 stimmen wörtlich überein. Delegationen wurden nach Petrograd abgefertigt, die Minister und Dumaabgeordneten aufgesucht – und, vielleicht, auch bestochen. Aber es half alles nicht. Endlich, gegen Ende 1916 wurden Mennoniten inne, dass ein drittes Enteignungsgesetz im Januar 1917 herauskommen sollte. Wieder sandten sie eine Delegation; andere gingen auf eigene Faust los. Glücklicherweise war seit dem 16. Dezember 1916 ein neuer Justizminister eingesetzt worden. Dieser – namens Dobrovolsky – war ein ehemaliger Inspektor der Schulen von Tsarskoe Selo. Er war dann Sekretär für Rasputin geworden, so dass er den Zugang zu Rasputin kontrollierte und dabei viel Geld einnahm. Dieser Dobrovolsky ist höchstwahrscheinlich von den russischen Mennoniten bestochen worden – man sprach von 100.000 Rubeln – aber durch seine Vermittlung fanden die Mennoniten Erleichterung. Er legte eines ihrer Bittgesuche dem Kaiser vor, und dieser verordnete – mit der Zustimmung des Ministerrates – dass die Behauptung der Mennoniten, Holländer zu sein, untersucht werden sollte. Inzwischen sollten alle Prozesse gegen die Mennoniten eingestellt werden. (Die Akten aus den russischen Archiven haben wir vor sechs Monaten bekommen.) Auf so eine Weise wurden die Mennoniten gerettet, aber was waren die Kosten? Hätten sie noch ein paar Wochen gewartet, so wäre die zaristische Regierung gefallen. Die provisorische Regierung, obwohl sie die Gesetze nicht abschaffte, hat die Landenteignungsgesetze still fallen lassen.
Diese Episode hat einen großen Streit in den mennonitischen Kolonien, wie auch in der späteren Emigrantenliteratur, ausgelöst. Besonders Benjamin Unruh war ergrimmt über die ganze Sache, weil er glaubte, dass die russischen Mennoniten deutscher, oder zumindest gemischter Herkunft seien. Sein Buch über die Ostwanderung der Mennoniten ist eine ausführliche spätere Rechtfertigung seiner damals schon ausgesprochenen These.
Die Nachkriegsjahre: Deutschtum und Wehrlosigkeit
Die provisorische Regierung wollte eine verfassunggebende Versammlung einberufen, um eine neue Regierung zu bilden. Von den Mennoniten wurden Benjamin Unruh und Johann Willms als Abgeordnete gewählt. Aber bevor die Versammlung einberufen wurde, kamen die Bolschewisten an die Regierung und der Bürgerkrieg brach aus. Einer der Schwerpunkte des Krieges war in der Gegend von Molotschna, wo die Weiße und die Rote Armee abwechselnd vorrückten oder zurückwichen. Während ihre Sympathien bei der Weißen Armee waren, konnten die Mennoniten nicht öffentlich gegen die Roten auftreten. Von Januar bis April 1918 hausten die Roten in der Molotschna. Sie arretierten viele, mordeten andere, raubten und verlangten Getreide, Essen und andere Sachen. Wie Peter Braun seinem Bruder in Deutschland schrieb:
- Die letzten drei Monate haben wir in beständigen Ängsten gelebt und buchstäblich für unser Leben gezittert. Räuber und Mörder waren unsere Obrigkeit am Orte, das heißt, in der Wolost, Erpressungen und Gewalttaten waren an der Tagesordnung, und wehe dem, der auch nur mit einem Wort ihr Tun mißbilligte. Beim geringsten Anlass wurde der Revolver vor die Stirn gehalten, mit Erschießung gedroht, oder auch damit, dass man die Matrosen der Schwarzmeerflotte herrufen werde. Diese Matrosen sind der Inbegriff aller Schrecken, was wir aus eigenster Erfahrung wissen. Vor zwei Monaten hat eine Gruppe Matrosen, die der Halbstädter Arbeiterrat hergerufen hatte, hier eine Woche lang fürchterlich gehaust . . . Das waren unerträgliche Tage. Wir waren der rohen Gewalt und Willkür vollständig preisgegeben, weil die letzten Waffen gewaltsam abgenommen waren. Es hätten ja übrigens auch keine Waffen etwas genützt.
- In den letzten Tagen – vor einer Woche – kamen zu den Bolschewistischen Banden mit der sogen. Roten Armee noch die Räuberhorden der Anarchisten hier durch und machten die Gegend unsicherer. Denke dir einmal solche Banden verzweifelter Menschen in voller kriegerischer Ausrüstung, nicht nur mit Revolver und Flinten, sondern mit Maschinengewehren und Kanonen. Da war ja an Widerstand überhaupt nicht zu denken. Und dann bricht eine Bande von 5 – 6 Mann zu dir ins Haus herein und kehrt das Oberste zu unterst, lästernd, fluchend. Drohend, nach Geld schreiend, und nimmt alles, was ihnen gefällt, und jeden Augenblick kann dein Lebenslicht ausgeblasen werden. Nein, das möchte ich nicht zum zweiten mal durchleben!
Und dann kam Peter Braun auf die Reaktionen der Mennoniten zu diesem Terror zu sprechen:
- Was nun aber weiter? Fragen viele von uns. Wir haben viel durchlebt in diesen 4 Kriegsjahren, viel haben wir gelitten von der alten Regierung, noch mehr unter dem Regime der Bolschewisten. Diese Jahren haben bei vielen von uns Mennoniten – auch bei mir – eine große Wandlung verursacht, nicht nur in Bezug auf unseren Glaubenssatz von der Wehrlosigkeit . . . .
Also, auch Peter Braun kehrte der Wehrlosigkeit den Rücken.
Und dann kam die deutsche Armee im April in ihre Gegend. Die Mennoniten, die im Weltkrieg Holländer sein wollten, waren mit einem Mal beinah alle Deutsche. Unter der Anleitung deutscher Offiziere organisierten sie den Selbstschutz. Aber manch einer, wie B. B. Janz, war dagegen und warnte, was kommen würde, wenn die deutschen Truppen abziehen würden. Trotzdem gingen viele mit der Flinte in der Hand in die umliegenden Dörfer und verlangten ihre gestohlenen Sachen zurück. Andere machten nicht mit. Am 11. November 1918 mussten die deutschen Truppen abziehen, und so standen die mennonitischen Kolonien wieder schutzlos da. Inzwischen hatten sie mit ihren Strafexpeditionen in die Dörfer ihre eigene Lage verschlechtert. Sie wurden wieder attackiert, ihre Selbstschützler geschlagen und sie selbst der Bosheit der umliegenden Dorfbewohner und Räuberbanden preisgegeben. Ja, sagten die Letzteren, wo war nun ihre Holländerei, ihre Wehrlosigkeit? Für das Vaterland wollten sie im Krieg nicht streiten, aber für ihre materiellen Interessen, für ihren Reichtum und ihr Land hatten sie das Schwert geschwinde in die Hand genommen. Sie hatten ja auch gesagt, sie seien Feinde Deutschlands, aber hier hatten sie den Deutschen zugejubelt, als diese in die Ukraine einrückten. Was sie im Krieg gesagt hatten, waren lauter Lügen gewesen. Sie waren echte Deutsche und von ihrer viel gerühmten Wehrlosigkeit war keine Spur. So wurde ihr Schicksal am Ende schlimmer, als es vorher gewesen war. In diesem Fall übten die russischen Mennoniten die Politik der Selbstvernichtung.
B. B. Wiens, Peter Brauns sehr naher Freund und Leiter der Musterschule in Halbstadt, schrieb im Jahre 1934: „Diese plumpe Politik hat unser Schicksal besiegelt [Er spricht von der Aufnahme deutscher Truppen], denn innerhalb sechs Monaten mussten die deutschen Truppen abziehen. Russen, die uns vorher noch wohlwollten, hatten nun alle Achtung für uns Mennoniten verloren. Ja wir Mennoniten hatten die Achtung für uns selber verloren.“ Die äußere, materielle Vernichtung kann der Mensch vertragen. Aber viel schlimmer ist die Vernichtung des inneren Selbstwertgefühls.
Schluss
Es sollte einen nicht wundern, wenn in der Folge solcher Ereignisse und der darauf folgenden Auswanderung nach Amerika eine Diskussion über die Stellung der Mennoniten zur Russifizierung und die zumindest kulturelle Integration in das russische Volk stattfinden sollte. A. A. Friesen, Leiter der Studienkommission, stand auf der Seite der Assimilierung; Benjamin Unruh, der Sekretär, stand für die Abgeschlossenheit der Mennoniten und ihrer Kolonien. Er, und auch andere, nannten diese Kolonien „das mennonitische Ideal.“ Unruh argumentierte, dass so ein großes Völkerreich wie Russland seine Minderheitsgruppen doch besser behandeln müsse. Aber was der Einzelne und was der Staat tun sollten, hat meistens wenig mit dem zu tun, was sie in Wahrheit schaffen. Unruh war der Idealist, aber es ist auch fraglich, ob das russische „Ideal“ sich nachher behindernd auf die täuferische Freikirche ausgewirkt hat. Immerhin argumentierte A. A. Friesen für die kulturelle – aber nicht religiöse – Assimilierung der Mennoniten in Russland. Und mit diesem Zitat wollen wir unsere Bemerkungen schließen:
- Mir will es so scheinen, dass der einzige Weg, den wir gehen können, falls wir in Russland bleiben sollten, der ist, dass wir, d.h. unsere besten Leute, die höchsten Ideale der Nation klar erkennen und denselben zustreben, dass wir die höchsten Interessen des Staates und der Nation zu unseren Interessen machen und uns bestreben, Bürger allerersten Grades zu werden. Alle partikularistischen Bestrebungen, eng nationalistischer Art, von ‘mennonitisch’ oder deutsch, müssen auf den zweiten Plan treten. Ganz apolitisch werden wir nicht mehr sein können. Ich würde es weiter wünschen, dass die neue Regierung, hoffentlich eine wirklich demokratische, die Frage der Wehrlosen ganz individuell behandelte, wie es die US tun. Wir wären dann nicht mehr in der unwahren Lage, dass wir wehrlos geboren werden, und wären auch nicht in der Stellung der Privilegierten. Es wird sicherlich auch eine Reihe von wehrlosen Gemeinschaften unter den Russen entstehen. Dem Grundsatz der Wehrlosigkeit würde somit keine Gefahr vom Staate drohen. Die deutsche Sprache brauchten wir nicht sofort aufzugeben, wohl aber müßten wir das Gefühl der Geringschätzung und Feindseligkeit zur russischen Sprache und Kultur unterdrücken lernen. Wir müßten einen heroischen Anlauf nehmen und mit Mut und Aufrichtigkeit unsere eigenen Reihen säubern und uns zu einer höheren Stellung hinaufschwingen. Ob wir die Führer haben werden? Davon hängt unsere Zukunft ab.
Die Mennoniten in Preußen: Staat, Obrigkeit und Politik
Gerhard Ratzlaff
Einleitung:
Um die Mitte des 16. Jahrhunderts begann die Einwanderung der Mennoniten aus den Niederlanden nach Preußen. Bis zur Auswanderung der Mennoniten von Preußen nach Rußland um die Wende des 18. Jahrhunderts verflossen 250 Jahre. Für die Mennoniten in Paraguay ist es wichtig zu erfahren, was in dieser Zeit mit den Mennoniten vor sich ging und welche Kräfte sie in dieser Zeit geformt haben. Das was wir als Mennoniten heute sind, baut auf den Grundlagen auf, die von den Mennoniten in Preußen gelegt wurden: kirchlich, sozial, kulturell, wirtschaftlich und politisch. Im Kontext des Themas unserer Konferenz beschränken wir uns weitgehend auf die Beziehungen der Mennoniten zu ihrer Umwelt und der daraus resultierenden Entwicklung einer eigenen Verwaltung. Um diesen Prozeß zu verstehen ist es notwendig, dass wir uns zunächst die komplexe geopolitische Lage vergegenwärtigen, in die die Mennoniten Preußens hineinversetzt wurden.
1. Das komplexe geopolitische Umfeld Preußens
Wenn über die Mennoniten Preußens berichtet wird, macht man immer auch den Unterschied zwischen Ost- und Westpreußen.(2) Aber das ist nicht alles, es kommen noch mehr geographische und politische Einheiten dazu: Polen und die freien Städte Danzig und Elbing. Als um die Mitte des 16. Jahrhunderts die ersten Täufer nach Preußen auswanderten, kamen sie in ein deutsches Kulturumfeld, das unter polnischer Oberhoheit stand. Der deutsche Einfluß in Preußen begann mit dem Deutschen Ritterorden, der 1190 im heiligen Lande von deutschen Kaufleuten gegründet wurde, um Kranke zu pflegen und erst später ein Ritterorden wurde, um die Heiden zu evangelisieren. Vom Papst erhielt der „Deutsche Orden“ den Auftrag, die „Pruzzen“ nördlich von Polen zum Christentum zu bekehren. Das gelang nach langen, schweren Kämpfen. Unter der Führung des Deutschen Ordens und der Unterstützung der Hanse begann die Besiedlung des Weichsel-Nogat-Deltas mit deutschen Bauern. So entstanden die ersten Deiche zur Entwässerung der tiefer gelegenen Landschaften. Auf dieser Grundlage haben die Mennoniten später weiter gebaut. Allmählich fand eine Verschmelzung der Bürger des Landes statt und der Name Preußen (statt Pruzzen) ging auf alle Landesbewohner über. In großen Teilen Preußens entwickelte sich eine deutsche Kultur mit slawischem Einschlag. Seine Glanzperiode erlebte der Deutsche Orden während der Jahre 1351-1388. Doch in den folgenden Kämpfen mit Polen wurde das einst blühende Land verwüstet. Der Adel Preußens und die deutschen Städte Danzig, Elbing und Thorn kämpften siegreich auf Seiten des polnischen Königs gegen den Deutschen Orden. Im Zweiten Thorner Frieden 1466 kam Pommerellen, das spätere Westpreußen, unter polnische Oberhoheit, so auch die Städte Danzig, Elbing, Thorn und Kulm. Für ihre Unterstützung im Kriege erhielten vor allem die Städte Danzig und Elbing riesige Landgebiete zugeteilt, zwar immer noch unter polnischer Oberhoheit, sonst aber weitgehend selbständig. Ostpreußen blieb unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, wurde aber dem polnischen Könige lehnspflichtig (Preußen königlich-polnischen-Anteils). Albrecht, Sohn des Markgrafen Friedrich von Brandenburg-Ansbach, war seit 1510 der Hochmeister des Deutschen Ordens in Ostpreußen. Als er sich der Reformation Luthers anschloß, verließ er den Orden und die katholische Kirche und machte auf Anraten Martin Luthers Ostpreußen 1525 zu einem Herzogtum mit Albrecht als erstem Herzog. Damit begann die „Erbverbrüderung“ Preußens mit Brandenburg und die beiden Staaten – geographisch voneinander getrennt – wuchsen im Laufe der Jahre zu einer politischen Einheit zusammen und wurden unter Friedrich II. zum mächtigsten Land innerhalb des deutschen Reiches. Während Preußen (Ostpreußen) seinen Machtbereich im 17. und 18. Jahrhundert langsam aber ständig ausdehnte, verlor Polen immer mehr an Macht und Einfluß. So ohnmächtig war der König von Polen geworden, dass seine Nachbarn Rußland, Österreich und Preußen Polen unter sich aufteilten. Das geschah in drei Teilungen: 1772, 1793 und 1795. Bis 1772 unterstanden die meisten Mennoniten der polnischen Herrschaft. Doch mit der Teilung Polens kamen sie unter die Herrschaft der preußischen Könige. Friedrich II. (der Große) nannte sich ab 1772 nicht mehr König in Preußen, sondern König von Preußen.
Zusammenfassung: Als die Mennoniten im 16. Jahrhundert in Preußen einwanderten, kamen sie in ein deutsches Kulturumfeld unter polnischer Oberhoheit. Danzig und Elbing sowie Ostpreußen waren deutsch und zugleich evangelisch. Doch in den Landgebieten gab es Flecken mit katholischen Besitzern. Die Städte, der Adel und die größeren Landbesitzer erfreuten sich weitgehender Rechte und Freiheiten dem polnischen König gegenüber. Aus dem Widerstreit der Evangelischen und Katholischen zogen die Mennoniten manchmal einen Nutzen. Wurden sie z.B. aus einem evangelischen Landstrich vertrieben, so nahm sie der katholische Nachbar freudig in seinem Gebiet auf – zum Ärger der Evangelischen. Aus Ostpreußen, das ganz lutherisch war, wurden die Täufer auf Anraten Luthers zunächst ausgewiesen. Dort sind sie erst später eingewandert, doch in relativ kleiner Zahl. Die Mennoniten, die nach Rußland auswanderten, kamen in der Mehrheit aus Danzig, seinem Umfeld, aus Westpreußen und dem oberen Weichseltal.
2. Die Einwanderung der Mennoniten nach Preußen
Es ist heute nicht festzustellen, wann die ersten Täufer nach polnisch Preußen und Ostpreußen gekommen sind, schreibt B.H. Unruh(3). Sie kümmerten sich mehr ums Überleben und ihre Religion als um ihre Geschichte. Außerdem waren die ersten Täufer keine gelehrten Leute, sondern Handwerker und Bauern, die wenig ans Schreiben dachten. Nach Horst Penner vollzog sich die Einwanderung über eine Zeitspanne von über 100 Jahren, und er nennt dabei drei größere „Flüchtlingswellen“(4). Die erste kam nach der münsterschen Katastrophe (1534-1535), als die Verfolgungswut auch die stillen Taufgesinnten ganz zu Unrecht aus dem Lande peitschte. Ihr folgte eine zweite, als Herzog Albas Blutregiment (1567-1594) die Taufgesinnten auch aus den friesischen Provinzen der Niederlande ausrotten wollte(5). Die dritte Welle – eine kleinere – kam aus Mähren, als die katholische Gegenreformation dort alle Evangelischen vertrieb (ab etwa 1600). Diese Täufer kamen ursprünglich aus der Schweiz, Süddeutschland und Österreich und siedelten im Weichseldelta zwischen Thorn und Marienwerder.
Hier steigt die Frage auf, warum wurde gerade Preußen das bevorzugte Einwanderungsland für die Täufer aus den Niederlanden? Dazu muß folgendes gesagt werden: Zwischen den Niederlanden und Preußen bestanden im 16. Jahrhundert rege Handelsbeziehungen. Beide Länder brauchten einander und profitierten voneinander. Die Beziehungen waren daher durchaus freundschaftlich. Die Niederländer brauchten das Getreide und Holz aus Preußen und Polen. Dagegen lieferten die Niederländer ihr hochwertiges Leinen und Tuch. Zur Förderung des Handels ließen sich niederländische Kaufleute und Handwerker in Danzig nieder und errichteten dort eine Bank. Niederländer waren in preußischen Städten gern gesehen, da sie zur Förderung der Wirtschaft Preußens einen wertvollen Beitrag leisteten. Ja, es entstanden sogar „niederländische Siedlungen“ in Danzig, dem wichtigsten Seehafen Preußens. Großes Interesse zeigte Preußen auch an holländischen Bauern, da diese sich in der Kunst der Entwässerung tief gelegener und überschwemmter Gebiete auskannten. Im Zuge dieser Handelsbeziehungen wurde Danzig im Laufe der Zeit zum wichtigsten Eingangstor der Täufer. Nach 1534, schreibt Horst Penner, brachte fast jedes Schiff Täufer aus den Niederlanden an die „Gestade Preußens“(6). Da es unter den hunderten Schiffern auch zahlreiche Täufer gab, so ist anzunehmen, dass gerade diese die Auswanderung von Täufern möglich gemacht und gefördert haben. Und das Mennonitische Lexikon(7) sagt: „Da der Schiffs- und Handelsverkehr zwischen Danzig und den Niederlanden schon im 14. und 15. Jahrhundert lebhaft gewesen war, so war es kein Weg ins Unbekannte, den die flüchtigen holländischen Mennoniten eingeschlagen hatten“. Unter den Einwanderern befanden sich Handwerker und verschiedene Fachleute: Weber, Bortenwirker, Spinner, Stein- und Bildhauer, Maurer, Zimmerleute, Fischer, Brandweinbrenner, Schiffsbauer, Ärzte und Kaufleute. Diese ließen sich mit Vorliebe in Städten wie Danzig, Elbing und Königsberg nieder. Doch obwohl Niederländer in Preußen gerne gesehen waren, galt dieses Vorrecht nicht für niederländische Täufer.(8) Die Täufer kamen jedoch um zu bleiben, und ihr geschäftlicher Erfolg erzeugte bald den Neid der städtischen Zünfte. Klagen gegen die Täufer wurden von den Zünften bei der Obrigkeit immer wieder eingereicht. Besonders viele Beispiele liefert die Stadt Danzig.(9) Sie wurden mehrmals aus der Stadt vertrieben und mußten sich außerhalb der Stadt niederlassen. Bald verschob sich damit das Schwergewicht der Einwanderer auf die versumpften Weichselniederungen (auch Kampen genannt), die vielfach unter dem Meeresspiegel lagen. Doch ein kleinerer Teil blieb in den Städten bzw. wanderte zurück in die Städte und wußte sich dort unter großen Widerwärtigkeiten auch gegen den Neid der Zünfte, die den Täufern gern „das Handwerk legten“, durchzusetzen. Auf dem Lande dagegen überzeugten sich die Landesherren nicht nur von der Harmlosigkeit der Täufer, sondern von ihrer großen Nützlichkeit für die Urbarmachung ihres Landes, da sie als treue Steuerzahler ihren Herrn ein gutes Geld einbrachten. Einige Adlige förderten geradezu die Einwanderung der Täufer, indem sie Personen beauftragten, in die Niederlande zu gehen und dort um Siedler zu werben. Dies geschah trotz wiederholter Einsprüche von Seiten der städtischen Räte und der herrschenden Landeskirchen. Dieser ständige Einspruch von Seiten eines Teiles der Bürgerschaft brachte die Täufer in die mißliche Lage, dass sie über Generationen in ständiger Unsicherheit lebten und ihre Bleibe in Preußen oft teuer bezahlen mußten. Auch die scheinbar typisch mennonitische Eigenschaft, Vorrechte durch Geld zu erwerben,(10) bildete sich dadurch schon in Preußen heraus. Nach Preußen brachten die Täufer aus den Niederlanden ihre in jahrhundertelangem Kampf mit dem Meere ausgebildete Kunst im Bau von Windmühlen zur Entwässerung, Deichen, Gräben und Schleusen. Das Land wurde ihnen jedoch nicht als Eigentum, sondern in Besitzpacht und nach einigen Generationen später in Erbpacht gegeben. Das heißt, sie durften das Land vererben, aber nicht verkaufen. Dieses Recht stand nur dem Landesherrn zu. Erst Jahrhunderte später, als sie als Bürger des Landes akzeptiert wurden (unter Friedrich dem Großen), konnten sie das von ihnen bewohnte Land als Eigentum erwerben. Von ihrer großen Nützlichkeit überzeugt, warb der Danziger Rat um mehr Siedler aus den Niederlanden, und schon bald entstand eine Anzahl Ortschaften unter dem Titel „Holländische Dörfer“.(11) Der Name „Mennonit“ kommt zum ersten Mal 1572 in einem Dekret des Elbinger Rates vor und am 6. Juli 1573 in einem Beschluß des Danziger Rates.(12) Ab 1573 wird der Name „Mennonit“ in Danzig gebräuchlich.(13) Die Schreibweise war jedoch sehr unterschiedlich: meist Mennonist oder Mennist. Im Laufe eines Jahrhunderts dehnten sich die mennonitischen Bauernsiedlungen von Danzig und dem kleinen Werder auf das große und das Marienburger Werder und weiter das Weichseltal hinauf nach Graudenz, Schwetz, Kulm und Thorn aus.
3. Das „mennonitische Reich“ in Preußen
Im Laufe der Generationen bildeten die Mennoniten in Preußen ein eigenes „mennonitisches Reich“. Dieter Götz Lichdi(14) schreibt von einer ,mennonitischen Welt’, die in der Weichselniederung wuchs, abgesondert von der sie umgebenden Welt, mit der sie möglichst wenig gemeinsam haben wollten. Wie konnte dies geschehen? Und wie gestaltete sich diese typisch mennonitische Welt innerhalb einer ihr feindselig gegenüberstehenden Umwelt? Den Gang dieser Geschichte wollen wir hier kurz skizzieren. Es fand eine täuferisch-mennonitische Metamorphose statt: Die Umwandlung von einer Gemeinde von Gläubigen in eine mennonitische Kulturgemeinschaft. Eine Umwandlung, die zwar nicht von den Täufern/Mennoniten gesucht und geplant, sondern von religiösen und historischen Kräften geformt wurde. Folgende Faktoren spielten dabei eine entscheidende Rolle: das Glaubensprinzip der Absonderung von der Welt einerseits und die Verfolgung der Täufer/Mennoniten andererseits. Wie sah diese mennonitische Welt konkret aus? Worin bestand sie?
3.1. Die Absonderung
Zu den grundlegenden Prinzipien der Täufer gehörte die Absonderung von der Welt. Dieses Prinzip gründete auf Leben und Lehre Jesu und der apostolischen Gemeinde. So heißt es in Römer 12, 2: „Stellet euch nicht dieser Welt gleich“. Grundsätzlich bedeutet diese Aussage, sich vom sündigen Treiben fernzuhalten. Für die Täufer bedeutete dieses Prinzip ganz konkret, nicht an weltlichen Belustigungen wie Theater und Zirkus, Tanzabenden und Weingelagen teilzuhaben, kein gemeinsames Geschäft mit „Weltlichen“, d. h. Nicht-Täufern zu unternehmen. Ja, es ging so weit, dass auch die Teilnahme an katholischen, lutherischen und reformierten Gottesdiensten verboten war. In der Gemeindedisziplin, in der Ablehnung des Eides und Wehrdienstes fand das Prinzip der Absonderung von der Welt einen sehr prägnanten Charakter. Die Täufer waren also seit ihrer Entstehung eine ganz neue und zugleich ganz anders geartete Gemeinde in dieser Welt. In dem sogenannten „Wildwuchs“ der Täufergemeinden kam es auch zu manchen Entgleisungen. Die bekannteste davon ist das „Münstersche Täuferreich“. Leider wurde den Täufern die ganze Schuld für die münstersche Katastrophe in die Schuhe geschoben. Menno Simons hat sich heftig dagegen gewehrt. Anderseits wurde auch die weltliche Obrigkeit auf die Unterschiede unter den Täufern aufmerksam. Die Friedlichen unter ihnen, die sich um Menno Simons scharten, wurden so bald als Mennonisten (ab 1543/1544 Mennonisten oder Mennisten) bezeichnet. Unter diesem Namen wurde den Täufern größerer Schutz gegen Verfolgung zuteil. Aus diesem Grunde haben die norddeutschen und die preußischen Täufer den Namen Mennonit übernommen. Als um die Mitte des 16. Jahrhunderts die Täufer nach Preußen einwanderten, standen sie immer noch im Schatten der Ereignisse von Münster. Die Verfolgung der Täufer, die nach Münster verstärkt einsetzte, war ja auch der Anlaß für die erste große Flüchtlingswelle nach Preußen. Dort sah man Holländer und Niederdeutsche als Einwanderer gern, solange sie nicht Täufer waren. Ja, der Rat der Stadt schrieb an die Niederlande, man möchte es dort nicht erlauben, dass Täufer die Schiffe, die nach Preußen gingen, bestiegen. Doch bald merkten die preußischen Gutsbesitzer, die große verwüstete Ländereien besaßen, dass die Besiedlung ihres Landes durch Täufer eine gewinnbringende Kapitalanlage war, nicht nur für sie, sondern auch für den polnischen König. Nur unter solchen Bedingungen wurden die Täufer (später Mennoniten) geduldet, sie erhielten aber nicht die bürgerliche Gleichberechtigung. Danzig bietet dafür ein anschauliches, wenn auch extremes Beispiel: Selbst nach mehr als 250 Jahren in Danzig und Umgebung wurde den Mennoniten nicht das Bürgerrecht zugestanden und sie mußten als „Unbürger“ Schutz- und Fremdensteuer zahlen. Als Georg von Trappe im Auftrage von Katharina II., Zarin von Rußland, nach Danzig (nicht Preußen) kam, stellte er den Mennoniten diese unfreie Stellung und schreiende Ungerechtigkeit vor und versprach ihnen eigenes Land, Sonderrechte und Privilegien.(15) Doch nun zurück zum Beginn der Täufer in Preußen. Wie gesagt, die Mennoniten in Danzig und polnisch Preußen wurden nur geduldet, erhielten für lange Zeit nicht die bürgerlichen Rechte und waren allerlei Schikanen von Seiten der Obrigkeit, aber auch von Seiten der zwei offiziellen Kirchen, Lutheraner und Katholiken, ausgesetzt. Hier einige Beispiele der Beschränkungen und Schikanen, denen sie ausgesetzt waren: In den ersten Jahrzehnten war es ihnen nicht erlaubt, Kirchen zu bauen. Ihre gottesdienstlichen Veranstaltungen mußten in Privathäusern abgehalten werden. Es war nicht erlaubt, Katholiken und Lutheraner in mennonitische Gemeinden aufzunehmen. Das zu tun kam einem Verbrechen gleich. Trotzdem mußten die Mennoniten die Kirchensteuer für die offiziellen Kirchen zahlen: Bei der Geburt eines Kindes, beim Tode einer Person, für Trauungen und Schule und anderes mehr. So mußten die Mennoniten für Dienstleistungen zahlen, die sie nicht in Anspruch nahmen. Dagegen haben sich die Mennoniten stark gewehrt, doch meist ohne Erfolg, weil der Staat diese Maßnahmen der Kirchen unterstützte und weil die Mennoniten als gefährliche Konkurrenten angesehen wurden. Während sich nun die Umwelt von den Mennoniten als geduldete Sektierer absetzte, schufen die Mennoniten ihrerseits einen Wall gegen den schädlichen Einfluß der sie umgebenden Welt aufgrund ihres Prinzips der Absonderung von der Welt. Die Welt um sie war sündhaft und ungerecht, vor ihrem Einfluß wollte man sich und die Kinder schützen. Deshalb wurde der Kontakt mit der Außenwelt auf ein Minimum reduziert und nur für wirtschaftliche Interessen erlaubt. Diese Lebenshaltung kommt noch heute bei den mexikanischen Mennoniten in Paraguay zum Ausdruck. Ein wirksamer Schutz gegen das Eindringen der Welt in die Gemeinde war das Verbot der „Außentrau“, d.h. Heiraten außerhalb der eigenen Gemeinde war verboten. Selbst die Heirat zwischen den zwei Gemeinderichtungen, den Flamen und Friesen, war verboten. Die straffe Gemeindedisziplin war ein weiteres wirksames Mittel, um die Welt von der Gemeinde fernzuhalten. Als Resultat dieses Schutzes gegenüber der bösen Umwelt schufen die Mennoniten ihre eigene Welt – eine mennonitische Welt, wie sie Lichdi nennt. Als Gemeinden schufen sie ein eigenes Sozial- und Verwaltungssystem und eine Brandversicherung auf Gegenseitigkeit. Sie hatten ihre eigene Gemeindeschule und ein Waisenamt zur Versorgung der Witwen, Waisen und der Armen. Alles Funktionen, die in der Regel der Staat oder eine sekulare Institution übernimmt. Ja auch die Bauart ihrer Häuser unterschied sich bei den Mennoniten von der üblichen deutschen Bauart und mehr noch von der polnischen. So entstand in der Weichselniederung eine mennonitische Welt. Die Mennoniten waren zu einem tief religiösen Volk inmitten der deutschen und polnischen Bevölkerung Preußens und Polens geworden. Es erfolgte eine mennonitische Metamorphose, die in Rußland unter idealen Bedingungen weitergeführt und perfektioniert wurde. Dabei muß klärend gesagt werden, dass die Mennoniten in Preußen nicht in sich abgeschlossenen Territorien (wie später in Rußland und heute noch in Paraguay) lebten, sondern inmitten der entweder deutschen oder polnischen Landesbevölkerung. Die Umwandlung geschah innerhalb der Gemeinde, war eine von der Welt teilweise aufgezwungene und geschah im Einklang mit ihren Glaubensprinzipien, dem der Absonderung von der Welt und der Wehrlosigkeit.
3.2. Die Mennoniten unter polnischer Herrschaft
Als die Mennoniten in Preußen einwanderten, fanden sie in dem der polnischen Krone unterstehenden Lande „wenig Staat“ vor, bemerkt mit Recht Horst Penner.(16) Das heißt, die Mennoniten erhielten vom Staat keine Hilfe, sie waren auf sich selber angewiesen und mußten sich mit eigenen Mitteln durchschlagen. Dieser Umstand führte dazu, dass sie gezwungen waren, ihre eigenen Institutionen und Organisationen zu schaffen, um zu überleben. Das hat im Rückblick gesehen überraschend gut geklappt. Als Katholiken waren die polnischen Könige den Mennoniten durchaus nicht immer wohl gesonnen. Wenn die polnischen Könige nun doch immer wieder durch besondere Erlasse (Privilegien) die Mennoniten schützten, so hat das eine besondere Bewandtnis. Die polnischen Könige brauchten Geld, viel Geld. Aus den Weichselwerdern kam das meiste Geld, um ihre Kassen zu füllen, und in den Werdern wohnten 75% der westpreußischen Mennoniten. Und das waren die „Bauern, die das Mehrfache von dem erwirtschafteten, was sonst landesüblich war“, führt H. Penner aus.(17) „Um des lieben Geldes willen“ also waren die polnischen Könige immer wieder bemüht, „durch Wiederherstellung der Privilegien und das Anstimmen eines Lobliedes auf die trefflichen Entwässerungskünstler“ die Mennoniten im Lande zu behalten.(18) Dazu die folgenden Beispiele: 1642 war Wladislaus IV. König von Polen. Er wußte über die Situation der Mennoniten nicht Bescheid. Diese Unkenntnis nutzte sein Kammerherr Willibald von Haxberg aus, um durch Erpressung von den Mennoniten Geld zu bekommen. Dazu hatte er von dem König ein Schreiben erwirkt, das ihm die gesetzliche Grundlage zu scharfen Maßnahmen gegen die Mennoniten gab. Haxberg begründete und rechtfertigte seine grausamen Absichten folgendermaßen: „Da die Sekte der Wiedertäufer, bisweilen Ministen genannt, im Lande heftig einschleichen und ohne Bewilligung seinen Untertanen große Verhinderungen im Handel zugefügt werden, so sollen … die Güter der Ministen dem Fiskus zugeeignet werden“.(19) Die Mennoniten weigerten sich zunächst, die erpreßten Zahlungen an Haxberg zu tätigen. Daraufhin ließ dieser die mennonitischen Güter mit Militär besetzen. Auf diese Weise gelang es dem geldhungrigen und skrupellosen Haxberg, von den wehrlosen Mennoniten die Riesensumme von 80 000 Gulden gewalttätig zu erpressen. In ihrer Not wandten sich die Mennoniten an die lokale Obrigkeit („Landstände“). Ein Landtag wurde im Mai 1642 nach Marienburg einberufen. Die „Landstände“ fanden das Vorgehen des königlichen Kammerherrn ungeheuerlich, richteten einen Protest an den König, in dem sie baten, „Seine Majestät möge geruhen, diese unrechtmäßigen Eintreibungen ernstlich zu hindern“.(20) Mit Unterstützung der preußischen Stände (des Adels und der Landesherrn) schickten die Mennoniten eine Delegation an den König. Persönlich wurden sie bei ihm vorstellig, wohl zum ersten Mal, und erklärten ihre Lage, ihre Kontrakte und Rechte, gemäß denen sie eingewandert waren. Als sie dem König dann noch eine Summe Geldes überreichten, schenkte dieser den Mennoniten ein geneigtes Ohr. Dem Treiben Haxbergs wurde Einhalt geboten und am 22. Dezember 1642 erließ der König, „von Gottes Gnaden“ berufen, ein Gesetz, das die Rechte der Mennoniten in Preußen „zu ewigen Zeiten“ sichern sollte. In dem Schreiben hebt der König hervor, dass die Mennoniten von seinen Vorfahren, den polnischen Königen, ins Land gerufen wurden. Dabei nennt er namentlich seinen Großvater, den „weiland Durchlauchtigsten Sigismundi Augusti“. Weiter schreibt König Wladislaus IV., dass die Mennoniten „damals an wüste, sumpfige und unbrauchbare Örter“ kamen „und … selbige durch viel Arbeit und große Unkosten … nutzbar und fruchtbar gemacht [haben]“.(21) Der König bestätigt auch die „Darreichung einer gewissen Summe Geldes zu unserem Gebrauch“, stellt demgegenüber jedoch klar, dass der königliche Erlaß auf dem „Exempel sonderbaren Fleißes“ und der „großen Arbeit“ der Mennoniten „zum gemeinen Nutzen“ gegründet ist und nicht auf Grund der Geldzahlung geschah.(22) Die Urkunde, die die Mennoniten dem König vorgelegt haben, ist eine gründliche, dokumentarische Beweisführung ihrer Geschichte. Es ist aber auch durchaus möglich, dass der König sich zusätzlich aus dem königlichen Archiv Unterlagen hat geben lassen. Doch die vom König Wladislaus IV. gegebenen Rechte „zu ewigen Zeiten“ dauerten nur wenige Jahre. Regierungen kommen und gehen. Schon im Jahre 1660 drohte ein neues Unheil über die Mennoniten in Preußen hereinzubrechen. Eine neue Sekte, die „Sozinianer“, auch „Polnische Brüder“ genannt, war nach Polen gekommen. Verallgemeinernd wurden sie „Arianer“ genannt, weil sie den Artikel von der Dreieinigkeit Gottes nicht in ihrem Glaubensbekenntnis führten und als Ketzer erfolgreicher zu bekämpfen waren. Nun traten die „Wahrer reiner christlicher Lehre“, wie H. Penner die Verfolger nennt,(23) auf den Plan und erreichten beim König die Ausweisung der Sozinianer aus dem Lande. Danach fuhren die „Verteidiger der rechten christlichen Lehre“ auch über die Mennoniten her, indem sie den königlichen Erlaß gegen die Sozinianer nun auch auf die Mennoniten anwandten. „Übereifrige“ Beamte konfiszierten die Güter der Mennoniten, um mühelos ihre leeren Geldtruhen füllen zu können, schreibt H. Penner.(24) Doch der eigene Vorteil bewog den polnischen König Johann Casimir, diesem Verfahren Einhalt zu gebieten. So kam der folgende sehr aufschlußreiche Schutzbrief für die Mennoniten im Jahre 1668 zustande: „Beständig geschieht es, dass eine unbillige und unzeitige Auslegung der Gesetze sehr viele Leute dazu antreibt, einen leichtsinnigen Angriff auf die Rechte und Güter anderer und die Sicherheit der öffentlichen Ruhe zu machen und Unschuldige in große Streithändel zu verwickeln. Da wir nun den bedrohlichen Verlusten zuvorkommen wollen, welche wir durch dergleichen Unfug von Privatleuten gar leicht an unseren Gütern in der Ökonomie Tiegenhof und Bärwalde und an unseren Einkünften zu erleiden haben würden, welche vorzüglich in den Besitzungen der Untertanen mennonitischen Glaubens bestehen, und da wir auch den Wunsch hegen, das verwegene Unterfangen der ungestümen Leute zu verhindern, welche etwa unter dem Vorwande des Eifers für das Gemeinwohl mit Anführung einer Novelle zu den alten Gesetzen über die Arianer jene Mänisten [Mennoniten] beunruhigen, dadurch Gelegenheit zu äußerster Entvölkerung geben, und unseren Einkünften eine nicht geringe Einbuße und Verkürzung bereiten möchten. Um also derlei Nachteilen und Unzuträglichkeiten entgegenzutreten und für Unsere und Unserer genannten Untertanen in Tiegenhof Schadlosigkeit Fürsorge zu treffen, haben wir gemeint, ebendieselben in unsere Protektion und unseren königlichen Schutz aufnehmen zu müssen…“(25)
Deutlich spricht der König in seinem Schreiben von einer „unbilligen und unzeitigen Auslegung der Gesetze“ gegen die Sozinianer und dem „Unfug von Privatleuten“, die mit ihrem Vorgehen gegen die Mennoniten zu „bedrohlichen Verlusten … an unseren Einkünften“ führen würden. Doch auch König Casimirs Jahre waren gezählt. Der neue König Johann III. wußte nichts von den Mennoniten und noch weniger von den Gesetzen, die zu ihrem Schutz erlassen worden waren. Diese Wissenslücke nutzten wiederum Gegner der Mennoniten aus. 1676 trat der „Woywode“ (polnisch für Landherr, Heeresführer) von Pommerellen, dem späteren Westpreußen, für die Vertreibung der Mennoniten aus den Werdern und Danzig ein. Danzig bezeichnete er „als das rechte Nest“ dieser Sekte, derentwegen Gott Polen so hart strafe und Naturkatastrophen zulasse. Einen Teil des polnischen Adels hatte der Woywode für seine Pläne gewonnen. Doch da traten die Landesherren und die Räte der größeren Städte für die Mennoniten ein und machten dem König klar, welchen Schaden das Land „von der Vertreibung der Mennoniten haben würde. Dagegen hoffe der Woywode als Landschatzmeister durch Einziehung ihrer Güter persönlichen Vorteil zu gewinnen“.(26) König Johann III. ließ sich überzeugen und befahl, den schon gegen die Mennoniten ausgefertigten Erlaß zu zerreißen und versicherte ihnen durch eine Verfügung alle ihnen bisher gegebenen Rechte. Ja, noch mehr, er forderte die Landesherren auf, „weitere Ländereien an Mennoniten zur Kultivierung auszugeben“.(27) Die Mennoniten sahen in dieser Wende das Eingreifen Gottes, der den Rat der Gottlosen zunichte macht.
3.3. Die Mennoniten unter preußischer Herrschaft
Bei der ersten Teilung Polens 1772 fiel Westpreußen an Friedrich den Großen. Der Regierungswechsel wurde von den Mennoniten begrüßt. Ihre rechtliche und wirtschaftliche Existenz schien unter Friedrich dem Großen gesicherter zu sein als unter dem polnischen König. Aber eine neue Sorge kam jetzt hinzu. Zur polnischen Zeit hatten die Mennoniten den Grundsatz der Wehrlosigkeit problemlos aufrecht erhalten können. Sie waren zwar „bürgerlichen Beschränkungen“ ausgesetzt, wobei aber „lange Zeit die Nichtableistung der Wehrpflicht gar nicht in Betracht kam, weil dieselbe überhaupt nicht allgemein war“.(28) Außerdem, als „Unbürger“ kamen sie für den Wehrdienst auch nicht in Frage. Zur polnischen Zeit war das Verhältnis der Mennoniten zum Staat das einer geduldeten Religionsgemeinschaft, deren Stellung durch königliche Privilegien, aber nicht durch staatliche Gesetze gesichert war. Die Lage änderte sich unter den preußischen Königen. Unter Friedrich dem Großen herrschte Religionsfreiheit in Preußen. Zum Schutze der katholischen Schulen gegen Übergriffe von Seiten der Evangelischen schrieb Friedrich kurz nach seinem Regierungsantritt am 22. Juli 1740 in einem fehlerhaften Deutsch (Er sprach und schrieb lieber französisch). Hier zwei Zitate in wortgetreuer Abschrift:
„Die Religionen müssen alle toleriret werden und muß der Fiscal nuhr das Auge darauf haben, dass keine der anderen Abruch tuhe, den hier muß ein jeder nach seiner Fasson [Religion] selich werden“.(29)
Auf die Frage, ob in Frankfurt a.O. ein Katholik das Bürgerrecht erwerben dürfe, antwortete Friedrich (Juni 1740):
„Alle Religionen seindt gleich und guth, wan nuhr die leute, so sie profesiren, Ehrlige leute seindt, und wen Türken und Heihden kämen und wollten das Land pöpliren [besiedeln], so wollen wir sie Mosqueen und Kirchen bauen“.(30)
Von dieser großzügigen Religionsfreiheit profitierten auch die Mennoniten. Die Steuern, die die Mennoniten zum Unterhalt der lutherischen Kirchen bisher beitragen mußten, wurden aufgehoben (nach Friedrich aber wieder eingeführt) und dabei das Prinzip der Wehrlosigkeit nicht in Frage gestellt. Doch als Ausgleich mußten die Mennoniten zum Aufbau und Unterhalt der Kadettenschulen in Kulm (Culm) seit 1773 einen jährlichen Beitrag von 5000 Talern zahlen. Das scheint keine große Belastung für die Mennoniten gewesen zu sein. Sie haben nicht dagegen protestiert. Am 29. März 1780 erschien, nach endlosen Verhandlungen, das vom König unterschriebene „Gnadenprivileg“, welches bereits 1772 auf dem großen Begrüßungsfest in Marienburg von den Mennoniten beantragt und ihnen vom König mündlich zugesagt worden war. Dieses Gesetz verbürgte den Mennoniten Befreiung vom Militärdienst, volle Glaubens- und Gewerbefreiheit auf ewige Zeiten bzw. „so lange sie und ihre Nachkommen sich als getreue, gehorsame und fleißige Unterthanen verhalten,… [ihre] Abgaben prompt entrichten, sich den allgemeinen Landespflichten, … nicht entziehn, die bisherigen 5000 Thlr. Enrollierungsfreiheit [Militärdienstbefreiung] jährlich … an die angewiesene Kasse prompt abführen, …“.(31) Doch das neue Gesetz enthielt eine Einschränkung für die Mennoniten. Der Erwerb neuer Grundstücke durch Mennoniten wurde begrenzt, da nach preußischem Gesetz der Militärdienst an den Landbesitz gekoppelt war (Kantonspflicht) und Preußen ein Militärstaat war. Mehr Land in Händen der Mennoniten bedeutete weniger Soldaten für den König. Trotzdem verfuhr Friedrich mit den Mennoniten sehr großzügig und bewilligte ihnen fast ausnahmslos alle von ihnen beantragten Landankäufe. In den Jahren 1781-84 konnten 296 neue Grundstücke von den Mennoniten erworben werden.(32) Das wurde unter Friedrichs Nachfolger Friedrich Wilhelm II. anders. Die lutherischen Kirchen waren um den Fortbestand ihrer Gemeinden besorgt, die Militärbehörden um die notwendige Zahl ihrer Rekruten. Dem neuen König wurden daher Vorstellungen gemacht, dass eine weitere Ausdehnung der Mennoniten nicht zugelassen werden dürfe. Deshalb erließ Friedrich Wilhelm II. 1789 ein besonderes Gesetz, das „Edikt, die künftige Einrichtung der Mennoniten“ betreffend. Darin wird der Landerwerb der Mennoniten stark eingeschränkt und die Beitragspflicht der mennonitischen Grundbesitzer für die evangelischen Kirchen gesetzlich festgesetzt. Begründet wurde die evangelische Forderung u. a. auch hier wieder mit dem Hinweis, dass aller mennonitischer Besitz aus evangelischer Hand stamme. Mannhardt weist auch darauf hin, dass in manchen Fällen die Mennoniten auf „Privatcontracte“ eingingen, in denen sie sich verpflichteten, die Abgaben an die lutherischen Pfarrer zu zahlen. Diese Einzelfälle wurden verallgemeinert und gaben Anlaß zu vielen Streitigkeiten.(33) Die Mennoniten führten endlose Prozesse gegen die Zahlungspflicht. Diese wurden aber fast ausnahmslos gegen sie entschieden. Das Edikt von 1789 wurde 1801 noch verschärft. Keine „neuen Acquisitiones von Grundstücken“ wurden den Mennoniten erlaubt, wodurch eine Verminderung des damaligen mennonitischen Grundbesitzes erreicht werden sollte.(34) Diese Einschränkung war der Anlaß zur zweiten großen Auswanderungswelle nämlich nach Rußland, an die Molotschna. Die zurückbleibenden Mennoniten haben sich trotz starken Widerstandes nach und nach in die preußische Gesellschaft integriert. Unter großen Opfern konnten die Mennoniten die Wehrdienstbefreiung noch aufrechterhalten, bis am 9. November 1867 durch ein neues Gesetz die bisherige Befreiung aufgehoben wurde. Eine „Kabinettsorder“ vom 3. März 1868 milderte das Gesetz insofern, dass die Mennoniten ihrer Wehrpflicht als Krankenpfleger, Schreiber und Trainfahrer genügen durften. Damit wurden aber auch alle Beschränkungen gegen die Mennoniten aufgehoben. Mennoniten, die jetzt nicht auswanderten (einige wanderten in die USA aus), nahmen nun auch die Wehrpflicht an, zunächst in Form eines Alternativdienstes, dann aber auch im aktiven Wehrdienst. Die Entscheidung war jedem einzelnen Glied überlassen.
3. 4. Danzig
Liest man das Buch von Mannhardt über die Danziger Mennonitengemeinde (1919), so bekommt man den Eindruck, dass die Hauptaufgabe der Gemeinde bzw. der Gemeindeältesten darin bestand, sich gegen Anfeindungen von außen zu wehren. In der Stadt Danzig erlangten die Mennoniten erst 1793 das Bürgerrecht. Sehr wenig wird über den inneren Bau der Gemeinde gesagt. Hier seien nur einige weitere Diskriminierungen und Angriffe angeführt: In der Stadt Danzig war es den Mennoniten verboten, Grundstücke zu erwerben. Trotzdem blieben immer noch Mennoniten ihres Handwerks wegen in der Stadt. Dabei bildete sich der unerfreuliche Brauch heraus, schreibt Mannhardt, „dass die Mennoniten beim Kauf oder bei der Vererbung von Häusern diese auf den Namen eines Bürgers schreiben ließen, dem dafür ein kleines Kapital eingetragen und verzinst wurde, …“. Weiter schreibt Mannhardt: „Der Rat und das Gericht ließen diese Praxis stillschweigend lange Zeit gelten, und es sind uns noch zahlreiche Kontrakte aus dem 17. und 18. Jahrhundert erhalten“.(35) 1647 wurden die Mennoniten beim polnischen König verleumdet, „dass sie Personen anderen Bekenntnisses zu sich herübergezogen hätten“. Der König, wenig informiert, erläßt darauf ein Dekret gegen die Mennoniten, in dem es heißt, dass „die Sekte der Wiedertäufer und Mennonisten den Seelen der Katholiken und Dissidenten höchst schädlich … ist, ja zum größten Abscheu gereicht“. Der König ordnet dann die „sofortige Landesverweisung der ganzen Sekte aus allen königlichen Landen“.(36) Der Befehl wurde nicht ausgeführt, der Schaden fürs Land wäre zu groß gewesen. Schon bald folgte ein Gnadenprivileg. Mannhardt fügt ironisch hinzu, dass es zur Zeit der polnischen Könige „weder an Ausweisungsbefehlen noch an Gnadenprivilegien gefehlt“ habe.(37) Versuche, die Mennoniten zu erpressen kamen immer wieder vor, mal mit, dann auch wieder ohne Erfolg. Im Sommer 1670 forderte der Krakauer Kanonikus (Domherr) Zebrydowsky den Danziger Rat im Namen des Königs auf, von den Mennoniten eine Donation für den König zu erheben. Der Rat lehnte ab. Doch der Rat und die Beamten ließen sich ihren Einsatz zu Gunsten der Mennoniten gut bezahlen. Diese Ausgaben wurden mit Kollekten gedeckt. Der Gemeindeälteste Georg von Hansen schreibt nach einem erledigten schweren Fall: „Da die Sache bedeutende Ausgaben verursachte, so wurde um Fastnacht 1671 eine Collekte gehalten und von den Brüdern die Summe von 2466 fl. zusammengelegt. … Weshalb wir nach gutem Ausgang der Sachen dem Rat von Danzig, aber insonderheit Gott dem Herrn zu danken haben“.(38) Nach einer anderen Gelegenheit schreibt der Gemeindeälteste Hansen: „… es kostete uns auch diesmal ein schweres Stück Geld, welches sehr hart für uns war aufzubringen, doch half Gott uns alles überwinden“.(39) Ein andres Mal heißt es auch: „Sie [die Beamten] ließen erkennen, dass sie was begehrten, zumal da ich bat sie möchten uns zu Gunsten sein, wir würden auch unsere Dankbarkeit beweisen. Zuerst stellten sie sich, als begehrten sie solches nicht, dann aber schickten sie zu Willem Dunkel und ließen vorgemeldete Dankbarkeit abholen, welche aus 210 fl. bestand“.(40) Wie aus den Aufzeichnungen von Hansen hervorgeht, hatten die Mennoniten recht oft „Dankbarkeitsgelder“ zu zahlen.(41) Damit konnten die Mennoniten dann ihr Recht gegen die Angriffe der Zünfte, der Kirchen und sogar gegen den König immer wieder einmal durchsetzen. Die Gegner der Mennoniten sahen die Dinge anders. So schreibt ein gewisser Wernick in einer Eingabe vom 26. Januar 1750 an den Rat, dass die Mennoniten nur darum „die Favoriten des Rates seien, weil sie einzelnen Mitgliedern desselben die Hände schmierten“. Die Mennoniten hätten auch die Schuld, dass es zwischen dem Rat und den Zünften zu Feindschaft komme. Weil sie nach ihren Religionsvorschriften den Eid verwerfen, können sie auch keine Bürger werden, maßen sich aber noch größere Freiheiten an als die wirklichen Bürger. Wernick fordert daher die Vertreibung der Mennoniten.(42) Dazu schreibt Mannhardt: „Dass Wernick am Hofe nichts weiter gegen die Mennoniten erreichte, mag seinen Grund darin gehabt haben, dass diese sich wieder in Holland beklagten, und dass der holländische Gesandte am polnischen Hofe sich zu ihren Gunsten verwendete“.(43) Die Mennoniten hatten sich vorher in Holland wegen der hohen Steuern beklagt, die ihnen auferlegt wurden wie den Fremden, die in Danzig Handel trieben.(44) Es ist nicht auszuschließen, dass bei allen diesen Verhandlungen öfter auch „Dankbarkeitsgelder“ an die Beamten des Rates der Stadt Danzig gezahlt wurden, eine Praxis, die auch in Paraguay nicht unbekannt ist. Trotz allem war Wernick diesmal erfolgreich in seiner Agitation gegen die Mennoniten. Unter seinem Einfluß erließ der Danziger Rat am 10. November 1749 ein Edikt, welches den Mennoniten in Danzig und seinen Vororten praktisch „das Handwerk legte“. Die Ausübung mehrerer Berufe (Branntweinschenker, Färber, Presser und Leineweber) wurde ihnen verboten. Dieses Edikt bedeutete für eine ganze Anzahl von Mennoniten den Ruin und die Nötigung zum Fortzug. Diese Beschränkungen hielten etwa zehn Jahre an und haben die Gemeinde in Danzig sehr geschwächt.(45) Im Jahre 1669 wurde in Danzig sogar die Frage aufgeworfen, ob ein „Mennonist“, weil er des Bürgerrechts seines Glaubens wegen unfähig sei, ein Schiffer sein könne. Bekanntlich gab es unter den Mennoniten viele Seeleute. Trotz der vielen Schikanen, denen die Mennoniten unterworfen wurden, haben sie sich durch Fleiß und Arbeitsamkeit und durch eine geschickte Politik über etwa 250 Jahre durchgesetzt. Als dann die Not den Höhepunkt erreicht hatte, kam der erlösende Ruf von Katharina II. nach Rußland zu kommen. Die ersten Mennoniten, die nach Rußland gingen, kamen fast ausschließlich aus Danzig.
4. Mennoniten und die Politik
Eine direkte Beteiligung an der Politik war für die Mennoniten in Polen wie in Preußen und Danzig undenkbar. Unter den Polen galten sie als geduldete „Gäste und Fremdlinge“, denen ihr Aufenthalt nur durch Privilegien möglich gemacht wurde. Unter den absoluten preußischen Königen erhielten die Mennoniten zwar als Bürger einen Rechtsstatus, aber Einmischung des kleinen Mannes bzw. des Bauern in die Politik des Landes war undenkbar. Die vorherrschende Staatsform in Europa und ganz besonders in Preußen im 17. und 18. Jahrhundert war der Absolutismus, in der der Monarch (König oder Fürst) „die unumschränkte Gewalt ausübte und den Staat in sich verkörperte“. Nach dieser Philosophie ist das Volk ignorant und weiß nicht, was gut für es ist. Es muß geführt werden. Verantwortungs- und Pflichtgefühl wurden von den Herrschern groß geschrieben. Sie waren bemüht, alles zu tun, was der Stärkung des Staates und der „Wohlfahrt“ des Volkes nützlich war. Sie herrschten absolut, ließen nur ihren Willen gelten und bevormundeten ihre Untertanen. Sie herrschten nach dem Prinzip: „Alles für das Volk, nichts durch das Volk“. Was immer geschah, geschah auf Anordnung des Fürsten (Königs). Hineinreden in seine Regierung, mitbestimmen durfte da niemand! Ebeling faßt dann die Regierungsform des Absolutismus, und als solche galt auch die aller preußischen Könige, in folgendem Merksatz zusammen: „So blieb ‘der Staat’ eine Angelegenheit, zu der ein Untertan ohne Beziehung lebte. Er gewöhnte sich daran, mehr oder weniger murrend hinzunehmen, was ‘von oben’ kam. Er blieb Befehlsempfänger ohne Interesse und eigene Verantwortung für das Ganze“.(46) Die Beteiligung der Mennoniten an der nationalen preußischen Politik war damit absolut ausgeschlossen. Die politischen Verhältnisse waren nicht dafür geschaffen. Nur auf der untersten sozialen Ebene war eine begrenzte politische Beteiligung als Deichschulze bzw. Oberschulze möglich. Dennoch bildeten die Mennoniten im preußischen Staate „etwas Besonderes“, und sie „wollten es auch sein“, führt Horst Penner aus.(47) Sie wollten nicht ein Staat im Staate sein, sondern die Aufgaben des Staates in der Gemeinde und durch die Gemeinde ausführen, d.h. den „Staat“ in die mennonitischen Gemeinden einbeziehen, wie es Calvin Redekopp treffend formuliert hat (1973 „A Staate within a Church“). Hier ein Beispiel: Als im Schwedenkrieg (1626-1630) der schwedische Reichskanzler Oxenstierna den Mennoniten des Kleinen Werders befahl, ihre Kriegsauflagen über den Deichgrafen des Werders zu zahlen, wollten sie von dem Deichgrafen keine Weisungen entgegengehen und baten, für das von ihnen kultivierte Gebiet zwei ihrer Ältesten wählen zu dürfen, die dem Deichgrafen gleichgestellt wären. Den Mennoniten wurde diese Bitte am 10. Mai 1628 gewährt. Penner faßt zusammen: „So hatten diese Ältesten … neben der Aufsicht über ihren Deichverband, über Deiche, Schleusen, Entwässerungsgräben auch weitere Selbstverwaltungsaufgaben für ihr Gebiet zu übernehmen, wie sie dem Amt des Reichsgrafen auch zustanden“.(48) Auf Wunsch der Ältesten kam somit die weltliche Ordnung in die Gemeinde und wurde von ihnen kontrolliert. Parallel damit geschah auch eine Ausweitung der Macht des Ältesten – zunächst wahrscheinlich unbeabsichtet. Weiter fügt Penner hinzu: „Zur preußischen Zeit wird aus diesem niederländischen-mennonitischen Gebietsältesten der preußische Oberschulze. Das Amt des ‘Oberschulzen’ ist ja dann als eine Art weltliches Pendant zum geistlichen Ältesten in die mennonitische Selbstverwaltung in Rußland und Mittel- und Südamerika übernommen worden“.(49) Auf Wunsch der Ältesten war somit die „weltliche“ Verwaltung (sprich Politik) in die Gemeinde gekommen mit der Absicht, die Gemeindeglieder vor der Welt und der Politik zu schützen. Penner macht auf diesen Widerspruch mit den mennonitischen Glaubensprinzipien aufmerksam. Doch diese Beteiligung an der Verwaltung auf lokaler Ebene war auch damals schon umstritten. Penner gibt dann auch zugleich ein Beispiel, wo Gemeinden im Danziger Gebiet nicht willig waren das Schulzenamt zu übernehmen, so dass der Danziger Rat sich gezwungen sah, in den Gebieten, wo die Mennoniten die überwiegende Mehrheit bildeten, einen Erlaß herauszugeben, der die Mennoniten dazu verpflichtete, das Schulzenamt zu übernehmen. Darauf bestimmte der Älteste Georg Hansen von der Danziger flämischen Gemeinde, „dass auf dem Lande, wo es nicht zu umgehen sei, öffentliche Ämter angenommen werden könnten“.(50) Die Mennoniten gewöhnten sich schnell an die neue Situation und an das Schulzenamt, an dem sich zunächst einige Gemeinden nicht beteiligen wollten. Es brachte ihnen sichtbare Vorteile. Als sie dann einige Jahrzehnte später im Schulzenamt von den Lutheranern diskriminiert werden, richten die Mennoniten eine „Supplikationsschrift“ (1720) an das Königliche Ökonomieamt in Marienburg, „dass sie bei der Schulzenwahl mit den Lutheranern gleichberechtigt zu werden wünschten“.(51) Die Bitte wird ihnen gewährt. Dazu macht Penner folgende Bemerkung: „Die Führung des Schulzenamtes scheint den mennonitischen Grundsätzen auf den ersten Blick zu widersprechen. Sie läßt sich irgendwie aber doch mit den oben genannten Grundsätzen vereinbaren, wenn nur ein mennonitischer Schulze Vorstand einer mennonitischen Dorfschaft ist“.(52) Penner setzt dabei voraus, dass dieser Schulze in Streitfragen dem „Kirchenvorstand“ oder der „Brüderversammlung“ unterstellt ist, wo Streitigkeiten im brüderlichen Geiste entschieden werden. Fälle, die sonst vor ein Zivilgericht kamen, wurden bei den Mennonitengemeinden vor den Ältesten, die Prediger oder auch vor die Bruderschaft gebracht. Die Mennoniten hatten nicht das „weltliche Schwert“ des Richters, aber das vielleicht wirksamere der „Absonderung von der Gemeinde“.(53) Nach diesem Prinzip handeln noch heute die bei uns so genannten mexikanischen Gemeinden. Dies war der Stand in den preußischen Gemeinden, als es um 1788 zur Auswanderung nach Rußland kam, wo das Selbstverwaltungssystem zum eigenen Nutzen unter räumlicher Trennung perfektioniert wurde. In Paraguay wird dieses System bis heute in leicht veränderter Form weitergeführt.
Doch wie entwickelte sich die Einstellung der Mennoniten in Preußen zum Staat, möchte sicherlich der eine und andere noch wissen. Kurz gesagt, ganz anders als in Rußland. Grundsätzlich verschiedene Gegebenheiten formten unter den Mennoniten verschiedene Einstellungen zu Staat und Politik. Friedrich Wilhelm III. (1797-1840) war den Mennoniten wohlgesonnen. Aber gerade unter seiner Regierung erfolgte 1803/4 der Landfrage wegen die zweite große Auswanderungswelle der Mennoniten aus Preußen nach Rußland (Molotschnakolonie), und Preußen wurde in schwere Kriege verwickelt. 1806 wurde Preußen von Napoleon besiegt. 1812 marschierte er in Rußland ein und erlebte dort die furchtbare Niederlage, – der Anfang seines Endes. Der große Befreiungskrieg, der nun folgte, wurde von den Mennoniten in Preußen mit großen Spenden unterstützt. Einzelne Mennoniten, von der Freiheitseuphorie ergriffen, gingen freiwillig zum Militär. Zunächst galten diese gemäß dem mennonitischen Glaubensprinzip der Wehrlosigkeit ab sofort nicht mehr als Mennoniten. Doch diese Einstellung änderte sich im Laufe der folgenden Jahrzehnte. Die Mennoniten in Preußen haben sich nach und nach in die preußische Gesellschaft integriert. Wie schon weiter oben dargestellt konnten die Mennoniten die Wehrdienstbefreiung noch einige Jahrzehnte aufrecht erhalten. Das Gesetz vom 9. November 1867 und seine Abmilderung in der „Kabinettsorder“ vom 3. März 1868 führten dazu, dass sich die Mennoniten fortan der Dienstpflicht fügten, zunächst in Form eines Alternativdienstes, dann aber auch schon bald im aktiven Wehrdienst. Die Entscheidung überließ die Gemeinde dem jeweiligen Gemeindeglied. Zwei Faktoren haben die Mennoniten in ihrer Geschichte in ihrer Einstellung zum Staat und zur Beteiligung an der Politik entscheidend beeinflußt: die Glaubensprinzipien auf der einen Seite, auf der anderen die Umwelteinflüsse und die politischen Gegebenheiten. Dabei ist nicht immer klar ersichtlich, welcher der Faktoren stärkere Auswirkungen auf die Entscheidungen der Mennoniten hatte.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Bibliographie:
Bibliographie:
- Brandt/Goertz 2002 = Brandt, Edward R. und Goertz, Adalbert. Genealogical Guide to East and West Prussia (Ost- und Westpreussen): Records, sources, Publications and Events. Selbstverlag: 13-17th Ave. S.E., Minneapolis, MN., 2002.
- Bender 1939 = Bender, Harold S. „Church and State in Mennonite History“. The Mennonite Quarterly Review, Vol. XIII, April 1939, S. 104-122.
- Borchardt/Murawski o.D. = Borchardt, Georg und Murawski, Erich. Die Randbemerkungen Friedrichs des Großen. Friedberg: Podzun-Pallas-Verlag GmbH, o.D.
- Ebeling 1965 = Ebeling, Hans. Geschichten aus der Geschichte. Bd. III, Neuzeit, Westermann Verlag, Braunschweig, 1965.
- Ebeling/Birkenfeld 1978 = Ebeling, Hans, neubearbeitet von Wolfgang Birkenfeld. Die Reise in die Vergangenheit: ein geschichtliches Arbeitsbuch. Ausgabe N, Bd. 2, Westermann, Braunschweig, 1978.
- Epp 1889/1984 = Epp, D.H. Die Chortitzer Mennoniten: Versuch einer Darstellung derselben. Im Selbstverlag, Odessa 1889. Neudruck: Die Mennonitische Post, Steinbach, 1984.
- Friesen 1986 = Friesen, John. „Mennonites in Poland: An Expanded Historical View“. In: Journal of Mennonite Studies, Winnipeg, Canada, 1986, S. 94-108.
- Gerlach 1980 = Gerlach, Horst. Bildband zur Geschichte der Mennoniten. Verlag Günther Prenschoff, Oldenstadt, 1980.
- Gerlach 1999 = Gerlach, Horst. Hutterer in Westpreußen: Ein Bruderhof in Wengeln am Drauensee. Sonderdruck aus Westpreußen-Jahrbuch, Bd. 49. Herausgegeben von der Landsmannschaft Westpreußen, Münster/Westfalen, 1999.
- Hildebrand 1836 = Hildebrand, Peter. „Erste Auswanderung der Mennoniten aus dem Danziger Gebiet nach Südrußland“, [1836]. In: Peters 1965 = Peters, Victor (Hrsg.). Zwei Dokumente: Quellen zum Geschichtsstudium der Mennoniten in Rußland. Echo Verlag, Winnipeg, 1965, S. 11-46.
- Lichdi 1983 = Lichdi, Dieter Goetz. Über Zürich und Witmarsum nach Addis Abeba: Die Mennoniten in Geschichte und Gegenwart. Agape Verlag, Maxdorf, 1983.
- Lichdi 1994 = Lichdi, Dieter Götz. „Zwischen Absonderung und Bürgersinn“. Die Brücke: Mennonitisches Gemeinschaftsblatt, Oktober 1994, S. 150-152.
- Mannhardt 1919 = Mannhardt, Hermann Gottlieb. Die Danziger Mennonitengemeinde: Ihre Entstehung und ihre Geschichte von 1569-1919. Selbstverlag der Danziger Mennonitengemeinde, Danzig, 1919.
- Mannhardt 1863 = Mannhardt, Wilhelm. Die Wehrfreiheit der Altpreußischen Mennoniten: Eine geschichtliche Erörterung. Im Selbstverlag der Altpreußischen Mennonitengemeinden, Marienburg, 1863.
- Penner o.D. = Penner, Horst. Der Vieguthof an der Weichsel: Ein Roman aus dem 17. Jahrhundert. Herausgegeben von Dr. Horst Gerlach, Weierhof, o.D.
- Penner 1963 = Penner, Horst. Ansiedlung mennonitischer Niederländer im Weichselmündungsgebiet von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum Beginn der preußischen Zeit. Mennonitischer Geschichtsverein, Weierhof, 1963.
- Penner 1973 = Penner, Horst. „Das Verhältnis der westpreußischen Mennoniten zum Staat“. Mennonitische Geschichtsblätter, 30. Jg., 1973, S. 53-59.
- Penner 1978 = Penner, Horst. Die ost- und westpreußischen Mennoniten in ihrem religiösen und sozialen Leben in ihren kulturellen und wirtschaftlichen Leistungen. Teil I. Mennonitischer Geschichtsverein e.V., Weierhof, 1978.
- Penner 1986/87 = Penner, Horst. „Mennonitische Schulzen und Oberschulzen im westpreußischen Weichseldelta“. In: Mennonitische Geschichtsblätter, 43./44. Jg. 1986/87, S. 119-121.
- Peters 1965 = Peters, Victor (Hrsg.). Zwei Dokumente: Quellen zum Geschichtsstudium der Mennoniten in Rußland. Echo Verlag, Winnipeg, 1965.
- Postma 1958 = Postma, Johan Sjouke. Das niederländische Erbe der preußisch-rußländischen Mennoniten in Europa, Asien und Amerika. Inauguraldissertation zur Erlangung der Würde eines Doktors der Theologie der Theologischen Fakultät der Philipps-Universität Marburg/L., 1958.
- Quiring 1938 = Quiring, Horst. „Die Auswanderung der Mennoniten aus Preußen 1788-1870“. Auslandsdeutsche Volksforschung. 2. Band, 1938, S. 66-69.
- Redekop 1973 = Redekop, Calvin. „A State Within a Church“. The Mennonite Quarterly Review, Vol. XLVII, Oktober 1973, S. 339-357.
- Smissen 1895 = Smissen, Carl H.A. van der. Kurzgefaßte Geschichte und Glaubenslehre der Altevangelischen Taufgesinnten oder Mennoniten., Illinois, im Selbstverlag des Verfassers, 1895.
- Tenbrock 1957 = Tenbrock, R.H. et.al. Das Werden der modernen Welt: Geschichtliches Unterrichtwerk für höhere Lehranstalten. Mittelstufe Bd. III, Schöningh/Schrödel, Hannover, 1957.
- Tenbrock 1963 = Tenbrock, R.H. et. al. Der geschichtliche Weg unserer Welt bis 1776: Geschichtliches Unterrichtswerk für höhere Lehranstalten. Schöningh/Schrödel, Hannover, 1963.
- Unruh 1955 = Unruh, Benjamin Heinrich. Die niederländisch-niederdeutschen Hintergründe der mennonitischen Ostwanderung im 16., 18. und 19. Jahrhundert. Im Selbstverlag, Karlsruhe, 1955.
- Warkentin 1993 = Warkentin, Jakob. „Wehrfreiheit – Privileg oder Grundrecht? Auseinandersetzung um die Wehrpflicht der Mennoniten in Ost- und Westpreußen.“ In: Ratzlaff 1993, S. 127-143.
- Wenger 1984 = Wenger, John C. Die Täuferbewegung: Eine kurze Einführung in ihre Geschichte und Lehre. Onken Verlag, Wuppertal und Kassel, 1984.
Fussnoten:
Lehrer und Archivar am Instituto Bíblico Asunción. | |
Z. Bsp. Horst Penner: „Die Ost- und Westpreußischen .Mennoniten“, 1978. | |
1955, S. 100 und 105. | |
1984, S. 70. | |
vgl. Postma 1958, S. 45. | |
Penner 1978, S. 47 und Fußnote 20a S. 371. | |
Bd. I, S.392. | |
Penner 1984, S. 70-71. | |
Penner 1978, Kapitel 6. | |
„Dankbarkeitsgelder“ nennt sie Mannhardt 1919, S. 84-87. | |
Mennonitisches Lexikon IV, S. 506 oder „Holländereien“ Unruh 1955, S. 111. | |
Unruh 1955, S. 130. | |
Mennonitisches Lexikon IV, S. 506. | |
1983, S.105. | |
vgl. Epp 1889/1984, S. 30-33. | |
1978, S. 160. | |
1978, S. 161. | |
Penner 1978, S. 161. | |
ebd., S. 161. | |
Penner 1987, S. 162. | |
ebd., S. 162. | |
ebd., S. 162-163. | |
1978, S. 163. | |
ebd. S. 163. | |
ebd. S. 163-164. | |
Penner 1978, S. 165. | |
ebd., S. 165. | |
Mannhardt 1863, S. 120-121. | |
Borschardt/Murawski o.D. S. 138; vgl. Schoeps 1968, S. 157. | |
ebd., S. 138; Schoeps 1968, S. 158. | |
Mannhardt 1863, S.132; Warkentin 1993, S. 130. | |
Mannhardt 1863, S. 136. | |
ebd., S. 139. | |
ebd., S. 137 und 150 f. | |
Mannhardt 1919, S. 34. | |
ebd., S. 66-67. | |
ebd., S. 64-65. | |
Mannhardt 1919, S. 74. | |
ebd., S. 78. | |
ebd., S. 78. | |
ebd., S. 84-87. | |
ebd., S. 97. | |
ebd., S. 97. | |
ebd., S. 84-85. | |
Mannhardt 1919, S. 97-99. | |
Ebeling/Birkenfeld 1978, S. 93. | |
1978, S. 166. | |
Penner 1978, S. 166. | |
ebd., S. 166-167. | |
Penner 1978, S. 167. | |
ebd., S. 167. | |
ebd., S. 167-168; vgl. Bender 1939. | |
ebd., S. 168. |
Die paraguayischen Mennoniten in der nationalen Politik
Gerhard Ratzlaff
Der Titel ist in doppeltem Sinne zu verstehen: Einmal, dass Mennoniten als ein Mittel zum Zweck in der nationalen Politik gebraucht wurden und zweitens, dass die Mennoniten selbst im nationalen Rahmen Politik gemacht haben. Zunächst aber eine Begriffserklärung, wie in diesem Vortrag Politik verstanden wird.
1. Begriffserklärung: Politik
Das Wort Politik hat seinen Ursprung in dem griechischen „Politeia“ und bedeutete die Anteilnahme eines Bürgers am Staate („Polis“). „Politeia“ bezeichnete auch die Verfassung eines Staates, die im Kreise der Bürger („Politen“) bestimmt wurde. Alle freien Bürger eines Landes waren „Politen“ (Träger des Staates, Politiker), die durch die Erfüllung ihrer Pflichten und Rechte zum Wohle des Landes beitrugen. Aristoteles nannte die gute Demokratie deshalb „Politeia“ (Gemeinwesen der Bürger). Der Titel von Platons Werk über den Idealstaat hieß „Politeia“.(2) Die Vollversammlung der Bürger eines Staates war die „Ekklesia“. Sie vertrat das höchste Entscheidungsrecht. „Ekklesia“ wird zu Deutsch mit Kirche bzw. Gemeinde übersetzt – im Spanischen „Iglesia“ – und mit diesem Wort wird im Neuen Testament auch die gläubige Gemeinde bezeichnet. Somit wird in der Bibel ein demokratisches Prinzip aus dem politischen Bereich auf die gläubige Gemeinde angewandt. Wollten die neutestamentlichen Schreiber damit andeuten, dass die Gemeinde, während sie in dieser Welt tätig ist, sich nicht aus dem politischen Bereich heraushalten kann? Einige wollen es so sehen.(3)
Sich an der „Politeia“ zu beteiligen und in der „Ecclesia“ verbindlich zu engagieren, war das natürliche Recht eines jeden freien Bürgers. Sklaven waren davon ausgeschlossen. So oder so, jeder freie Bürger war mitbeteiligt an der Verwaltung des Staates. Für den Kirchenvater Augustin war die „Politeia“ Gottes „die Gemeinschaft derer, die nach Gottes Gebot lebten“, d.h. die Gemeinde nach Gottes Verordnung.(4) Auf die Situation der Mennoniten in Paraguay angewandt sieht das Bild von der „Politeia“ folgendermaßen aus: Alle Bürger einer Kolonie sind die „Politen“. Sie haben Rechte und Pflichten und sind um das Wohl ihrer Siedlung bemüht. Um eine gesunde Entwicklung zu garantieren, einigen sich die Bürger der Kolonie auf eine Verfassung (Koloniestatuten), schaffen die notwendigen Organe und wählen die entsprechenden Personen als ausführende Körperschaft: Oberschulze, Aufsichtsrat, Komiteemitglieder usw. Die Bürger der Kolonie sind gleichberechtigte, freie Menschen. Sie haben das verbindliche Recht, darauf zu achten, dass die in den Statuten verankerten Ordnungen nicht verletzt werden, die letztendlich den Frieden, die Harmonie und den Fortschritt in der Siedlungsgemeinschaft sichern. In diesem Sinne wird die politische Verantwortung zu einer Realität, der auch in den Kolonien niemand entrinnen kann. Der Verlauf der Dinge in einer Kolonie wird mitbestimmt durch den, der wählt, sowie durch den, der nicht wählt, durch den, der positive, sowie durch den, der negative Kritik übt. Ein Staat im Staate, eine „Politeia“ im Kleinen – ganz im Sinne von Aristoteles – besteht somit in den mennonitischen Kolonien, in denen Innenpolitik betrieben wird und in denen es keine Armee gibt. Das oben Gesagte trifft auch auf das politische Leben eines Staates zu, natürlich in einem größeren und nicht so leicht überschaubaren und durchsichtigen Rahmen. Der bereits zitierte große Brockhaus definiert die Landespolitik als „das staatliche oder auf den Staat bezogene Handeln, sofern es bestimmten Regeln folgt… Politik ist eine Form des Handelns, sie ist an kein bestimmtes Sachgebiet gebunden…“ Weiter heißt es im Brockhaus: „Träger der P[olitik] als Staatskunst sind einerseits die Staaten, die staatl[ichen] Organe und die staatstragenden Schichten (Staatspolitik), andererseits die polit[ischen] Parteien, sofern sie Macht oder Einfluß im Staat erringen oder behaupten wollen (Parteipolitik), ferner, bes. in der Demokratie, frei gebildete gesellschaftliche Gruppen (Interessenverbände), die um ihrer unmittelbaren, z. B. wirtschaftlicher, Ziele willen ebenfalls häufig Einfluß auf die staatlichen Entscheidungen ausüben oder erstreben“. „Die Staatspolitik dient der Verwirklichung der Staatszwecke.(5) Leider ist der Begriff Politik durch die im Lande vorherrschende Korruption herabgewürdigt worden. Ausdrücke in mennonitischen Kreisen Paraguays wie: der „denkt politisch“ oder jemand „handelt politisch“ bedeuten in der Umgangssprache oft, dass der so Bezeichnete undurchsichtig, hinterhältig oder sogar korrupt ist. Sehr oft entspricht dieses Urteil der Wirklichkeit. Die zurzeit stark verbreitete Korruption unter den Politikern in unserem Lande ist nicht dazu angetan, den Begriff der Politik – und des Politikers – aufzuwerten. Dieser Umstand erschwert ehrlichen Menschen die Teilnahme an der Politik. In diesem Vortrag wird der Begriff Politik und die Beteiligung an der politischen Verantwortung im neutralen Sinne gebraucht. Politik ist an sich weder gut noch schlecht, wie das Geld, das wir täglich erwerben und brauchen, an sich weder gut noch schlecht ist. Es hängt davon ab, wie man es erwirbt und was man daraus macht. Der Mensch selbst bestimmt darüber. So ist es auch mit der Politik. Es hängt davon ab, wie der Betroffene den politischen Posten erwirbt und wie er die Politik, die Macht, die damit gegeben ist, gebraucht bzw. mißbraucht. Alle freien Bürger eines Landes sind Politiker (Politen). Dabei hat jeder Bürger drei Möglichkeiten, sich „politisch“ zu bewegen: Er kann sich erstens politisch aktiv engagieren, zweites, er kann als Bürger alle seine Pflichten treu erfüllen, dabei aber passiv bleiben und drittens, er kann von den aktiven Politikern als ein Mittel zum Zweck gebraucht werden (z.B. in den Wahlkampagnen). Auf allen drei Ebenen haben sich die Mennoniten in Paraguay im Laufe der Jahre bewegt. An einer Reihe geschichtlicher Beispiele soll diese Tatsache veranschaulicht werden.
2. Paraguay zur Zeit der mennonitischen Einwanderung
Es geht dabei um die Jahre 1920-1932, von der Zeit, als die Mennoniten erstmals auf Paraguay aufmerksam wurden bis zum Ausbruch des Chacokrieges. Im Jahre 1921 untersuchte die mennonitische Delegation aus Kanada den Chaco, 1927 wurde die Kolonie Menno gegründet und 1930 die Kolonie Fernheim. Und im Jahre 1932 brach der Chacokrieg aus. Wie sah nun das Land aus, in das die Mennoniten einwanderten? Hier eine nur kurze und skizzenhafte Beschreibung: Die wichtigsten paraguayischen Präsidenten dieser Zeit, alle Mitglieder der Liberalen Partei, waren: Manuel Gondra, Eusebio Ayala, Eligio Ayala, und José P. Guggiari. Gondra regierte vom 15. August 1920 bis zum 29. Oktober 1921. Unter dem Druck sozialer und politischer Probleme erklärte er seinen Rücktritt. Gondra lud die Mennoniten ein, nach Paraguay zu kommen, und während seiner Regierungszeit wurde das Gesetz 514 verabschiedet. Eusebio Ayala wurde am 7. November 1921 vom Kongreß zum provisorischen Präsidenten ernannt. Auch seine Amtsperiode war voller politischer Probleme. Es folgte ein langer, blutiger Bürgerkrieg (14 Monate) und schließlich der Rücktritt des Präsidenten am 7. Mai 1923. Eligio Ayala (kein Verwandter von Eusebio Ayala) wurde vom Kongreß zuerst zum provisorischen Präsidenten Paraguays ernannt und übernahm dann am 15. August 1924 offiziell sein Amt als Präsident. Er regierte eine volle Amtsperiode bis zum 15. August 1928. Paraguay hatte 1924 eine Bevölkerung von 828 968 Einwohnern, davon entfielen 103 750 auf Asunción. Eligio Ayala ist in die Geschichte Paraguays als einer der größten Staatsmänner eingegangen. Er hatte eine Ausbildung an den Universitäten Heidelberg, Deutschland, und Zürich, Schweiz, erhalten. Er führte Verbesserungen im Schulwesen Paraguays ein und war bemüht, die wirtschaftliche Lage Paraguays zu heben. Andererseits überschatteten die gespannten Beziehungen zu Bolivien den Frieden in Paraguay. Bolivien drang immer tiefer in den paraguayischen Chaco vor, indem es ein Fortín nach dem anderen gründete. Im Februar und März 1927 kam es zu mehreren blutigen Zusammenstößen, in denen einige Soldaten, unter ihnen der Teniente (Oberleutnant) Adolfo Rojas Silva das Leben verloren. Die Spannungen zwischen Paraguay und Bolivien nahmen bedenkliche Ausmaße an und Paraguay bereitete sich auf einen Krieg vor. Am 29. Dezember 1926 kam die erste Gruppe mennonitischer Einwanderer (309 Personen) mit dem Schiff bis nach Asunción, wo sie in deutscher Sprache von dem Präsidenten Eligio Ayala willkommen geheißen wurden. Am 31. Dezember erreichte sie dann Puerto Casado. Die Kolonie Menno wurde zwar erst 1928 gegründet, doch als offizielles Datum ist der 25. Juni 1927 festgelegt worden. Unter José P. Guggiari (15. August 1928 – 15. August 1932) spitzten sich die Beziehungen zu Bolivien zu. Studenten forderten ein energisches Vorgehen gegen diesen aggressiven Nachbarn. Während eines Protestes vor dem Regierungspalast wurden von der Wache mehrere Studenten erschossen und eine größere Anzahl verwundet. Der Krieg mit Bolivien schien jetzt unvermeidbar zu sein. Die Größe der Bevölkerung Paraguays wurde um 1930 mit etwa 850 000 angegeben, die von Asunción mit 110 000. Paraguay war das ärmste Land Südamerikas und rückständig auf allen Ebenen. Das schulische Niveau war sehr niedrig. Von den 164 800 Kindern im Primarschulalter hatten nur 105 129 Zugang zu einer Schule.(6) Im ganzen Lande gab es nur drei Sekundarschulen, die das volle Programm führten: das Colegio Nacional (gegr. 1890) und das Colegio San José (Privatschule gegr. 1904), beide in Asunción und ein Colegio in Villarrica, der zweitgrößten Stadt Paraguays zu jener Zeit.(7) Die Universidad Nacional, gegründet 1890, war die einzige Universität in Paraguay mit 437 Studenten im Jahre 1930.(8) Sehr rückständig war Paraguay auch auf dem Gebiet der Gesundheitspflege. Im Jahre 1930 hatte Paraguay insgesamt nur 109 Ärzte. Sechs von diesen arbeiteten außerhalb von Asunción. Rund 600 000 Personen hatten keinen Zugang zu ärztlicher Hilfe.(9) Unter allen Ärzten befanden sich nur drei Ärztinnen.(10) Dagegen gab es 180 Hebammen, die für die meisten Geburten im Lande verantwortlich waren.(11) Als das größte Gesundheitsproblem im Land wurde der Hakenwurm angegeben.(12)Paraguay war ein Land ohne Wege. Als Transportmittel dienten auf dem Lande die Carretas. Es gab eine Eisenbahnlinie von Asunción nach Encarnación. Als wichtigste Transportwege dienten die Flüsse. Befahrbare Straßen gab es im ganzen Lande kaum. Daher war auch eine wirtschaftliche Entwicklung des Inlandes ausgeschlossen. Paraguays wichtigste Ausfuhrprodukte waren Baumwolle, Tabak, Yerba Mate, Quebrachoextrakt und Fleisch. Das gesamte paraguayische Volkseinkommen war um 1930 etwa so groß wie das einer Stadt in den USA mit 150 000 Einwohnern.(13) 1927 gab die paraguayische Regierung den Bau der Straße von Asunción nach Luque im Werte von $ 20 000 (1 000 000 Pesos) im Auftrag. Im Bau waren drei Brücken und vier Abwasserkanäle mit eingeplant.(14)Paraguay war in den 1920er Jahren ein nahezu 100% katholisches Land mit nur 104 Priestern für etwa 850 000 Einwohner. Für das Jahr 1928 gibt Elliott die evangelische Bevölkerung mit nur 400 Personen an.(15) Darin sind die Mennoniten, die 1927-28 einwanderten, nicht eingeschlossen. Bis zum Jahre 1932 waren etwa 3500 Mennoniten nach Paraguay eingewandert. Also bildeten sie bei weitem die stärkste evangelische Gruppe in Paraguay, die aber über zwei Jahrzehnte im nationalen Kontext kaum in Erscheinung trat. Als Mitte der 50er Jahre die Mennoniten eine Missionsarbeit in Asunción anfingen, wurden sie von Dr. Decoud Larossa mit offenen Armen willkommen geheißen: „Schon so lange haben wir auf Euren Einsatz gewartet“, war seine überraschende Antwort auf die schüchterne Anfrage von Hans Wiens, in der Hauptstadt eine Missionsarbeit zu beginnen. Als einzigen wesentlichen Beitrag der Evangelischen im Lande nennt Elliott das Colegio International der Discipulos de Christo, das 1920 gegründet wurde und im Jahre 1930 in neun Schuljahren 234 Schüler unterrichtete.(16) Unter solchen Umständen ist die Frage berechtigt, welche Faktoren die Mennoniten bewogen haben, in dieses Land zu ziehen. Dabei möchte ich hier klar herausstellen, dass es nicht die Mennoniten waren, die erstrangig Paraguay als Einwanderungsland suchten, sondern die paraguayische Regierung, die die Mennoniten einlud nach Paraguay zu kommen und zwar sowohl aus wirtschaftlichen wie auch aus national-politischen Interessen. Den politischen Interessen soll nun näher nachgegangen werden.
3. Die Mennoniten im Blickfeld der nationalen Politik
Der zentrale Chaco gehörte rechtlich Paraguay. Doch dieses Recht wurde ihm von Bolivien streitig gemacht. Die Politik Boliviens ging dahin, den Chaco zu erobern und bis an den Paraguayfluß vorzudringen. Wie konnte Paraguay sich vor dem bolivianischen Anspruch und seinem militärischen Vormarsch wehren? Paraguay war arm und schwach. Das sicherste und idealste Mittel um auf internationaler Ebene das Hoheitsrecht über den Chaco zu sichern, war die Besiedlung des Chaco. Doch Paraguay hatte nicht die Menschen dafür. Nicht einmal die nähere Umgebung von Asuncion konnte wirtschaftlich entsprechend genutzt werden. In diesem geschichtlich bedeutsamen Moment treten die Mennoniten ins Blickfeld der nationalen Politik. Paraguay hatte zu dieser Zeit weitsichtige Männer in der Regierung. Als diese von den Mennoniten hörten, die ein Einwanderungsland suchten, dann dachten sie an die Zukunft ihres Landes, dann dachten sie an den Chaco. Sie dachten politisch und waren fest überzeugt, dass eine Besiedlung des Chaco durch die Mennoniten ihre Hoheitsrechte über den Chaco stärken werde. Wer zuerst ein Land besiedelt, hat nach internationalem Recht ein erstes und unbestrittenes Anrecht darauf. Die paraguayischen Politiker setzten nun alle ihnen zur Verfügung stehenden Hebel in Bewegung, ihr Ziel zu erreichen, nämlich den Chaco mit Mennoniten zu besiedeln. Wie dieser Prozess vor sich ging, soll nun in gedrängter Form beschrieben werden. In ihrer Suche nach einem neuen Einwanderungsland nahmen die Mennoniten Kontakt auf mit einem einflußreichen amerikanischen Bankier aus New York, Samuel McRoberts. Er war General im Ersten Weltkrieg gewesen. Nach anfänglichem Zögern entschloß er sich, den Mennoniten bei der Suche nach einem Einwanderungsland zu helfen. Zu diesem Zweck schickte er Fred Engen, einen gebürtigen Norweger, durch Südamerika, um nach dem entsprechenden Land für die Mennoniten zu suchen. McRoberts selbst begab sich 1920 auf eine Geschäftsreise nach Buenos Aires und gedachte, bei dieser Gelegenheit bei der argentinischen Regierung in Bezug auf die Mennoniten vorzusprechen. Er meinte, Argentinien sei das geeignete Land für sie. Auf der Schiffsreise von New York nach Buenos Aires traf sich McRoberts völlig unerwartet mit zwei Paraguayern: Manuel Gondra und Eusebio Ayala. Gondra war der neu gewählte paraguayische Präsident und Ayala sein Außenminister. Diese Männer kamen in engen Kontakt miteinander, und McRoberts berichtete den paraguayischen Politikern von seiner Angelegenheit mit den Mennoniten. Die paraguayischen Politiker wurden äußerst hellhörig und wollten mehr über die Mennoniten wissen. McRoberts schilderte sie als musterhafte Bauern: Was sie in Sachen Landwirtschaft anpacken, das gelingt ihnen. Diese Information steigerte das Interesse der paraguayischen Politiker noch mehr. Sie dachten an die Zukunft Paraguays. Paraguay war ein Agrarland, und die Zukunft Paraguays lag auf dem Lande. Davon war besonders Eusebio Ayala überzeugt. Paraguay brauchte nichts dringender als Bauern, die erfolgreich das Inland bebauen könnten. Sollten die Mennoniten die Lösung dieses Problems werden? 20 bis 30 000 mennonitische Siedler – von diesen Zahlen sprach man damals – könnten schon einen Beitrag für das Land bedeuten, mögen Gondra und Ayala gedacht haben. Sie luden daher McRoberts zu einem vertraulichen Gespräch in ihre Kabine ein. Zwei Stunden redeten sie miteinander. Das Gespräch wurde in allem Ernst geführt. Die paraguayischen Staatsmänner wollten McRoberts überreden, die Mennoniten nach Paraguay zu steuern. Doch McRoberts hatte Bedenken in Bezug auf Paraguay. Paraguay war, seiner Ansicht nach, zu rückständig. Er wollte die Mennoniten nicht ins Unglück stürzen. So lenkte er ab und sprach von den Forderungen, die die Mennoniten stellten: Religionsfreiheit, eigene Schulen in deutscher Sprache, Befreiung vom Militärdienst, Befreiung von der Pflicht zu schwören, eigene interne Verwaltung. Die Paraguayer ließen sich nicht beirren. Sie sagten McRoberts frei heraus, sie würden den Mennoniten das alles geben und noch mehr, sollten sie es wünschen. Sie luden McRoberts ein, nach Asunción zu kommen, um weitere Gespräche zu führen. Doch McRoberts ging darauf nicht ein. Er dachte ausschließlich an Argentinien als Einwanderungsland für die Mennoniten. In Buenos Aires angekommen, nahm McRoberts Kontakt mit der argentinischen Regierung auf. Doch betreffs der Angelegenheit der Mennoniten und ihrer Privilegien war die Antwort ein entschiedenes Nein. Von den Regierungen in Kolumbien und Ecuador war schon vorher eine Absage gekommen. Was nun? In diesem ungewissen Moment kam ein Telegramm aus Asunción von Fred Engen – der inzwischen Kontakt mit der Regierung aufgenommen hatte – mit der Nachricht: „Ich habe das verheißene Land gefunden“.(17) Engen bat seinen Chef, doch sofort nach Asunción zu kommen. Fred Engen war tief ins Innere des Chaco vorgedrungen und hatte dabei die Überzeugung gewonnen, dass dies das Land für die Mennoniten sei, die ja in der Weltabgeschiedenheit leben wollten. Außerdem hatte Engen eine tiefe Sympathie für die Mennoniten und identifizierte sich teilweise mit ihren Prinzipien. Er war Pazifist. Nun konnte McRoberts nicht mehr ausweichen. Immer noch mißtrauisch, begab er sich doch Ende August nach Asunción. Gondra empfing ihn äußerst herzlich und organisierte ein Festessen am Abend des 27. August,(18) zu dem die führenden Politiker, Geschäftsleute und Unternehmer eingeladen worden waren. John E. Bender schreibt nach Berichten von McRoberts selbst, dass alle von den Mennoniten „begeistert“ waren und beschlossen, die Mennoniten nach Paraguay einzuladen.(19) Sie könnten das Geschick Paraguays zum Guten wenden. Die Zeitungen berichteten ausgiebig. Außerdem, und dieses wurde zunächst nicht laut ausgesprochen, würde die Besiedlung des Chaco Paraguay größere Rechte auf dieses umstrittene Gebiet gegenüber Bolivien garantieren. Erneut wurde daher McRoberts versichert, dass die beantragten Privilegien kein Hindernis für eine Einwanderung sein würden. Doch eine Frage blieb noch unbeantwortet, und die mußte geklärt werden, bevor McRoberts bereit war, den Mennoniten Paraguay als Einwanderungsland anzubieten. Paraguay war ein katholisches Land und besaß zu jener Zeit nur eine verschwindend kleine evangelische Minderheit, und diese war nicht gerne von der offiziellen Kirche gesehen. Was würde die katholische Kirche zu einer plötzlichen Einwanderung von Tausenden Mennoniten sagen? John E. Bender berichtet, dass „dieses letzte Hindernis auf dramatische Weise erfolgreich gelöst“ wurde.(20) Gondra lud die kirchlichen Würdenträger zusammen mit den führenden Politikern und Unternehmern zu einer groß angelegten zweitägigen Schiffsreise auf den Paraguayfluß ein. Hier wurde ihnen das Mennonitenprojekt „zum Wohle Paraguays“ mit Erfolg „verkauft“, schreibt Bender. Im abgelegenen Chaco würden die Mennoniten keine Gefahr für die katholische Kirche bedeuten, erklärten die Politiker. McRoberts versicherte den kirchlichen Amtsträgern außerdem, dass die Mennoniten, die eventuell gewillt wären, nach Paraguay zu gehen, nicht zu denen gehörten, die die paraguayische Bevölkerung proselytisieren (d.h. evangelisieren, missionieren) würden. Die Politiker und Unternehmer argumentierten weiter: Wenn das ganze Land von der Einwanderung der Mennoniten profitiert, dann schließe das auch die katholische Kirche ein. So schlossen sich die Vertreter der Kirche auch dem Rufe an: „Laßt die Mennoniten kommen“.(21)
Im Jahre 1921 kam eine mennonitische Delegation aus Kanada nach Paraguay, um den Chaco auf seine Tauglichkeit für eine Einwanderung zu überprüfen. Das Bestmöglichste wurde für die Mitglieder der Delegation getan, um sie zu beeindrucken und für eine Einwanderung zu gewinnen. Die Bemühungen waren erfolgreich. Bevor die Delegation Asunción verließ, hatte sie am 6. Juni 1921 noch eine Audienz beim paraguayischen Präsidenten. Nach einem einstündigen Gespräch verabschiedete er sich von den Mennoniten mit folgenden einladenden Worten: „Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, unser Land zu besuchen und zu untersuchen, und dass es ihnen gefällt. Im Namen der Republik von Paraguay heiße ich Sie als Siedlervolk willkommen. Wir werden sie mit Freuden in Empfang nehmen, und es ist unser sehnlichster Wunsch, dass Sie sich in unserem Land niederlassen, dass es ihnen gut gehen möge, dass sie gesegnet werden, dass ihr Werk Erfolg habe und sie in Frieden ihres Glaubens leben können. Wir werden unterstützen und helfen, wo immer wir können. Ihre Sonderwünsche werde ich dem Kongreß zur Genehmigung und Bestätigung übergeben, und sobald dieses fertig ist, werde ich es Ihnen telegraphisch mitteilen“.(22)
Unter der Leitung von Eusebio Ayala wurde den Wünschen der Mennoniten entsprechend eine Gesetzesvorlage ausgearbeitet. Als die Presse von den großzügigen Privilegien erfuhr, reagierte sie äußerst scharf gegen die Sonderstellung der Mennoniten. Besonders aggressiv agitierte die größte Tageszeitung Paraguays La Tribuna mit folgenden und ähnlichen Schlagzeilen gegen das Mennonitengesetz: „Un poyecto monstruoso“ („Ein monströses Projekt“), „Pueblo, la patria está en peligro“ („Volk, das Vaterland ist in Gefahr“), „La venta del País se ha efectuado“ („Unser Land ist verkauft worden“). El Liberal dagegen verteidigte die Sonderrechte für die Mennoniten mit einem geradezu übersteigerten Lob. So heißt es beispielsweise am 10. Juni 1921: „Sie [die Mennoniten] werden Straßen und Eisenbahnen bauen, auf denen unsere Heere dann das Land verteidigen können“. Sie werden eine Stadt im Chaco bauen – nicht einen Staat im Staate – und wir werden hingehen, um sie dort zu begrüßen, …, alle die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit werden hingehen, die mennonitische Stadt zu sehen, wo das Motto unserer Fahne – Friede und Gerechtigkeit – in den Herzen der Bürger strahlt, die den Namen Gottes ehren, die das Blut des Nächsten und auch das ihrer Feinde nicht vergießen wollen und die sich nicht am Gut des Nächsten bereichern“.(23)
Der Gesetzesvorschlag der Regierung wurde im paraguayischen Kongreß diskutiert. Es kam zu erregten Debatten – ähnlich denen in der Presse. Immer wieder wurde von einigen das Argument vorgebracht, die Mennoniten könnten im Chaco einen „Staat im Staate“ errichten und sich nicht in das Land integrieren. Dagegen hoben die Befürworter des Mennonitengesetzes hervor, dass der Chaco eine unbesiedelte Wüste sei, und die Paraguayer sich selbst nicht einmal wagten, ihn zu besuchen, geschweige denn zu besiedeln. Weiter wird hervorgehoben, dass die Besiedlung des Chaco durch die Mennoniten das Hoheitsrecht Paraguays auf den Chaco gegenüber Bolivien stärken werde. Im Laufe der Zeit würden sich auch die Mennoniten den Gesetzen des Landes anpassen und die in Paraguay Geborenen würden paraguayische Patrioten mennonitischen Glaubens werden. Als am 22. Juli 1921 das Gesetz Nr. 514, später oft „Mennonitengesetz“ genannt, im Kongreß abgestimmt wurde, stimmten 15 dafür und fünf dagegen. Das Gesetz betrachtete die Mennoniten als eine „Empresa Colonizadora“ und nicht als eine Glaubensgemeinde. Die wichtigsten Artikel waren:
1. Volle Religionsfreiheit, die es in Paraguay zu jener Zeit nicht gab.
2. Vor Gericht nicht schwören zu müssen, sondern mit einem „Ja“ oder „Nein“ antworten zu dürfen.
3. Befreiung vom obligatorischen Militärdienst.
4. Das Recht auf eigene Schulen in deutscher Sprache und Religionsunterricht.
5. Die Verwaltung der eigenen Erbschaft durch ein Waisenamt.
6. Steuerbefreiung für zehn Jahre.
1. Volle Religionsfreiheit, die es in Paraguay zu jener Zeit nicht gab.
2. Vor Gericht nicht schwören zu müssen, sondern mit einem „Ja“ oder „Nein“ antworten zu dürfen.
3. Befreiung vom obligatorischen Militärdienst.
4. Das Recht auf eigene Schulen in deutscher Sprache und Religionsunterricht.
5. Die Verwaltung der eigenen Erbschaft durch ein Waisenamt.
6. Steuerbefreiung für zehn Jahre.
Die Selbstverwaltung der Kolonie ist im Gesetz nicht ausdrücklich erwähnt, wurde aber vorausgesetzt und nach der russischen Tradition von den Mennoniten in Paraguay wie selbstverständlich weitergeführt. Dieser Umstand hat dann später in den 90er Jahren zu mancherlei Mißverständnissen, Unstimmigkeiten und Ärger geführt, denn nicht alle mennonitischen Handlungsweisen lagen im Rahmen der nationalen Gesetze. Am 26. Juli 1921 unterschrieb Präsident Gondra das Gesetz Nr. 514, und damit wurde es rechtskräftig. Währenddessen hatte sich die mennonitische Delegation mit einem Abstecher nach Mexiko und einem Besuch beim Präsidenten Alvaro Obregón auf den Weg nach Kanada begeben. Als sie nach sieben Monaten zu ihren Gemeinden kamen, war dort schon der Text des Gesetzes eingetroffen. Die Vertreter empfahlen ihren Gemeinden Paraguay als Einwanderungsland und nicht Mexiko, wohin zu gehen sich bereits viele entschlossen hatten.
Die Privilegien wurden den Mennoniten gewährt, weil der Chaco ein umstrittenes Gebiet war. Die Mennoniten dienten der nationalen Regierung als ein Mittel, sich das Hoheitsrecht über den Chaco gegenüber Bolivien zu sichern. Nationale Interessen waren entscheidend, die Mennoniten nach Paraguay einzuladen. Somit wurden die Mennoniten zu einem Werkzeug der nationalen paraguayischen Politik.
4. Die Mennoniten verteidigen das paraguayische Hoheitsrecht über den Chaco.
Das klingt paradox und ist ein Paradox. Das Leben und die menschliche Geschichte, nicht weniger die mennonitische Geschichte, läuft in Paradoxen ab. Die Mennoniten, ein wehrloses und friedliebendes Volk, trugen entscheidend dazu bei, dass Paraguay gegen Bolivien das Feld behaupten und den Chaco erobern konnte. Wie dies geschah, soll nun aufgezeigt werden. Die amerikanische Zeitschrift „The Literary Digest“ schrieb über die Mennoniten im Chaco im April 1933, kurz nachdem der Krieg mit Bolivien ausgebrochen war: „Der Krieg hat die Mennoniten im Urwald erreicht, dort wo sie nie wieder den Kanonendonner zu hören meinten“.(24) Auch im abgeschlossenen Chaco standen die Mennoniten zu ihrem großen Leidwesen nicht außerhalb der Interessen der nationalen und internationalen Politik. Wie die Mennoniten im Chaco zum Werkzeug nationaler Interessen wurden, ist oben bereits angedeutet worden und soll hier nun weiter ausgeführt werden. Die Einwanderung der Mennoniten verschärfte den Grenzkonflikt zwischen Paraguay und Bolivien. Während der Diskussion des Gesetzes 514 im paraguayischen Kongreß wurde immer wieder hervorgehoben, dass die Besiedlung des Chaco durch die Mennoniten den Anspruch Paraguays auf dieses Gebiet bestärken werde. Der Innenminister, der im Interesse der Regierung Gesetz 514 im Kongreß vorstellte, sprach vom Kommen der Mennoniten als einer „schönen Perspektive“ und „einem wertvollen wirtschaftlichen Beitrag“ und hebt dann betont hervor: Die Exekutive kommt zum Senat mit voller Aufrichtigkeit; es erübrigt sich zu sagen, dass sie [die Mennoniten] ein starkes, wertvolles Heer sind, die kommen, um unser Hoheitsrecht zu stärken, und in der Tat ein großes Territorium besetzen werden. Das ist der Kern der Sache“.(25) Und Senator Eusebio Ayala antwortete auf die Bedenken, dass die Mennoniten im Chaco ein Reich für sich, einen Staat im Staate bilden würden: „Die Mennoniten, die im Lande zur Welt kommen, werden paraguayische Bürger mit mennonitischer Religion sein“.(26) Und als 1926 der erste Transport von Mennoniten im Hafen von Asunción auftaucht, schreibt eine Asuncioner Tageszeitung vom 29. Dezember: „Es ist dieses die Vorhut eines mächtigen Heeres, ins Land gekommen, unseren Besitz zu verstärken; ein Heer des Friedens, das den Pflug als Angriffswaffe mit sich führt und das Kreuz Christi als Verteidigungswaffe präsentiert – …“.(27) Ohne es zu wissen und ohne ihr Dazutun trugen die Mennoniten zur Verschärfung des Konfliktes mit Bolivien bei. Folgendes Beispiel macht das klar. 373 mennonitische Flüchtlinge aus Rußland waren über Harbin, China, auf dem Wege nach Paraguay. Am 5. April 1932 war dieser Transport im Begriff mit dem französischen Schiff Croix den Hafen von Le Havre im Norden Frankreichs zu verlassen, um nach Buenos Aires zu fahren. Doch dann verwehrte der bolivianische Konsul die Abfahrt des Schiffes mit der Begründung, dass sie ein bolivianisches Visum bräuchten, da sie angeblich bolivianisches Territorium besiedeln würden. Das verursachte natürlich eine Verzögerung der Reise und Ärger bei den Behörden. Schließlich erhielten alle Passagiere das bolivianische Visum, unmittelbar unter dem paraguayischen eingetragen. Gegen diese Handlung Boliviens protestierte Paraguay. Als dann Bolivien erklärte, dass es in Zukunft keine Einwanderung in den Chaco zulassen werde, es sei denn unter bolivianischer Oberhoheit, brach Paraguay seine Beziehungen mit Bolivien ab. Um die Mennoniten anzuziehen, hatte Bolivien ebenfalls ein Privilegium für die Mennoniten erlassen. Peter P. Klassen nennt es ein „Kontra-Privilegium“.(28) Nachdem der Krieg dann ausgebrochen war, erschien im September 1932 eine Delegation bolivianischer Soldaten in Schönwiese (Nr. 7), dem westlichsten Dorf der Kolonie Fernheim, und überreichte dem Lehrer der Schule ein Schriftstück, welches erklärte, dass die Dörfer Schönbrunn (Nr. 6) und Schönwiese (Nr. 7) „unter dem Schutz unserer Gesetze und der Herrschaft Boliviens stehen“. Als Bemerkung wird dem Schreiben hinzugefügt: „Dieser Brief diene Ihnen als Ausweis, wenn unsere Regimenter im Vormarsch in Richtung Puerto Casado durchkommen. Unsere Kampfflugzeuge haben Anweisung, die mennonitischen Dörfer nicht zu bombardieren“.(29) Die amerikanische Zeitung „The Christian Century“ informierte am 20. September 1933: „Die Mennoniten, ein friedliches und sanftmütiges („inoffensive“) Volk, scheinen der Anlaß zu dem ganzen Konflikt zu sein“.(30) Nun, die Ursache des ganzen Chacokonfliktes waren die Mennoniten keineswegs, doch kann man nicht leugnen, dass die Einwanderung den Konflikt verschärfte, auch wenn dieses den Mennoniten nicht bewußt war. Die Mennoniten wurden ganz deutlich von der paraguayischen Regierung als ein politisches Mittel benutzt, um zu ihrem Ziel, die Oberhoheit über den Chaco zu wahren, zu gelangen. So trugen die Mennoniten entscheidend zur Verschärfung des Konfliktes zwischen Paraguay und Bolivien und schließlich zur Eroberung des Chaco bei.
Der Krieg war für die Mennoniten eine unangenehme Überraschung und löste Angst und Schrecken aus. Doch andererseits profitierten die Mennoniten vom Krieg. Zum ersten Mal in ihrer kurzen Geschichte kam Bargeld in die Kolonie, indem das Heer auf Verordnung der Regierung von den Mennoniten alle Lebensmittel, die sie produzieren konnten, kaufte. Die Mennoniten hatten keine Ärzte. Während der Zeit des Krieges behandelten die Militärärzte kostenlos die Mennoniten. Der Chacokrieg bot den Mennoniten durch den Kontakt mit den Soldaten die einzige Möglichkeit, das paraguayische Volk und ihre Eigenart ein wenig kennenzulernen. Unbeabsichtigt gewannen die Mennoniten durch die Presse eine nationale und internationale Publizität und Sympathie. Internationale Korrespondenten, die auf dem Wege zu dem Kriegsschauplatz durch die mennonitischen Siedlungen kamen, berichteten in ihrem Heimatland immer wieder über die friedliebenden, blonden Menschen im wilden Chaco. Die Soldaten, die während des Krieges durch die Kolonien zogen, erinnerten sich mit vor allem zwei Ausdrücken noch nach Jahrzehnten an die Mennoniten: „schönes Fräulein“ und „Kaputi Mennonita“. Nicht nur die Mennoniten profitierten von dem grausamen Chacokrieg. Das paraguayische Heer zog große Vorteile aus der Gegenwart der Mennoniten. Schon wenige Monate nach Ausbruch des Krieges hatte das paraguayische Heer das Gebiet in dem die Kolonien lagen, besetzt. Das Heer nutzte fortan die mennonitische Infrastruktur, die Wege, das Wasser aus den Brunnen, die Schulräume und das Krankenhausgebäude für die verwundeten Soldaten. Vor allem waren es die Lebensmittel und Produkte der Mennoniten, aus denen das paraguayische Heer entscheidende Vorteile zog. So bedeutend war der gesamte Beitrag, dass vereinzelte Stimmen meinten, dass Paraguay den Krieg ohne den Beitrag der Mennoniten nicht hätte gewinnen können. „Ob Paraguay ohne die Mennonitensiedlungen überhaupt hätte den Chaco halten können, ist noch eine große Frage“, berichtete die deutsche Gesandtschaft 1936 an das Auswärtige Amt in Berlin mit Bezug auf den Chacokrieg.(31) Andererseits haben einige Leute behauptet, wäre der Chacokrieg nicht gekommen, so hätten die Kolonien wirtschaftlich nicht überlebt. Das Militär war ein ausgezeichneter Absatzmarkt und Rohstofflieferant (Metallschrott). Auf dramatische Weise zeigt der Chacokrieg, dass die Mennoniten sich nicht dem politischen Geschehen dieser Welt entziehen konnten. Mehr oder weniger steckten auch sie mitten drin, selbst im entlegenen Chaco. Besonders stark sticht die Paradoxie hervor, einerseits wehrlos zu sein, aber andererseits dem Militär doch ganz massiv genutzt zu haben. Zwischen der Regierung und dem Militär einerseits und den Mennoniten andererseits wurden durch den Krieg sehr enge Beziehungen geknüpft. Nikolai Siemens, Herausgeber des Mennoblattes, berichtet davon, wie er mit dem Oberschulzen Jakob Siemens im Juli 1935 den paraguayischen Präsidenten Dr. Eusebio Ayala besuchte. Der Oberschulze verlas im Namen der Fernheimer Bürger vor dem Präsidenten folgenden Gruß:
- „Ew. Exzellenz!
- „Im Namen der Mennoniten der Kolonie Fernheim im Chaco Paraguay sind wir erschienen, um Ihnen unsere Glückwünsche zu übermitteln… Gleichzeitig danken wir innig, dass durch Ihre Vermittlung und durch die Aufmerksamkeit des hohen Kommandos im Chaco, wir in den drei schweren Kriegsjahren so gut mit dem disziplinierten paraguayischen Militär auskamen, was stets dankend von uns anerkannt werden soll… Gnädige Exzellenz wollen gestatten, kurz einige Fragen mit Ihnen zu regeln, die das Wohl unserer Kol. betreffen… Nehmen Sie, hohe Exzellenz, nochmals die wohlgemeintesten Wünsche aller unserer Kolonisten entgegen“.
- J. Siemens, Oberschulze.
Siemens schließt die Beschreibung des Besuches beim Präsidenten mit folgenden Worten: „Freudig bewegt verlassen wir den Palast. Wie einfach hier doch so eine Audienz ist! Keine Untersuchung vorher, keine Wache beim Audienzsaal; das ist wohl Demokratie im wahren Sinne des Wortes!“ Die Regierung hatte den Mennoniten versprochen, dass ihnen jeder Schaden, verursacht durch den Krieg, entschädigt werden würde. Daran hat die Regierung sich gehalten. Wie informell und persönlich das Verhalten der Mennoniten zur nationalen Regierung war, verdeutlicht folgendes Beispiel von Jacob A. Braun. Braun war der erste Vorsteher (Oberschulze) der Kolonie Menno. Er berichtet nun, dass während des Krieges eine Anzahl von Rechnungen für gelieferte Produkte nicht bezahlt worden waren. Immer war er auf „das nächste Mal“ vertröstet worden. Der Krieg ging zu Ende und immer noch war die Rechnung nicht beglichen worden. Wieder einmal war Braun in Asunción beim Minister (es wird nicht gesagt welcher) gewesen und vertröstet worden. Nun hatte Braun eine Idee. Er schreibt: „Da dachte ich, warum sollte ich nicht einmal versuchen, den Präsidenten zu sehen. So ging ich zum Regierungspalast und befragte mich, wo der Präsident sich aufhielt. Ich ging hin und ließ mich beim Wärter anmelden. Ich brauchte nicht lange zu warten, dann wurde ich hineingerufen. Der Präsident Dr. Eusebio Ayala begrüßte mich sehr freundlich und sprach mich gleich in Englisch an. Er sprach gut Englisch. Er fragte nach unserem Ergehen und Verschiedenes und dann fragte er nach meinem Anliegen oder Wunsch. Ich sagte ihm, was und wie viel wir an das Militär geliefert hatten, wie viel wir erhalten hatten und wie viel laut unserer Rechnung das Militär uns noch schuldete. Da sagte er, damit müsse ich zum Finanzminister gehen. Ich sagte ihm, dass ich schlecht Spanisch könne. Darauf sagte er: ,Ihr werdet euch schon verstehen’.
- „Der Finanzminister hatte sein Büro in demselben Palast, … Ich wurde sofort hineingelassen. Ich war schon angemeldet, das merkte ich gleich. Der Minister war sehr freundlich. Er war schon ein etwas älterer Herr. … Er fragte mich, was ich wünsche. Da sagte ich, was wir an das Militär im Chaco geliefert hatten, wie viel Zahlung wir dafür erhalten hatten und wie viel laut unserer Rechnung das Militär uns noch schuldete. Sein Sekretär mußte in ihrer Rechnung nachsehen. Ich weiß nicht ob sie mit unserer übereinstimmte, aber er sagte zum Sekretär, dass er den Scheck ausstellen solle. So erhielt ich ihn voll auf einmal. Ich war froh und dankbar“.
5. Ein mennonitischer Krieg um ein mennonitisches Glaubensprinzip.
Dabei ging es um das Prinzip der Wehrlosigkeit und der Nichtbeteiligung an der Politik. Die internationale politische Entwickelung einerseits und die nahezu ausweglose Lage der Mennoniten in Paraguay andererseits waren Auslöser des Kampfes innerhalb der mennonitischen Glaubensgemeinschaft in Paraguay. Dieser Kampf wurde im Wesentlichen in Fernheim ausgetragen, betraf aber auch Friesland in Ostparaguay. Menno blieb davon unberührt. Der Kampf unter den Mennoniten ist unter dem Namen „Die völkische Bewegung“ bekannt. Die Bewegung begann, als Adolf Hitler in Deutschland 1933 an die Macht kam. Die Mennoniten Fernheims waren begeistert. Ein Gratulationsschreiben an Hitler, unterschrieben von den geistlichen und weltlichen Führern Fernheims, wurde abgeschickt.(34) Darin wird Hitler als ein von Gott erwähltes Werkzeug gepriesen. Die Begeisterung in Fernheim kennt kaum Grenzen. Als ein Lehrer, Peter Hildebrandt, diese Begeisterung kritisiert, protestiert die K.f.K. heftig bei B.H. Unruh: „Wir aber wollten unseren Kindern Hitler als Beispiel geben“ (Sylvester 1935). Bis zu Beginn der 40er Jahre waren in Fernheim mehr als 90% der Bevölkerung von Hitler begeistert, in Friesland sogar 100% laut einem Bericht der amerikanischen Ärzte in Fernheim an das MCC in Nordamerika. Doch dann kam es zu einem Riß in der völkischen Bewegung, der Gemeinden spaltete und schließlich zu einem bedauerlichen Kampf zwischen der völkischen und antivölkischen bzw. wehrlosen Faktion führte. Dabei finden die Befürworter der völkischen Bewegung in Deutschland, die Wehrlosen bei den Mennoniten in Nordamerika Unterstützung. Der Kleinkrieg unter den Mennoniten im Chaco hatte folglich internationale politische Hintergründe. Den Völkischen wurde vorgeworfen, politisch und wehrhaft zu sein, den Wehrlosen wurde vorgeworfen, dass sie „Prinzipienreiter“ seien, die Prinzipien über biblische Wahrheiten setzten und sie mit unlauteren Mitteln verteidigt. So kam es zu einem unseligen Bruderkampf, der mittlerweile in allen Einzelheiten beschrieben worden ist und hier nicht weiter ausgeführt zu werden braucht. Dieses bedauerliche Kapitel in der Geschichte der Mennoniten Paraguays zeigt, dass ein Teil der Mennoniten in die zermalmenden Räder der internationalen Politik geraten war trotz bester Absicht, friedliebende Mennoniten zu sein und zu bleiben und sich nicht an der Politik zu beteiligen. Sie wurden gewissermaßen vom „Schicksal“ überrannt.
6. Die Ruta Transchaco: Weg zur wirtschaftlichen und politischen Integration der Mennoniten im Chaco
Die Mennoniten im Chaco lebten in der Isolation. Sie bildeten im besten Sinne des Wortes einen Staat im Staate. Aber die Zukunft der Mennoniten im Chaco war unsicher. Es bestand durchaus die Möglichkeit, dass die Kolonien sich auflösen könnten, es sei denn, man fände einen Weg der isolierten und aussichtslosen wirtschaftlichen Lage zu entkommen. Der Ausweg aus dieser Lage war ein direkter Weg von den Kolonien bis nach Asunción. Doch hier hieß es für die Mennoniten, „Arzt hilf dir selber“. Trotz der wohlwollenden Haltung der paraguayischen Regierung bestand keine Aussicht, dass sie diesen Weg bauen lassen würde. Das aus verschiedenen Gründen: Die Regierung hatte weder Mittel noch Personal dafür und außerdem stand der Wegbau nach Encarnación und zur brasilianischen Grenze vorrangig an erster Stelle. Mitte der 50er Jahre war Paraguay noch ein Land ohne Landstraßen. Hier nun traten die Glaubensbrüder der Mennoniten Paraguays in Nordamerika auf den Plan, vertreten durch das MCC. In anerkennenswerter Hingabe und in enger Zusammenarbeit mit den Mennoniten Paraguays vollbrachten sie ein Kunststück von Diplomatie und Organisation (Politik). Als Folge ihres Einsatzes kam es zu einer „seltsamen Koalition“, bestehend aus der paraguayischen Regierung, der amerikanischen Regierung, den Mennoniten und den Viehzüchtern des Chaco.(35) Auf Bitte des MCC schenkte die amerikanische Regierung Paraguay Wegebaumaschinen, die für den Krieg in Korea gebaut worden waren, aber nicht zum Einsatz gekommen waren. Dem MCC wurde die Verantwortung für den gesamten Bau der Transchacostraße übertragen und 1961 war der Weg von Asunción bis in die Kolonien fertig. Der Bau der Ruta Transchaco zusammen mit einem Millionenkredit, der vom MCC für die Mennoniten in Paraguay erwirkt wurde, war der Start in eine gesicherte wirtschaftliche Zukunft. Diese Tatsache wird von den Mennoniten im Chaco bewußt anerkannt. Weniger bewußt wird der Umstand wahrgenommen, dass die Ruta Transchaco den Weg in die wirtschaftliche, politische und soziale Integration der Mennoniten im Chaco eröffnet hat. Durch den Bau der Straße wurden die Mennoniten zu politischen Akteuren. Straßen sind für die Politik eines Landes grundlegend wichtig. Die Mennoniten haben in diesem Sinne einen bedeutungsvollen Beitrag zur Politik und Entwicklung Paraguays geleistet. Wirtschaftliche und politische Integration der Mennoniten in Paraguay haben einen in der gesamten mennonitischen Geschichte ungekannten Höhepunkt erreicht. Die soziale Integration steht noch aus.
7. Die Mennoniten unter Stroessner 1954-1989: gefügige, politische Werkzeuge
Dieses etwas hartklingende und unangenehme Urteil über die Mennoniten in Paraguay habe ich mehrfach von internationalen Besuchern in Paraguay gehört – von Mennoniten und auch von Nichtmennoniten. „Unter dieser Regierung haben wir es sehr gut“, war ein geläufiger Ausdruck der Mennoniten zur Zeit der Stroessnerregierung. Diese Aussage stimmte. Eine weitere Aussage: „Wir dürfen uns nicht in die nationale Politik einmischen“. Viele Mennoniten meinen, und so ist es öfters in die Presse gekommen, dass sie während der Stroessnerregierung politisch völlig unbeteiligt gewesen seien. Diese Meinung hält jedoch einer kritischen und sachlichen Untersuchung nicht stand. Es stimmt schon, dass die Mennoniten während der Stroessnerregierung keine politischen Ämter auf Landesebene bekleideten. Diese haben die Mennoniten nicht gesucht, noch hat die Regierung eine direkte politische Beteiligung von den Mennoniten erwartet. Eine direkte politische Beteiligung von Seiten der Mennoniten wäre wohl auch nicht im Sinne der Politik der Stroessnerregierung gewesen und hätte sich wahrscheinlich auch auf die Mennoniten selbst negativ ausgewirkt. Die Zeit war noch nicht reif für eine direkte politische Beteiligung auf nationaler Ebene. Und dennoch bestand eine enge Beziehung zwischen den Mennoniten und dem Staat (Stroessnerregierung), wie sie in ihrer Intensität sonst nirgends auf der Welt in der mennonitischen Geschichte zu finden ist, wenn auch auffallende Parallelen zu Rußland da sind. Noch bevor Stroessner Präsident wurde, besuchte er wiederholt die Mennoniten im Neuländerdorf Tiege, nahe beim Fortin Boquerón gelegen. Allerdings ging es damals eher um die Jagd auf Wild, aber eine freundliche Beziehung Stroessners zu den Mennoniten kam damals schon deutlich zum Ausdruck. Dann 1954, kurz nachdem Stroessner Präsident geworden war, besuchte er die Mennoniten im Chaco am 12. November. Das war eine Sensation. Nikolai Siemens, Herausgeber des Mennoblattes, berichtet darüber ausgiebig:
- „Der 12. November war für die Mennonitenkolonien des Chaco ein Tag besonderen Ereignisses…. Schon lange Zeit vorher hatte man vom Besuch des Landespräsidenten gesprochen und dafür gerüstet. Es war geplant, diesen Tag mit einer kleinen Ausstellung zu verbinden, woran sich alle drei Kolonien beteiligten… Schon früh morgens strömten die Bewohner der Dörfer nach Philadelphia… Man schätzt die Menschenmenge wohl auf mindestens 3 000 Personen…“
Mit mehreren Flugzeugen, großen und kleinen, landet der Präsident am frühen Nachmittag. Nachdem die Begrüßung von Seiten der Kolonievertreter auf der Landepiste stattgefunden hat, heißt es in dem Bericht weiter: „Nun nehmen 20 Pferdefuhrwerke und 9 bereitstehende Jeeps und Autos die Gäste auf. Voran fährt der Präsident und der Kriegsminister auf einer mennonitischen Droschke, kutschiert von Bürger H. Neufeld, Friedensfeld, mit zwei prächtigen Braunen… Am Tor zum Hof des Zentralschulgebäudes liest man auf einem Plakat:
- ¡VIVA EL PROTECTOR DE LA ECONOMIA NACIONAL!
- [„Es lebe der Beschützer der nationalen Wirtschaft“]
Zum Schluß des Programms spricht der Präsident zu der erwartungsvollen Menschenmenge. Siemens schreibt: Als Chacopatriot habe er die Entwicklung der Mennonitenkolonien beobachtet und sei erstaunt über die günstige Entwicklung, auch unter großen Widerwärtigkeiten. ,Wir wollen unter meiner Regierung alles Mögliche tun, was den Kolonien zum Nutzen ist. Ich möchte einen jeden von euch in Liebe umarmen. ‘ Besonders markant ist der Satz: ,Unter meiner Regierung soll der López-Palast jedem Mennoniten offen stehen, sowie die Türen jedes einzelnen Ministeriums. Denn wir alle sind Diener des Volkes!“.(36) Der Besuch des Präsidenten fand ein starkes und positives Echo in der nationalen Presse. Es dauerte auch nicht lange, da hörte man die scherzhafte Bemerkung, dass Stroessner der Präsident der Mennoniten sei. Sein „Schoßkind“ waren sie sicherlich, so wie die Mennoniten in Rußland das „Schoßkind“ der Zaren waren.
Zwei Studenten im IBA hatten den Auftrag nachzuforschen, was das Mennoblatt zur Frage der Politik zu bieten habe. Ihre lakonische Schlußfolgerung: „Keine Stellungnahme zur Politik – nur Stroessnerbesuche“. Hier etwas von dem, was die Studenten über die Stroessnerbesuche gefunden hatten:
Über einen unerwarteten Besuch des Präsidenten berichtet das Mennoblatt36: „Am 20. Oktober landete ganz unerwartet der Landespräsident, General A. Strößner, auf dem Flughafen von Filadelfia. Auf diese Weise besucht der Präsident unangemeldet alle 14 Tage verschiedene Ortschaften des Landes. Der Herr Präsident ist ein Freund der Mennoniten, und teilnahmsvoll erkundigte er sich nach der wirtschaftlichen Lage. Er ließ sich auch über die Ursachen der Abwanderung aufklären… Er bewilligte soziale Einrichtungen in Filadelfia. Dem Krankenhaus schenkte er einen großen Eisschrank, und den Krankenschwestern versprach er eine freie Reise nach den Iguazufällen. Auch der Zentralschule stattete er einen kurzen Besuch ab. Der Schülerchor sang ihm einige Lieder vor. In das Gästebuch der Schule schrieb der Präsident folgende Worte: Auf meinem kurzen Besuch in Filadelfia habe ich erneut die großen Leistungen an Arbeit und Fortschritt festgestellt. Meine Regierung anerkennt das und verpflichtet sich, der Kolonie alle nur mögliche Hilfe zur Verfügung zu stellen. Es wird eine wirkliche und wirksame Hilfe sein und nicht nur in Worten. Die Zeit wird es beweisen’… Darauf begab sich der Herr Präsident wieder nach seinem Flugzeug und verließ die Kolonie, nachdem er grüßend in weitem Bogen die Dörfer überflog.
Nahezu ein Dutzend Stroessnerbesuche werden im Mennoblatt im Laufe der Jahre eingehend beschrieben, auf die wir hier leider nicht eingehen können. Manche inoffizielle Besuche sind nicht verbucht worden. Die meisten Besuche erhielten die Kolonien im Chaco, aber auch die Kolonien Friesland und Volendam haben einige Stroessnerbesuche gehabt.
Einige zusammenfassende Bemerkungen zu den Berichten des Mennoblattes über die Besuche Stroessners sind angebracht: – Der Präsident machte seine Besuche in der Regel mit einem großen Gefolge, in dem vor allem das Militär, die Polizei und seine Minister den Vorrang hatten. Die Kosten, die damit für die Kolonien entstanden, waren recht hoch, aber man hat sie ohne Murren zu Ehren des Präsidenten getragen. – Die Zahl der Besucher und Schaulustigen ist erstaunlich. Bei offiziellen Besuchen ging sie immer in die Tausende und bei ganz besonderen Feiern, z.B. Jubiläumsfeiern, bis auf 14.000. Die Zahl der Mennoniten im Chaco betrug damals etwa 12.000. Unter den Besuchern befanden sich immer auch viele Indianer. Kornelius Walde, Sekretär des CSEM, war in der Regel bei allen Besuchen präsent und galt als Vertrauensmann des Staatschefs. Alle Verbindungen zum Staatspräsidenten liefen über ihn, ganz im Sinne der herrschenden politischen Verhältnisse. In den Medien wird er als „Führer aller Mennoniten Paraguays“ bezeichnet. Als solcher wurde ihm am 3. Dezember 1986 von der Regierung das „Große Verdienstkreuz für Arbeit“ („Orden del Merito de Trabajo en el Grado de la Gran Cruz“) verliehen, als „Führer dieser arbeitsamen religiösen Gemeinschaft“. Der Minister für Industrie und Handel Dr. Delfín Ugarte Centurión sagte bei dieser Gelegenheit: „Kornelius Walde ehren, heißt die Mennonitenkolonien ehren“.(38) Bei den Besuchen in den ersten Jahren knüpft Stroessner in seinen Reden meist an seine Erfahrungen im Chacokrieg an. Immer ist er des Lobes voll über die Leistungen der Mennoniten, die fürs ganze Land vorbildlich dastünden. Er hebt ihre Arbeitsamkeit, ihren Fleiß und ihre Ordnung hervor. Dann sagt er ihnen immer auch seine volle Unterstützung zu. – Die Mennoniten haben Stroessner ihre volle Unterstützung gegeben und waren gefügige und untertänige Bürger, die sich von jeglicher direkter Beteiligung und Kritik an der Politik fernhielten. Dies zu tun, hätte ihnen nur geschadet, dessen waren sie sich bewußt. Von kritischen Besuchern ist diese passive Haltung als „blinde Unterwürfigkeit“ getadelt worden. Menschenrechtliche Verbrechen von Seiten der Regierung wurden von den Mennoniten schweigsam hingenommen, um Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten irgendwelcher Art vorzubeugen.
Die enge Beziehung zwischen den Mennoniten und der Stroessnerregierung während der rund 34 Jahre Stroessnerregierung hat ungetrübt angehalten. Wie hat sich die Stroessnerregierung auf die Mennonitenkolonien ausgewirkt? Eine gründliche Umfrage in dieser Angelegenheit dürfte durchaus aufschlußreich sein. Ich persönlich habe von Mennoniten im Rückblick auf diese Zeit kaum mal Kritik an der Regierung gehört. Dagegen werden immer wieder die positiven Aspekte der Stroessnerregierung hervorgehoben: Unter der Stroessnerregierung hatten wir es gut, da herrschte Ordnung, da gab es wirtschaftlichen Fortschritt und Sicherheit. So haben die Mennoniten ihn erlebt. Stroessner war der „protector“ (Beschützer) der Mennoniten. Sie hatten durch ihren Vertreter direkten Zugang zum Präsidenten bzw. zu seinen Ministern. Bei anscheinend unlösbaren Problemen legaler oder politischer Art wandten sich die mennonitischen Vertreter an die Regierung. In der Regel wurden die Probleme kurzfristig gelöst – manchmal, leider, auf brutale Art. Stroessner war eben der „protector“ der Mennoniten. Für solchen offensichtlichen Schutz von Seiten der Regierung waren die Mennoniten dankbar und brachten diese Dankbarkeit auf sichtbare Weise zum Ausdruck. Zu Weihnachten erhielten die Regierungsleute große, geschmückte Körbe mit Käse, Wurst und anderen Produkten. Dann aber auch durch Treue, Fleiß und Gehorsam (Unterwürfigkeit) in der Lebensführung; Tugenden, die man der Regierung aus christlicher Überzeugung schuldig zu sein glaubte. Lobreden auf die Regierung waren auch unter den Mennoniten nicht unbekannt. Dies zu tun gehörte zum guten Ton. Betont wurden in diesem Zusammenhang immer wieder die großzügigen Privilegien, die die paraguayische Regierung den Mennoniten gewährt hatte und die die Mennoniten zur Untertänigkeit, zum Gehorsam und zu harter Arbeit verpflichteten, sie aber von Kritik an der Regierung abhielt. Kritik an der Regierung üben oder auch die mennonitischen Privilegien in Frage stellen wurde als Undankbarkeit gewertet, sowohl der Regierung als auch den mennonitischen Glaubensprinzipien der Wehrlosigkeit gegenüber. Inwieweit hat das Stroessnersystem auf die Mennoniten abgefärbt? Dies ist ein weiteres Thema, das sicherlich interessant wäre, wissenschaftlich erforscht zu werden. Hier nur einige persönliche Beobachtungen: Es wurde oben schon angeführt, zur Stroessnerzeit wurde keine Kritik an dem in Paraguay herrschenden Regierungssystem geduldet. In diesem Sinne wurden die Schulen im Lande strengstens überwacht. Hier ein persönliches Erlebnis. In der Goetheschule gab ich in der 9. Klasse Geschichtsunterricht. Das Textbuch der Klasse schilderte Francisco Solano López als den Helden, der Paraguay von seinem Untergang errettet habe. Ich sagte den Schülern, dass dies eine Interpretation sei, dass es aber noch eine andere gebe, die López mehr als einen Verbrecher an dem paraguayischen Staat ansehe. Nur wenige Zeit später erhielt der Direktor der Schule einen Anruf vom Erziehungsministerium mit der Aufforderung, den betreffenden Lehrer zurechtzuweisen. Dem Gebot der Stunde, nicht Kritik an der Regierung Stroessners zu üben, sind die Mennoniten nachgekommen wie wohl keine andere Gruppe oder Organisation. „Uns als Mennoniten geht es wirtschaftlich gut, weil wir uns nicht in die Politik mischen“, war das Urteil vieler Mennoniten zur Zeit Stroessners. Dies ist sicherlich einer der Gründe gewesen, weshalb Stroessner die Mennoniten so gut leiden konnte. Die Korruption zur Zeit der Stroessnerregierung hat stark auf das Geschäftsleben der Mennoniten abgefärbt. Davon wissen die mennonitischen Geschäftsleute und die Kooperativen ein Lied zu singen. Geschäftsleute in Asunción haben mir mehrfach gesagt, ohne „doppelte Buchführung“ könnten sie nicht bestehen. Dem bestehenden Wirtschaftssystem entsprechend könne kein Geschäft ohne „Fälschung“ überleben. Ohne „Schmieren“ liefe nichts. Manche Mennoniten haben da mitgemacht und sind reich geworden. Urteil eines Außenseiters aus jüngster Vergangenheit: „Erst sind die Mennoniten in Asunción durch ihre Beziehung zu Stroessner reich geworden. Jetzt sind sie fromm und brav und tun so, als ob sie nichts mit der korrupten Regierung Stroessners zu tun gehabt hätten. Man muß schon anerkennen, die Mennoniten verstehen sich anzupassen“. So ein Urteil ist zwar hart. Es sollte uns dennoch zum Nachdenken Anlaß geben.
Manche Mennoniten und Nichtmennoniten befürchteten, dass es in Paraguay nach Stroessner ein „Blutbad“ geben würde. Als „Schoßkinder“ Stroessners würden die Mennoniten dann besonders schlecht abschneiden. Man machte Vergleiche mit Rußland. Die Mennoniten selbst haben dabei auf die Ereignisse der russischen Revolution im Jahre 1917 hingewiesen. Gewisser Grund für solche Befürchtungen lag vor, aber nichts davon ist eingetroffen. Aus der engen Freundschaft mit der Stroessnerregierung sind den Mennoniten, meines Wissens, keine negative Folgen entstanden. Es gab zwar in den Jahren 1989 bis 1993 in der Presse und von Seiten einiger Parlamentarier sehr scharfe Angriffe auf die Mennoniten. Die Mennoniten stellten sich diesen harten Angriffen und waren recht erfolgreich in der Aufbesserung ihres Images. Dafür gibt es viele Beispiele. Hier nur eines: Die „Coordinadora Nacional de Iglesias“.
Die „Coordinadora Nacional de Iglesias“ ist ein vorbildliches Beispiel positiver Beteiligung der Mennoniten an der nationalen Politik. Die „Coordinadora de Iglesias Cristianas para la Asamblea Nacional Constituyente“ (so der volle Name) war ein Zusammenschluss der christlichen Kirchen in Paraguay mit der Absicht, in einigen wesentlichen Punkten Einfluß auf die Ausarbeitung der neuen Staatsverfassung zu nehmen. Schon bald nach dem Regierungswechsel 1989 sprachen sich Stimmen in der Regierung für die Schaffung einer neuen Staatsverfassung aus, die den demokratischen Zeitverhältnissen angepaßt wäre. Wie schon so oft in der Geschichte stieg bei den Mennoniten sofort die Frage auf: Was wird dann aus unseren Privilegien (Gesetz Nr. 514)? Werden sie uns erhalten bleiben? Das mennonitische Gemeindekomitee beauftragte im September 1990 einige Personen, sich intensiv mit dieser Frage zu beschäftigen. Die vom Gemeindekomitee gebildete Kommission setzte sich aus folgenden Personen zusammen: Wilhelm F. Sawatzky, Jakob Friesen, Ewald Reimer, Werner Franz und Alfred Neufeld. Einige Personen schieden später aus, andere kamen hinzu. Die Kommission begann die Arbeit mit einer anerkennenswert liberalen, aufgeschlossenen Haltung. Das geht aus einem Brief hervor, den Werner Franz am 26. Oktober 1990 an Richard Sider vom MCC, USA, schrieb, in dem um Wegweisung in dieser so wichtigen Angelegenheit gebeten wird. Franz schreibt, dass Paraguay sich in einem „Übergang zur Demokratie“ befinde. „Dieser Prozeß des politischen Wechsels hat zu einem neuen Erwachen unter den Mennoniten geführt, tiefer über unsere politische und soziale Verantwortung in der entstehenden Demokratie nachzudenken“. Dann spricht er das eigentliche Thema an – den Militärdienst bzw. die Befreiung von demselben. Er führt aus, dass in Paraguay der obligatorische Wehrdienst bestehe, dass aber die Mennoniten aufgrund des Gesetzes Nr. 514 davon befreit seien. Weiter schreibt Franz: „Unsere Absicht ist jetzt, dahin zu arbeiten, dass unsere Stellungnahme dahin führen möchte, die nationale Verfassung dahin zu verändern, dass auch andere die gesetzliche Möglichkeit haben würden, nicht den Militärdienst zu tun“. Das war ein positiver Ansatz, den man in der Mennonitengeschichte wohl kaum sonstwo findet. Es ging also nicht nur darum, wie es in Russland so kraß zum Ausdruck kam, die eigenen Vorteile („Sonderinteressen“) aufrechtzuerhalten, sondern sie allen Bürgern im Lande zugänglich zu machen. Wie dieses Ziel verfolgt wurde und was erreicht wurde, soll nun ausgeführt werden. Zunächst suchte die Kommission nach Personen in der paraguayischen Gesellschaft, die in der Frage des Militärdienstes ähnlich dachten wie die Mennoniten, wenn auch nicht auf Grund der gleichen Glaubensprinzipien. Da war es der Senator Fernando Vera, der den Standpunkt der „Reduzierung des Militärs“ vertrat. Eine weitere Person war Pastor Georg Wiley von den „Discípulos de Cristo“ und vom „Comité de Iglesias“, einem Komitee, das sich schon viel mit Fragen der sozialen Gerechtigkeit in Paraguay beschäftigt und scharf damit auseinandergesetzt hatte. Eine dritte Person war Frau Josefina de Fernández Estigarribia, die Beauftragte für Menschenrechtsfragen. Der Rechtsanwalt und Notar Dr. Lorenzo Liviéres wurde zur Mitarbeit an der Ausarbeitung eines Dokuments für die Wehrdienstbefreiung angeworben. Bei der Suche nach weiteren Unterstützern in dieser Sache fand man heraus, dass der Direktor von Radio Cáritas, dem Radiosender der katholischen Universität, „ein überzeugter Militärdienstverweigerer ist“. Selbst bei dem Präsidenten der paraguayischen Bischofskonferenz, Monseñor Liviéres Banks, fragte man an, „inwiefern die katholische Kirche an dieser Sache würde mitarbeiten wollen“. Diese und andere Kontakte wirkten fördernd und ermutigend. In der Kommission war man sich aber auch bewußt, dass sie die Unterstützung der Gemeinden für den neuen Ansatz bräuchten. Im Jahre 1991 ging man vom Gemeindekomitee aus daran, das Bewußtsein für die Wehrdienstbefreiung und die Friedenslehre in den eigenen mennonitischen Gemeinden im weiteren Sinne zu fördern. Zu diesem Zwecke vervielfältigte man das Traktat von J.A. Toews, „Unser Versöhnungsdienst in einer zerbrochenen Welt“ und verbreitete es in den Gemeinden, wo es „als Studien- und Hilfsmaterial gebraucht werden“ sollte, schreibt Franz am 2. April 1991. Zugleich sammelte die Kommission Material aus verschiedenen Ländern, wo über das gleiche Thema verhandelt worden war: Brasilien, Argentinien, MCC, UNO-Resolutionen u.a.m. Sehr ermutigend für die Kommission war dann ein Brief der katholischen Bischofskonferenz in Paraguay („Conferencia Episcopal Paraguaya“) vom 17. April 1991. Der Sekretär der Konferenz, Bischof Celso Yegros Estigarribia schrieb, dass die „katholische Kirche ganz besonders sensibel für die Förderung des Friedens und der Gerechtigkeit ist und Gewalttätigkeit als Methode zur Lösung von Konflikten“ ablehnt. Rechtsberater hatten der mennonitischen Kommission bereits vorgeschlagen, nicht im Alleingang einen Gesetzesentwurf in Bezug auf die Wehrdienstfrage auszuarbeiten. Damit würde man nicht weit kommen. Sie schlugen vor, zusammen mit anderen christlichen Kirchen im Lande diese Arbeit zu tun. Dieser Vorschlag wurde von der Kommission allen Ernstes wahrgenommen, um „im Namen einer möglichst großen Unterstützungsgruppe aufzutreten, vielleicht als Zusammenschluß verschiedener kirchlicher Institutionen“, heißt es in einer Zusammenfassung nach einem Gespräch mit dem Senator Dr. Waldovino Ramón Lovera vom 29. April 1991. Weiter schreibt Franz überzeugt: „Die Zusammenarbeit mit anderen Kirchen wäre unbedingt anzustreben. Eine interdenominationale Arbeitsgruppe würde auf alle Fälle mehr Glaubwürdigkeit haben als Vertreter einer kleinen exklusiven Gruppe“. Schließlich weist Franz auf die Tatsache hin, dass die nationale Presse mehrere Fälle von Verstößen gegen die Menschenrechte bei den Mennoniten veröffentlicht habe, wodurch „die öffentliche Meinung den Mennoniten gegenüber negativ“ eingestellt sei. Franz schlußfolgert: „Dieses bedeutet unter anderem, dass es nicht günstig sein wird, den Antrag auf Militärdienstbefreiung als einen mennonitischen Antrag aufzuziehen“ (13. Mai 1991). Mit anderen Worten, es bestand keine Möglichkeit im Alleingang das mennonitische Ziel zu erreichen. Auf Grund dieser Überlegungen wurden zum 27. Mai 1991 eine Anzahl evangelischer Gemeindevertreter und Pastoren erstmals zu einem Dialog ins Mennonitenheim eingeladen. Am 10. Juni fand dann das zweite Gespräch statt. Bald beteiligte sich auch die katholische Kirche durch ihren Vertreter an diesen Gesprächen. Die Vertreter der christlichen Kirchen Paraguays einigten sich auf vier Punkte, für deren Aufnahme in die neue Staatsverfassung sie sich einsetzen wollten:
1. Trennung von Kirche und Staat,
2. Schutz von Familie und Ehe,
3. Religions- und Gewissensfreiheit,
4. Befreiung vom Militärdienst aus Gewissensgründen.
1. Trennung von Kirche und Staat,
2. Schutz von Familie und Ehe,
3. Religions- und Gewissensfreiheit,
4. Befreiung vom Militärdienst aus Gewissensgründen.
In dem Protokoll der Gemeindekomiteesitzung vom 26. Juli 1991 heißt es zu diesen Vorschlägen: „Klar soll sein, dass wir dieses nicht als ein Mennonitenprojekt einreichen wollen, sondern als religiöse Gruppen von Paraguay“. In der Diskussion wurde auch hervorgehoben, dass man sich den Anforderungen der Zeit eben stellen müsse – es waren wohl nicht alle davon überzeugt. Unter Aufwand von viel Zeit und Energie wurden die vier Vorschläge ausgearbeitet und mit Bibelstellen, kirchlichen Aussagen und wichtigen Dokumenten der UNO belegt und in Form eines attraktiven Büchleins gedruckt. Dieses wertvolle Dokument wurde im Januar 1992 an alle 198 Mitglieder der verfassungsgebenden Versammlung („Convencionales constituyentes“) und an die Presseleute „persönlich eingehändigt“, damit es ihnen in den Plenarsitzungen der „Convención Nacional Constituyente“ als Orientierung dienen solle. Auf Einladung des Vorsitzenden der „Convención Nacional Constituyente“ Dr. Facundo Insfrán durften fünf Vertreter der „Coordinadora de Iglesias Cristianas“ an den Sitzungen der Kommission teilnehmen, um als Kontaktpersonen für auftretende Fragen zur Verfügung zu stehen. Die fünf Vertreter waren: José Valpuesta (Katholik), Armin Ihle (Lutheraner), Werner Franz (Mennonit), Cesar Acevedo (Hermanos Libres) und Osvaldo Velázquez (Baptist). Eine der umstrittensten Fragen in den Diskussionen der neuen Gesetzgebung war die der Befreiung vom Wehrdienst aus Gewissensgründen. Das Militär befürchtete dadurch eine Einschränkung seines Machtbereiches. Doch schließlich wurde die jahrelange Arbeit und das Bemühen der „Coordinadora“ um die Befreiung vom Wehrdienst aus Gewissensgründen mit Erfolg gekrönt. Artikel 129 der neuen Verfassung hält zwar am obligatorischen Militärdienst für alle paraguayischen jungen Männer fest, erlaubt dann aber doch allen wehrpflichtigen Bürgern des Landes die Befreiung von diesem Dienst aus Gewissensgründen. Trotz dieser gesetzlichen Verordnung, die allen Paraguayern zugute kommt, haben die Mennoniten immer noch einen beachtlichen Vorteil der nationalen Bevölkerung gegenüber, denn auf Grund des Gesetzes Nr. 514 von 1921 bleiben die Mennoniten auch weiter als ganze Gemeinschaft vom Militärdienst befreit. Die mennonitischen jungen Männer brauchen nicht persönlich den Wehrdienst verweigern. Das tut die Gemeinde zusammen mit der mennonitischen Verwaltung für sie. Ein Alternativdienst zu Gunsten der Zivilbevölkerung ist für die Gewissensverweigerer in der Verfassung vorgesehen, aber bis heute nicht gesetzlich geregelt und daher auch nicht eingeführt worden. Sollte in Paraguay ein stehendes Berufsheer eingeführt werden, so würde die Notwendigkeit der Regelung des Zivildienstes damit überflüssig werden. Es war das Verdienst der Mennoniten Paraguays, dass die christlichen Kirchen sich einigten, an der Staatsverfassung mitzuarbeiten. Dieser Tatbestand ist von der katholischen Kirche in ihrer Zeitschrift (39) gebührend hervorgehoben und anerkannt worden.
Mit der neuen Staatsverfassung war der Weg für eine aktive Beteiligung der Mennoniten an der Landespolitik eröffnet. Sie ist überraschend erfolgreich wahrgenommen worden.
Der in Paraguay berühmte, unlängst verstorbene Anthropologe Miguel Chase-Sardi, der durch seinen Einsatz für die Rechte der Indianer einerseits und seine Kritik an den Mennoniten andererseits zu Beginn der 1970er Jahre internationales Aufsehen erregte, schreibt 1994 anerkennend über die Mennoniten: „Die Mennoniten sind arbeitsam, friedliebend und gütig, geschäftlich und geschickt.. Sie zeichnen sich als Fortschrittler aus, und jetzt, seit der Herstellung eines Rechtsstaates im Lande, sind sie mit außergewöhnlichem Erfolg in die nationale Politik eingestiegen“.(40) Selbst die Mennoniten waren von ihrem Erfolg überrascht, und bei einigen verursachte er „theologisch-täuferische Magenschmerzen“. Doch bei zunehmendem Erfolg der Mennoniten scheinen seit den letzten Wahlen im Jahre 2003 auch die letzten Bedenken verschwunden zu sein. Wer nun noch Fragen bezüglich der Beteiligung der Mennoniten an der Politik hegt, der wagt sich wohl kaum noch, diese zu äußern. Ähnliches wie in Paraguay, was mennonitische Beteiligung an der nationalen Politik betrifft, geschah in Rußland in den Jahren 1905 bis 1917. Dort hatten die Mennoniten sich erfolgreich an der Politik beteiligt. Mit der Revolution von 1917 fand diese Beteiligung ein jähes Ende. In Kanada sind die Mennoniten seit einigen Jahrzehnten ebenfalls recht erfolgreich in die nationale und provinziale Politik eingestiegen. Aber in den genannten Ländern geschah der Einstieg in die Politik nicht so massiv und intensiv wie in Paraguay. Die Mennoniten in Paraguay stehen darin einmalig da. Worauf ist diese erfolgreiche politische Beteiligung zurückzuführen? Einmal, Paraguay ist ein kleines Land mit zur Zeit rund 5,5 Millionen Einwohnern. Die eingewanderten Mennoniten zählen etwa 30 000 Personen. Das ist etwas mehr als 0,50% der Gesamtbevölkerung. Das scheint auf den ersten Blick wenig zu sein, ist aber dennoch nach Belize der höchste Prozentsatz in der Welt. Zweitens, die Mennoniten in Paraguay, und hier ganz besonders die Mennoniten im Chaco, haben durch ihre wirtschaftlichen und kulturellen Leistungen nationales Aufsehen erregt. Die Milchprodukte der Mennoniten sind im ganzen Lande für ihre gute Qualität bekannt. Drittens muß auf den karitativen, missionarischen und kulturellen Einsatz der Mennoniten unter der nationalen Bevölkerung hingewiesen werden. Wer kennt nicht die Bedeutung des Hospital Mennonita Km 81? Einige tausend paraguayische Kinder besuchen mennonitische Missionsschulen mit dem Colegio Johannes Gutenberg als leuchtendem Beispiel. Inzwischen bekennen sich etwa 5000 Lateinparaguayer zum mennonitischen Glauben. Eine Gemeinde dieser spanischsprachigen Mennoniten ist „Raices“, in der Gloria Penayo de Duarte, die Frau des Landespräsidenten Nicanor Duarte Frutos, Gemeindeglied ist. Alle diese Faktoren und andere mehr haben den Weg für die Empfänglichkeit und die aktive Beteiligung der Mennoniten an der Politik vorbereitet. Die ersten mennonitischen Politiker erregten besonderes Interesse in den nationalen Medien: Cornelius Sawatzky, erster mennonitischer Gouverneur von Boquerón, Heinz Ratzlaff, Diputado Nacional (Volksvertreter) und Orlando Penner, zweiter Gouverneur von Boquerón. Sie waren auch die ersten Evangelischen in Paraguay, die so hohe politische Ämter bekleideten und bis heute halten die Mennoniten das Monopol der politischen Beteiligung unter den evangelischen Gemeinden in Paraguay. Auch einmalig in der Welt. In ABC-Color, der größten Tageszeitung Paraguays, vom 30. Juni 1994 heißt eine Schlagzeile: „Gouverneur Sawatzky fordert eine aufrichtigere Gesellschaft“. Dann heißt es dort, dass anläßlich eines Besuches des Staatspräsidenten Juan Carlos Wasmosy im Chaco der mennonitische Gouverneur den Staatspräsidenten aufforderte, „die Korruption in allen Bereichen zu beseitigen, das Wohl aller zu suchen und eine ehrliche Gesellschaft zu schaffen“. Der mennonitische Parlamentsabgeordnete, Heinrich Ratzlaff erntete Bewunderung und Anerkennung wegen seiner klaren, ethischen und christlichen Prinzipien, die von der Presse veröffentlicht wurden. Die größte Publizität in den Massenmedien erntete Orlando Penner für seine Tätigkeit als Gouverneur und seine Konfrontation mit dem Präsidenten Luis González Macchi in Sachen des Aquaeduktes in den Chaco. In den Massenmedien erscheinen die Mennoniten immer öfter als Vorbilder. Warum haben wir keinen Mennoniten als Wegebauminister? fragt ein Reporter in Radio Cardinal, als er nach einem Regen vor einer Wegschranke im Departamento San Pedro festsaß. In den mennonitischen Kolonien gibt es diese lästigen Wegschranken nicht, rief er ins Radio. Ja, und wie wär’s mit einem Mennoniten als Präsidenten? Auch dieses Thema wurde in den Medien aufgegriffen und von Einzelnen öffentlich und privat angesprochen. Und schließlich kommt in den Medien sogar der Vorschlag, Paraguay zu „mennonitisieren“.(41) Das mennonitische Verwaltungsmodell wird als vorbildliches politisches System vorgeschlagen. Pedro Fadul, Präsidentschaftskandidat für „Patria Querida“, versuchte mit dem Schlagwort Mennonit und Orlando Penner Stimmen zu gewinnen. Nach seinem Wahlsieg hat Nicanor Duarte Frutos die Mennoniten ernstgenommen, indem er mehrere Mennoniten in höchste Regierungsposten eingesetzt hat. Die Frage ist daher berechtigt: Wird Paraguay „mennonitisiert“ werden? Können und wollen die Mennoniten das spezifisch Christliche: die Hungernden sättigen (d. h. den Landlosen Land verschaffen), den Arbeitslosen Arbeit geben, brüderlich teilen, für Gerechtigkeit (soziale Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit) eintreten, Wehrlosigkeit durchsetzen, also für eine möglichst gewaltfreie Politik sorgen in die Politik einbringen, oder wollen sie nur ihre Interessen und die der ohnehin schon relativ Begüterten wahren? Andererseits: Wie wirkt sich die Beteiligung an der Politik und die Nähe zu den Mächtigen auf den Glauben, die Haltung gegenüber der Politik auf die Gemeinde aus? Wie weit besteht die Gefahr, dass der Glaube, d.h. der nach außen gezeigte Glaube und die Gemeindezugehörigkeit mißbraucht werden, um seine Machtposition zu festigen bzw. politischen Einfluß zu gewinnen? Besteht nun andererseits auch die Gefahr, dass die mennonitischen Gemeinden „politisiert“ werden?
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Bibliographie:
- Bender 1939 = Bender, Harold S. „Church and State in Mennonite History“. The Mennonite Quarterly Review, Vol. XIII, April 1939, S. 104-122.
- Bender 1946 = Bender, John E. Paraguay Calling. Part Two: The Mennonite colonies in Paraguay. Mennonite Central Committee [Akron, Pennsylvania, 1946]
- Braun 2001 = Braun, Jacob A. Im Gedenken an jene Zeit: Mitteilungen zur Entstehungsgeschichte der Kolonie Menno. Herausgegeben vom Geschichtskomitee der Kolonie Menno, Loma Plata/Kolonie Menno, 2001.
- Cardozo 1996 = Cardozo, Efraím. Breve historia del Paraguay. Asunción, El Lector, 1996.
- Croatto 1983 = Croatto, J. Severino et al. Democracia: Una opción evangélica. Ediciones Aurora, Buenos Aires, 1983.
- Deiros 1986 = Deiros, Pablo. Los evangélicos y el poder político en América Latina. Nueva Creación, Grand Rapids – Buenos Aires, 1986.
- Dengerink 1977 = Dengerink, J. D. und Grau, J. El cristianismo y la democracia moderna: El fundamento bíblico de la democracia. Ediciones Evangélicas Europeas, Barcelona, 1977.
- Dyck 1981 = Dyck, Abe. „Church and State: Developments among Mennonite Brethren in Canada since World War II“. Direction, X, Juli 1981, S. 30-47.
- Elliott 1931 = Elliott, Arthur Elwood. Paraguay: Its Cultural Heritage, Social Conditions and Educational Problems. Teachers College, Columbia University, New York, 1931.
- Escobar 1991 = Escobar, Samuel. „Opresión y justicia“, Boletín Teológico, 23. Jg., Nr. 42/43, September 1991, S. 109-154.
- Friedenslehre 1994 = Wir und der Staat: Unser Verhalten als Christen im Bereich der Politik und der Regierung gegenüber. Herausgegeben vom Komitee für Friedenslehre und dem Gemeindekomitee der Mennoniten Paraguays, 1994.
- Friesen 1977 = Friesen, Martin W. Kanadische Mennoniten bezwingen eine Wildnis: 50 Jahre Kolonie Menno, erste mennonitische Ansiedlung in Südamerika. Verwaltung der Kolonie Menno, Paraguay, 1977.
- Friesen 1983 = Friesen, Martin W. Mennonitische Kolonisation im paraguayischen Chaco unter Gesetz Nr. 514. Im Auftrage der Kolonie Menno und der Konferenzleitung der Mennonitengemeinden von Menno, Loma Plata, Dezember 1983.
- Friesen 1987 = Friesen, Martin W. Neue Heimat in der Chacowildnis. Chortitzer Komitee, Asunción, Paraguay, 1987.
- García 2000 = García, Carlos Martínez. La Participación Política de los Cristianos Evangélicos. Publicaciones El Faro S.S. de C.V., México, 2000.
- Gehrmann 1999 = Gehrmann, Jens. Rückbesinnung?: Der soziale Wandel bei den deutschstämmigen Mennoniten im paraguayischen Chaco. Schriftliche Hausarbeit zur Erlangung des Grades eines Magister Artium (M.A.) der Philosophischen Fakultät der Christian Albrechts-Universität zu Kiel, 1999.
- Gehrmann 2000 = Gehrmann, Jens. „Modernisierung und Tradition: Sozialer Wandel bei den Mennoniten in Paraguay“. Mennonitische Geschichtsblätter. 57. Jg., 2000, S. 99-128.
- Goertz 2002 = Goertz, Hans-Jürgen. Das schwierige Erbe der Mennoniten. Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, 2002.
- Klassen 1975 = Klassen, Peter P. Kaputi Mennonita: Eine friedliche Begegnung im Chacokrieg. Filadelfia, Chaco, Paraguay, 1975.
- Klassen 1988 = Klassen, Peter P. Die Mennoniten in Paraguay: Reich Gottes und Reich dieser Welt. Mennonitische Geschichtsverein e.V., Bolanden-Weiherhof, 1988.
- Klassen 1990 = Klassen, Peter P. Die deutsch-völkische Zeit in der Kolonie Fernheim Chaco, Paraguay 1933-1945: Ein Beitrag zur Geschichte der auslandsdeutschen Mennoniten während des Dritten Reiches. Mennonitischer Geschichtsverein e V., Bolanden-Weierhof, 1990.
- Krier 1973 = Krier, Hubert. Tapferes Paraguay. Marienburg Verlag, Würzburg, 1973.
- Martinez 1995 = Martínez, José Luis. Los evangélicos y la política: Preguntas y respuestas. Editorial Mundo Hispano, El Paso, Texas, 1995.
- Martínez 2000 = Martínez García, Carlos. La participación política de los cristianos evangélicos. Publicaciones El Faro S.A. de C.V., México, 2000.
- Mennoniten 2000 = Mennoniten in Paraguay am Tor des dritten Jahrtausends. Asociación de Colonias Mennonitas del Paraguay, Asunción, 2000.
- Neues für Alle 1997 = „Neue christliche, politische Bewegung (Partei) in Paraguay: Fragen und Antworten an den Parlamentarier Ratzlaff“. Neues für Alle, 5. September 1997, S. 35.
- Neufeld 1997 = Neufeld, Peter K. Die Stellung des Christen zu Staat und Schwert. Selbstverlag, Filadelfia, Paraguay, 1997.
- Neufeld 1995 = Neufeld, Peter K. „Der Christ und seine politische Aktivität: Podiumsgespräch bei einem Treffen des Grupo Universitario“, Filadelfia, 28. Mai 1995.
- Padilla 1981 = Padilla, C. René (Hrsg). De la migración al compromiso: Los evangélicos y la política en América Latina. Fraternidad Teológica Latinoamericana, Argentina y Ecuador, 1981.
- Padilla 1997 = Padilla, C. René. Discípulos y misión. Kairós, Buenos Aires, 1997, Kap. 34 „Llamados a ‘cristianizar’ la política“, S. 135-141.
- Ratzlaff 1993a = Ratzlaff, Gerhard. Entre dos fuegos: Los Mennonitas en el conflicto limítrofe entre Paraguay y Bolivia 1932-35. Asunción, Paraguay, 1993.
- Ratzlaff 1993b = Ratzlaff, Gerhard (Hrsg). Die Mennoniten in Paraguay: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Studienkonferenz der Mennoniten in Paraguay. Abgehalten im Instituto Bíblico Asunción vom 1. bis 5. Februar 1993, Asunción 1993. Die Schrift enthält alle Vorträge der Konferenz.
- Redekop 1972 = Redekop, John H. Making Political Decisions: A Christian Perspective. Herald Press, Scottdale , Pennsylvania, 1972.
- Redekop 1973 = Redekop, Calvin. „A State within a Church“. The Mennonite Quarterly Review, Vol. XLVII, Oktober 1973, S. 339-357.
- Redekop/Redekop 2001 = Redekop, Benjamin W. und Redekop, Calvin Power, Authority and the Anabaptist Tradition. The John Hopkins University Press, Baltimore und London, 2001.
- Redekop 1983 = Redekop, John H. „Mennonites and Politics in Canada and the United States“. Journal of Mennonite Studies. 1. Jg., 1983, S. 79-105.
- Redekop 1993 = Redekop, John H. „Church and State: The Boundaries Blurs“. Mennonite Central Committee Peace Office Publication, September – Oktober 1993, 23. Jg., Nr. 5. S. 10-12.
- Regehr 1976 = Regehr, John. „Jesus and the State“. Direction, Vol. V, Juli 1976, S. 30-33.
- Regehr 2000 = Regehr, T.D. Peace, Order & Good Government: Mennonites & Politics in Canada. CMBC Publications, Winnipeg, Manitoba, 2000.
- Sawatzky 1996 = Sawatzky, Adolf S. „Origen, evolución e inserción de la Colonia Menno a la sociedad paraguaya“, unveröffentlichte Staatsexamenarbeit, Universidad del Norte, Asunción, 1996.
- Schoenrich 1940 = Schoenrich, Edwin. The Mennonite Colonies in the Paraguayan Chaco: Part I and II. 1940. Ein Bericht über die Mennoniten im paraguayischen Chaco von der amerikanischen Botschaft in Asunción, Paraguay.
- Sider 1982 = Sider, Ronald J. Jesus und die Gewalt. Agape Verlag, Maxdorf, 1982.
- Smissen 1895 = Smissen, Carl H.A. van der. Kurzgefaßte Geschichte und Glaubenslehre der Altevangelischen Taufgesinnten oder Mennoniten, Illinois, im Selbstverlag des Verfassers, 1895.
- Snyder 1995 = Snyder, C. Arnold. Anabaptist History and Theology: An Introduction. Pandora Press, Kitchener, Ontario, 1995.
- Stach 1904 = Stach, Jakob. Die deutschen Kolonien in Südrußland: Kulturgeschichtliche Studien und Bilder über das erste Jahrhundert ihres Bestehens. Verlag von Gottlieb Schaad, Prischib, 1904.
- Stahl 1980 = Stahl, Wilmar. „Integration der Mennoniten in Paraguay“. 50 Jahre Kolonie Fernheim: Ein Beitrag in der Entwicklung Paraguays. Herausgegeben von der Kolonie Fernheim, Filadelfia, 1980, S. 233-273.
- Walter 1994 = Walter, Ralf. Evangelium ist nicht Politik: Überlegungen zur politischen Theologie. Hänssler Verlag, 1994.
- Warkentin 1972 = Warkentin, Jakob. „Bestimmt das Privilegium unser politisches Handeln“? In: Walter Regehr. 25 Jahre Kolonie Neuland Chaco Paraguay (1947-1972): Eine Gedenkschrift zum fünfundzwanzigjährigen Jubiläum. Herausgegeben im Auftrage der Kolonieverwaltung, gedruckt bei Heinrich Schneider in Karlsruhe, 1972, S. 78-83.
- Wiens 1998 = Wiens, Arnoldo. Los Cristianos y la corrupción: Desafíos de la corrupción a la fé cristiana en América Latina. Editorial CLIE, Barcelona, 1998.
- Yoder 1981 = Yoder, John H. Die Politik Jesu – der Weg des Kreuzes. Agape Verlag, Maxdorf, 1981.
Fussnoten:
Lehrer und Archivar am Instituto Bíblico Asunción. | |
Der große Brockhaus 1956, S. 273 und Martínez 2000, S. 9-10. | |
vgl. Martínez 2000, S. 61-69; Wiens 1998, S. 202. | |
Der große Brockhaus 1956, S. 273. | |
Macht, Sicherheit, Friede, Gerechtigkeit, allgemeine Wohlfahrt usw….“ S. 273. | |
Elliott 1931, S. 15 und S. 87. | |
ebd., S. 189. | |
ebd., S. 18 und 190. | |
ebd., s. 183. | |
ebd., S. 19. | |
ebd., S. 18. | |
ebd., S. 25. | |
ebd., S. 33-34. | |
ebd., S. 43. | |
ebd., S. 68. | |
Elliott 1931, S. 131. | |
„I have found the promised Land“, Friesen, 1987, S. 61. | |
Friesen 1987, S. 63. | |
Bender 1946. | |
Bender 1946, S. 18. | |
ebd., S. 19. | |
Friesen 1987, S. 104. | |
Ratzlaff 1998, S. 19 – 21. | |
„The blond men in the Chaco“ S. 27; vgl. Ratzlaff 1993, S. 15. | |
Ratzlaff 1993, S. 9. | |
Ratzlaff 1993a, S. 10. | |
Friesen 1977, S. 6. | |
Klassen 1988, S. 51. | |
Klassen 1975, S. 63-64. | |
„Peaceful Pawns in the Chaco Conflict“, S. 1173. | |
Mennoblatt, den 16. Januar 1974, S. 5. | |
Mennoblatt, August 1935, S. 5. | |
Braun 2001, S. 92-93. | |
Menno-Blatt, Juni 1933, S. 2. | |
Ratzlaff 1998. | |
Mennonitische Geschichtsblätter, 1955, S. 44-46; Ratzlaff 1988, S. 103-106; Mennoblatt, November 1954. | |
November 1956, S. 6. | |
vgl. Mennoblatt, 16. Dezember 1986, S. 9. | |
März 1992, S.11; vgl. Ratzlaff 1996, S. 17 und 23. | |
Shell Paraguay, Jahreskalender 1994. | |
„Radio Cáritas“ am 2. August 2001. |
Nachwirkungen der Erfahrungen in der „völkischen Zeit“ auf die pädagogischen und politischen Haltungen in Fernheim
Jakob Warkentin
Einleitung
Reden und schreiben über die sogenannte völkische Zeit war lange Zeit in Fernheim verpönt, zeitweilig sogar verboten. Mittlerweile sind mehrere Publikationen erschienen, die jeden an Geschichte interessierten Leser über die Ereignisse dieser spannungsreichen Zeit ausreichend informieren. Einige dieser Veröffentlichungen seien hier genannt.
Als erstes ist das Manuskript von Johan Sjouke Postma zu nennen, das 1948 imAuftrag von Fritz Kliewer in Asunción verfasst und 1952 nochmals überarbeitet wurde. Das Manuskript basiert auf Kliewers Privatarchiv und war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Ein Exemplar wurde allerdings Kornelius Krahn zur Aufbewahrung im Mennonitischen Archiv beim Bethel College übergeben mit der Auflage, es geheim zu halten. Krahn hielt sich jedoch nicht an diese Auflage und verkaufte später einige Exemplare an interessierte Personen. Diese Arbeit, die eine Menge Detailmaterial enthält, erhob keineswegs den Anspruch, eine wissenschaftlich ausgewogene Darstellung der damaligen Ereignisse zu sein.
1960 veröffentlichte Manfred Kossok einen Aufsatz über die „völkische Zeit“ in Fernheim in der „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft“, die in der ehemaligen DDR herausgegeben wurde. Adalbert Goertz hatte in einem Literaturbericht in den „Mennonitischen Geschichtsblättern“ auf diesen Aufsatz aufmerksam gemacht hatte. Dieser Aufsatz mit dem Titel „Die Mennoniten-Siedlungen Paraguays in den Jahren 1935-1939 (Zur politischen Rolle der Auslandsdeutschen in Südamerika)“ fand seinerzeit bei den paraguayischen Mennoniten kaum Beachtung. Er war zwar einseitig und unter einem ganz spezifischen Blickwinkel geschrieben worden, quellenmäßig aber gut abgesichert.
1974 schrieb Gerhard Ratzlaff im Rahmen seines Geschichtsstudiums eine Magisterarbeit an der California State University in Fresno mit dem Thema „An Historical-Political Study of the Mennonites in Paraguay“. Ratzlaff hatte ausführliche Quellenstudien in den mennonitischen Archiven in Nordamerika betrieben und war um eine möglichst objektive Darstellung bemüht. Diese Arbeit sollte ebenfalls unter Verschluss bleiben und nur mit Erlaubnis des Autors oder des Professors, unter dessen Anleitung er die Arbeit verfasst hatte, eingesehen werden. Doch diese Bedingung wurde ebenfalls nicht eingehalten, so dass interessierte Personen diese unveröffentlichte Arbeit auf Wunsch einsehen konnten.
Eine weitere Magisterarbeit wurde 1985 von John D. Thiesen an der Wichita State University mit dem Titel: „A Case Study of National Socialism among foreign Germans: Paraguay, 1927-1944“ verfasst. Diese Arbeit stand interessierten Personen in vervielfältigter Form zur Verfügung.
Bereits 1979 hatte Hans (Juan) Neufeld ein Manuskript mit dem Titel „Affäre Dr. Fritz Kliewer in Fernheim – Wie es war“ angefertigt und mennonitischen Archiven in Nordamerika zur Aufbewahrung übergeben. Kopien dieser polemisch gehaltenen Verteidigungsschrift gerieten in Umlauf, noch ehe sie 1988 in Druck gegeben wurde.
In Fernheim war lange Zeit, sieht man von einigen Zeitungsartikeln ab, die zum Teil viel Staub aufwirbelten, diese dramatische Zeit verschwiegen und verdrängt worden. Ein erstes Anzeichen von Liberalisierung in dieser Angelegenheit trat ein, als 1990 der langjährige Oberschulze Heinrich Dürksen in seinen Lebenserinnerungen ein Kapitel mit dem Thema „Die völkische Bewegung in Fernheim“ veröffentlichte. Das war notwendig und mutig zugleich.
Damit war der Bann gebrochen. Im gleichen Jahr publizierte Peter P. Klassen das Buch: „Die deutsch-völkische Zeit in der Kolonie Fernheim 1933-1945“, das eine sehr ausführliche und objektive Darstellung der Ereignisse enthält, soweit das für einen Zeitgenossen im Rücblick möglich ist.
1992 veröffentlichte Peter Wiens in seiner „Geschichte der KfK in Fernheim“ ein kurzes Kapitel über die Folgen der deutsch-völkischen Zeit, das man sich gerne ausführlicher gewünscht hätte.
1995 behandelte ich die deutsch-völkische Zeit in Fernheim im Rahmen meiner Dissertation über die deutschsprachigen Siedlerschulen in Paraguay, die 1998 veröffentlicht wurde.
Die letzte ausführliche und sehr gut dokumtentierte Publikation über diese spannungsreiche Zeit in Fernheim hat John D. Thiesen mit seiner Doktorarbeit „Mennonite and Nazi. Attitudes Among Mennonite Colonists in Latin America, 1933-1945“ vorgelegt, die besser ist, als es der reißerische Titel verheißt.
Da nun eine Reihe von Publikationen über diese oft als mysteriös empfundene Zeitspanne erschienen sind, können wir, so meine ich, nun auf nüchterne Art und Weise über die Auswirkungen dieser dramatisch ablaufenden Erfahrungen jener Jahre sprechen und schreiben. Ich werde im Folgenden versuchen, unter einer sozialpsychologischen Fragestellung erste historisch begründete Antworten zu finden. Es geht mir also in meinen Ausführungen nicht darum darzustellen, wie alles gewesen ist, sondern darüber zu reflektieren, ob und inwieweit diese weitgehend unbewältigte Vergangenheit das Denken und Reden der Fernheimer Bürger gefangen hält. Ich will nicht im Einzelnen aufzeigen, welche nationalsozialistischen Elemente in Fernheim heute noch feststellbar sind, sondern wie die Erfahrungen der damaligen Zeit auf pädagogischem und politischem Gebiet in den letzten Jahrzehnten in dieser Kolonie eine Rolle gespielt haben und möglicherweise immer noch spielen.
Mancher Zuhörer mag sich nun fragen, wieso ich mir anmaße, über diese Dinge zu sprechen, obwohl ich weder in den Jahren vor 1945 noch in der unmittelbaren Zeit danach in Fernheim gewesen bin. Als Historiker weiß ich, dass Zeitzeugen bei der Rekonstruktion und Interpretation von Geschichte eine bedeutende Rolle spielen. Ebenso bin ich mir dessen bewusst, dass Zeitzeugen oft nur einen schmalen Ausschnitt von den Gesamtereignissen wahrgenommen haben und dass der unbeteiligte Historiker, der es im Laufe seines Studiums gelernt hat, sich in andere Orts- und Zeitverhältnisse zu versetzen, unter Rückgriff auf das verfügbare Material sich durchaus einen guten Einblick und Überblick über wichtige Zeitereignisse erarbeiten kann. Hermann Röhrs sagt, dass der interpretierende Historiker oft einen besseren Überblick als die Beteiligten selbst habe, da er „nicht mehr im unruhigen Strom, sondern bereits am sicher erhöhten Ufer stehe“, und fügt dann warnend hinzu, er werde „trotz des sachlichen Engagements und der persönlichen Teilhabe stets zurückfinden müssen in eine distanziert abwägende, objektive Form.“ Das habe ich mir bei der Erarbeitung dieser Thematik zu Herzen genommen.
Bei meinen Überlegungen und bei meiner Darstellung gehe ich von der Annahme aus, dass Fernheim sich seit den dreißiger Jahren in einem Rollenkonflikt befindet. Zunächst übernahm es die Rolle des „Musterschülers“, dann die Rolle des Versagers. Es sollte nun den Mut haben, so zu sein, wie es ist.
1. In der Rolle des „Musterschülers“
Die Fernheimer haben sich die Rolle des Musterschülers nicht ausgesucht. Sie wurde ihnen von außen aufgedrängt und schließlich fügten sie sich darin und fanden gelegentlich sogar Gefallen daran. Wer hat sie für diese Rolle ausgesucht? Da ist in erster Linie der liebe Gott zu nennen, das MCC sowie Deutschland durch seine verschiedenen Vertreter und schließlich das neue Vaterland Paraguay.
Die Fernheimer Siedler, die nach eigenem Verständnis durch Gottes Hilfe, aber auch durch den Einsatz der deutschen Regierung 1929 in Moskau vor der Deportation bewahrt worden waren und denen die Ausreise nach Deutschland ermöglicht wurde, fühlten sich stets zur Dankbarkeit gegenüber Gott und dem Deutschen Reich verpflichtet.(3) Noch heute wird der 25. November alljährlich als Tag der „Erinnerung an die Rettung aus der Sowjetunion“ in der ganzen Kolonie gefeiert. Diese zweifache Dankbarkeit führte aber auch zu einer doppelten Verpflichtung. Von Anfang an fühlten sich die Siedler wie auf einem Präsentierteller, wo sie sich gegenüber Gott als ihrem Vater und dem Deutschen Reich als ihrer Mutter zu bewähren hätten. Dieses Bewusstsein ihrer herausgehobenen Rolle im Chaco verlieh ihnen einerseits Mut und Durchsetzungskraft, hinderte sie aber andererseits daran, gelassen und kreativ in Konfliktfällen zu reagieren.
B. H. Unruh, selber Mennonit, der aus Russland stammte und sich als Fürsprecher bei den deutschen Behörden für die Fernheimer Siedler in besonderer Weise eingesetzt hatte(4), schrieb als ihr Betreuer und Ratgeber in der Ansiedlungszeit: „Bleiben Sie dessen immer eingedenk, dass das Auge der Welt, besonders auch der Deutschen, auf Sie gerichtet ist. Sollten Sie den Nachweis erbringen, dass im Chaco kolonisiert werden kann, so würde das auch für die Auswanderung aus Deutschland von unberechenbarer Bedeutung sein.“(5)
Die Anfangserfolge blieben dann auch der paraguayischen Regierung nicht verborgen. So lesen wir in einer vom paraguayischen Wirtschaftsministerium 1934 herausgegebenen Schrift:
- „Die MENNONITENKOLONIEN im Chaco Paraguays: sie sind das Sinnbild höchster Schaffenskraft, eisernen Willens und eines unerschütterlichen Glaubens an den Segen der Arbeit. Jedermann weiss, wer sie sind, diese bescheidenen Siedler, die sich selbst verleugnend ihre Hütten im Herzen des Chaco errichten; doch nicht jeder kennt die Grossartigkeit ihres Werkes. Dort sieht man sie, Hand am Pfluge furchenziehend als Sendboten des Fortschritts fruchtbare Erde für die Wirtschaft des Landes erschliessen. Edle Früchte spriessen aus ihren Aeckern.“
Das MCC hatte in der Anfangszeit keine Einwendung dagegen, dass die Mennoniten in Fernheim sich immer mehr als Deutsche zu begreifen begannen. Als 1937 die späteren Friesländer die Kolonie verließen, schrieb G. G. Hiebert, der die Fernheimer bei der Ansiedlung betreut hatte:
- „Haltet durch um eurer und eurer Kinder wegen! Denn wir, eure amerikanischen Brüder, haben ja wirklich ein persönliches Interesse daran. Nur wenn noch der weitaus größte Teil der Ansiedlung zusammenhält, kann noch alles gut werden. Lasst euch das Beispiel unserer Volksgenossen leuchtend vorangehen. Sie haben durchgehalten! Und heute? Zwar haben sie große wirtschaftliche Fragen und gegen die Welt von Feinden anzukämpfen; aber der Sieg ist garantiert. Ich glaube fest: am deutschen Wesen wird noch einmal die Welt genesen. Darum haltet durch! ist mein Appell an Alle!“
Es ist schon erstaunlich, wenn ein früherer amerikanischer MCC-Verteter zu diesem Zeitpunkt solche Worte den Fernheimern schrieb, denn damals war Hitler bereits vier Jahre im Amt. H.S. Bender, der neben B.H. Unruh der Hauptverantwortliche für die Einwanderung der Fernheimer Mennoniten nach Paraguay war, hatte bereits auf der Welthilfskonferenz in Danzig 1930 bekannt: „Ich bin Amerikaner bis zu den Zähnen, ich bin kein Deutscher. Ich bin aber dafür, dass die neuen Mennoniten-Siedlungen deutsch sind und bleiben. Wir amerikanischen Mennoniten werden darauf hinarbeiten, dass diese neuen Ansiedlungen ganz und gar deutsch bleiben und sich weiter in dieser Richtung entwickeln.“(8)
Die Fernheimer hatten daher keinerlei Bedenken als sie bereits im Mai 1933 in Form einer Selbstdarstellung dem Führer des Deutschen Reiches Adolf Hitler eine Sympathiebekundung zukommen ließen, die sowohl von der Kolonieleitung als auch von der KfK unterzeichnet war. Man kann darüber spekulieren, welche Beweggründe letztlich dahinter steckten, auf jeden Fall diente sie dazu, sich beim Führer in ein gutes Licht zu setzen. Darin heißt es u.a.:
- „Mit größter Spannung verfolgen auch wir deutsche[n] Mennoniten des paraguayischen Chaco die Ereignisse in unserem lieben Mutterlande und erleben die nationale Erhebung des deutschen Volkes im Geiste mit. Wir freuen uns, dass nach langer Zeit in Deutschl. wieder eine Regierung an der Spitze des Volkes steht, die sich frei und offen zu Gott, als dem Weltenlenker bekennt, der auch unser geknechtetes und zerschlagenes Volk wieder zu neuer Blüte führen kann, wenn es sich auf seine heiligsten Güter besinnt und den Weg zu dem Urquell aller Kraft zurückfindet. Mit besonderer Anteilnahme hören wir auch davon, dass es die jetzige Reichsregierung mit der Verwirklichung der christlichen Grundsätze im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben ernst nimmt und den Schutz der Familie, als der Grundlage der gesamten Volksgemeinschaft und des Staates, besonders betont …
- Wir erlauben uns deshalb in dieser Weise unsere Gefühle über die nationale Erhebung in Deutschland zum Ausdruck zu bringen und ein Treuebekenntnis zum deutschen Volke, zu dem wir der Abstammung und der Sprache nach gehören, abzulegen, ohne dabei zu vergessen, dass wir treue Bürger unseres neuen paraguayischen Vaterlandes sein wollen, das uns in so hochherziger Weise Gastrecht gewährte. Man soll aber auch in Deutschland wissen, dass mitten im tiefen Urwald des Gran Chaco, abseits von jeglicher Zivilisation und Kultur, ein kleiner deutscher Volkssplitter siedelt, der die Fahne des Deutschtums hochhält und sich mit der großen Mehrheit des deutschen Volkes in den Erneuerungsbestrebungen eins weiß.…“
Dieses Dokument zeigte, dass man in Fernheim Adolf Hitler und seine Regierung als Garanten für den Erhalt des christlichen Glaubens, der Familie und des deutschen Volkes sah. Man war überzeugt, dass nur eine starke Regierung dem Kommunismus Paroli bieten könne. Deutschland, dem Mutterland, fühlte man sich emotional verbunden, doch rationale Gründe sprachen für das neue Vaterland Paraguay. Die Überbrückung der räumlichen Trennung vom „geliebten Mutterlande“ war offenbar nur möglich, indem man das eigene Schicksal als Pioniertat, auch für Deutschland, interpretierte. Mit Deutschland wollte man in ständiger Verbindung bleiben, und deutsche Tugenden und Werte sollten in Erziehung und Unterricht vermittelt werden.
Dieses in dem Dokument vermittelte Selbstbild wurde in der Folgezeit jedoch von auswärtigen Besuchern differenzierter gesehen bzw. ganz in Frage gestellt. Ein ausgewogenes und objektiv-wohlwollendes Urteil über die Mennoniten in Paraguay wurde von der deutschen Gesandtschaft in Asunción gefällt. In einem Schreiben an das Auswärtige Amt aus dem Jahre 1938 heißt es:
- „Von den Ideen des Nationalsozialismus und des Dritten Reiches sind sie noch weit entfernt. Bewusst und absichtlich haben sie sich vor 150 Jahren von Deutschland losgesagt. Sie haben stets nur daran gedacht, dass sie sich ihre kleine Gemeinschaft, ihre Religion, Gebräuche und Sitten erhalten konnten, und sie haben zu diesem Zweck alles getan, was ihre Klugheit hierfür als dienlich erkannt hatte. Sie haben die Bilder des russischen Kaiserpaares an ihren Schulwänden hängen gehabt, sie haben Russisch gelernt, weil dies nötig und nützlich war, und würden es überall wieder ähnlich machen. In allen Kolonien, von Menno abgesehen, wird jetzt eine Liebe zum Deutschtum und eine Begeisterung für das Dritte Reich zur Schau getragen, die zweifelsohne nicht unecht ist, die aber doch etwas übertrieben wirkt, weil man sich des Gedankens nicht erwehren kann, dass fast alle dieser Leute in erster Linie doch nur für ihre kleine Gemeinschaft wirken und arbeiten wollen. Ihr ungestörtes Eigenleben ist ihr Ideal. Und wenn heute alle Länder für sie frei wären und überall günstige Bedingungen für sie herrschen würden, ich glaube kaum, dass sie freiwillig nach Deutschland gehen würden, sondern sie würden nach Russland zurückkehren, wo sie Generationen lang ein glückliches und prosperierendes Dasein geführt haben.“
Keineswegs wohlwollend, sondern einseitig kritisch beurteilte hingegen Professor Wilhelmy die Bewohner Fernheims. Er machte ihnen zum Vorwurf, dass sie aufgrund ihrer Sonderrechte einen Staat im Staate bildeten, in dem die Prediger und Schulzen regieren würden. Über ihre Einstellung zu Deutschland meinte er, Unterschiede zwischen der Führungsschicht und der Bauernschaft feststellen zu können:
- „In ihrer Stellung zum neuen Deutschland unterscheiden sich die führenden Persönlichkeiten von der Koloniebevölkerung. Während der unwissende, aber religiös fanatische Bauer aus seiner ablehnenden Haltung keinen Hehl macht, versuchen Prediger und Schulzen mit Gesandtschaft und Konsulat freundschaftlich zusammenzuarbeiten. Die negative Einstellung der großen Masse der Kolonisten zum Nationalsozialismus entspringt religiösen Beweggründen: Wehrhaftigkeit ist nach ihrer Ansicht unchristlich, die Ableistung des Wehrdienstes und der Einsatz des Lebens im Kriegsfall die schwerste Sünde. Der sich in den Handlungen unseres Führers und seiner Mitarbeiter ausprägende Wille zur Tat und zur Leistung widerspricht nach mennonitischer Auffassung der Forderung christlicher Demut ‘nicht unser Wille, sondern Gottes Wille geschehe!’… So blühen in dem theokratischen Mennostaat Pharisäertum und innere Unehrlichkeit. Begrüßungstelegramme an den Führer, Erdnußsendungen an den Ministerpräsidenten Göring und den VDA stehen in krassem Gegensatz zur tatsächlichen völkischen und politischen Haltung der Mennoniten.“
Dieser Bericht schlug ein wie eine Bombe, denn er stellte das Bild der Fernheimer, das sie der Reichsregierung übermittelt hatten, grundsätzlich in Frage. Sofort wurden Freunde und Helfer mobilisiert, um mit vereinten Kräften das Bild des deutschen „Musterschülers“ wieder herzustellen. In Deutschland schrieb F. Kliewer am 18.11.1937 einen ausführlichen Brief an den Landesleiter des VDA Landesverbandes Weser-Ems, Studienrat Hoffmann, in Bremen, in dem er Wilhelmy Punkt für Punkt korrigierte oder Widerspruch einlegte. Über das Verhältnis von Mennonitentum und Deutschtum erklärte er: „Nach Auffassung des Chacosiedlers bedeutet Mennonit sein soviel wie Christ und Deutscher sein.“(12) Und über die Einstellung der Siedler zum Nationalsozialismus: „Wie überall in den auslanddeutschen Volksgruppen haben wir auch dort einige, die gleichgültig oder abwartend dem Nationalsozialismus gegenüberstehen. Es gibt auch Siedler, die ab und zu Opposition gegen die starke Betonung des Deutschtums und des Nationalsozialismus machen. Mit fliegenden Fahnen ist der mennonitische Bauer noch nie zu einer neuen Richtung übergegangen, ganz gleich, ob es sich um religiöse oder völkische Fragen handelte.(13) Ganz energisch wandte sich Kliewer gegen die Behauptung, dass Kolonieführer, Lehrer und Prediger es mit ihrer bekundeten Einstellung zum Deutschtum nicht ernst meinten, sondern sich aus reinem Nützlichkeitsdenken diesen Anschein gäben.
In Fernheim wurde Wilhelmys Bericht auf der Kolonieversammlung in Filadelfia am 28.9.1937 gelesen und Punkt für Punkt diskutiert. Anschließend fasste man folgenden Beschluss:
- „Die Stellung der Kolonie zum neuen Deutschland ist in kurzer Zusammenfassung die, dass wir mit inniger Dankbarkeit Gott gegenüber auf die Bewahrung Westeuropas und damit auch der übrigen Welt vor dem Weltbolschewismus dank der mächtigen Hand des großen Führers Adolf Hitler zurückblicken. Wir wollen nebst unserem Mennonitentum gute Deutsche sein und bleiben, wie wir uns als solche auch in Rußland rein von fremden Einflüssen gehalten haben, und als solche wollen wir treu und offen das Deutschtum – auch das Deutschtum des Dritten Reiches – bekennen und hoch halten wie mit Worten so auch mit der Tat. Von politischen Parteien wollen wir uns jedoch fern halten, da mit unserem mennonitischen Grundsatz der Anschluss an Parteien und politische Aktionen nicht vereinbar sind.“
Ganz anders als Wilhelmys Beurteilung war der Bericht des Propstes Marczynski, des ständigen Vertreters der Deutschen Evangelischen Kirche für die La-Plata-Staaten aus Buenos Aires. Er stellte das Selbstverständnis der Fernheimer wieder ins rechte Licht. Er war als „evangelischer Glaubensgenosse und als deutscher Volksgenosse“ zu den Fernheimern gekommen. Ihn beeindruckte der wirtschaftliche Fortschritt, das Schulwesen und vor allem die völkische und kirchliche Geschlossenheit. „Ich kenne keine deutsche Kolonie in den La-Plata-Ländern, in der ein so ausgeprägter Gemeinschaftssinn wie bei den Mennoniten herrscht.“ Ihr Verhältnis zu Deutschland charakterisierte er mit den Worten: „Es gibt vielleicht keine auslanddeutsche Kolonie, die mit solcher Freude die nationalsozialistische Revolution in Deutschland begrüßt hat wie die rußlanddeutschen Mennoniten.“ Gleichzeitig bescheinigte er ihnen aber auch, dass sie ein gutes Verhältnis zur paraguayischen Regierung und zum paraguayischen Volk hätten. Er sah, mit welchen wirtschaftlichen und klimatischen Schwierigkeiten die Siedler zu kämpfen hatten und dass es eine Reihe von Mennoniten gab, die am liebsten den paraguayischen Chaco wieder verlassen hätten.(15)
2. In der Rolle des Versagers
Gemeinschaftssinn und völkische und kirchliche Geschlossenheit, darauf waren die Fernheimer stolz und sie freuten sich, wenn das von Außenstehenden gesehen und gesagt wurde. Umso schmerzlicher musste es sie treffen, als beides während der völkischen Zeit grundsätzlich in Frage gestellt wurde. Zwei Ereignisse, die Gründung der Kolonie Friesland und der Kampf zwischen den „Völkischen“ und den „Wehrlosen“, führten zu traumatischen Erfahrungen, die tiefe Spuren hinterließen. Sie waren besonders schmerzlich, weil der Konflikt in der eigenen Gemeinschaft begründet war und die Konfrontation sich in den eigenen Reihen abspielte. Wäre der Spaltpilz von außen gekommen, hätte man ihn durch gemeinsame Abwehrmaßnahmen bekämpfen können. So aber blieb ein bitterer Nachgeschmack auf beiden Seiten, denn es gab letzlich keine Sieger, sondern allseits Versager, und diese Rolle passte nun ganz und gar nicht für „Musterschüler“. Was wird man von uns denken, diese Frage, die in den kommenden Jahren immer dann gestellt wurde, wenn es darum ging, Konfliktsituationen in der Öffentlichkeit zu bewältigen, wurde in der völkischen Zeit zu einer existenziellen Not. Denn die Geschehnisse konnten nicht geheim gehalten werden und die Außenwelt hielt mit ihrer Verwunderung und ihrer Kritik nicht hinterm Berg.
Beginnen wir mit der ersten heftigen Konfrontation zwischen den Fernheimer Bürgern. Sie begann damit, dass eine größere Gruppe von Siedlern nicht mehr bereit war, den Verbleib im Chaco trotz Dürre und Heuschrecken als Willen Gottes zu akzeptieren. Gerhard Isaak und Kornelius Langemann wurden bereits 1931 auf Landsuche nach Ostparaguay gesandt. Als sie zurückgekehrt waren und konkrete Lösungen vorschlugen, wurde Langemann, der sich besonders stark für die Abwanderung einsetzte, vom MCC-Vertreter G.G. Hiebert scharf kritisiert: „Niemand will den Chaco verlassen, nur Sie allein! Sie sind ein Rebell, ein Aufwiegler, ein Kommunist!“(16) Langemann fand dann auch kein Gehör bei der Mehrheit der Fernheimer, zumal es inzwischen geregnet hatte und die Stimmung umgeschlagen war. Vor allem auch deshalb, weil die „Abwanderung als Verlockung und Versuchung“ dargestellt wurde, wie Peter P. Klassen es dargestellt hat, denn es drohe dadurch die so hoch gehaltene mennonitische Gemeinschaft verloren zu gehen.
Doch der Spaltspilz wucherte weiter, da die „Abwanderer“ auf Verstandesgründen beharrten, während die anderen auf Gottes Hilfe vertrauten. Klassen schreibt: „Die ‘Aufwiegler’ waren da, und die Auswanderungsbewegung kam in Gang, seit 1935 in steigendem Maße. Sie nahm ideologische Formen an, indem die ‘Abwanderer’ Vernunftgründe ins Feld führten, an denen es nicht mangelte, und die ‘Bleibenden’ sich auf Gottes Führung und die von daher geforderten christlichen Tugenden beriefen.“(17)
Für die Abwanderer konnten die MCC-Vertreter kein Verständnis aufbringen. P.C. Hiebert, Verteter des MCC, urteilte: „Ein Geist der Unruhe, ein Widerwille gegen die allzustrenge und beschränkende Ordnungsverfassung in der Kolonie, ja gegen die bestehende zentralisierte Autorität hat sich am lautesten als Abwanderungsmotiv gezeigt. Solches ist wohl der Geist, der sich in der ganzen Welt in diesen Tagen kundgibt und am grellsten und schärfsten in dem russischen Kommunismus Ausdruck gefunden hat.“(18)
Wie konträr die unterschiedlichen ideologischen Auffassungen in der damaligen Zeit waren, zeigt das Urteil des Professors Wilhelmy, der nur in der Abwanderung eine Überlebensmöglichkeit für die Mennoniten im Chaco sah. Er schrieb 1938: „Die Gruppe der religiösen Fanatiker betrachtet die Auswanderungslustigen als Verräter der Sache Mennos, als ´Rebellen´, die in der Zerstreuung zwischen den anderen Deutschen oder Paraguayern ihr Mennonitentum schnell aufgeben werden.“(19)
In diesem Widerstreit der Meinungen standen die Fernheimer und kämpften um das nackte Überleben. Ein großer Schuldenberg lastete auf ihren Schultern und Heuschrecken und Dürre sorgten dafür, dass die Stimmung in der Bevölkerung immer düsterer wurde. Und aus Ferne mahnte Prof. Unruh, der mennonitische Übervater, dem sie doch so viel zu verdanken hatten und dem sie lieber Freude statt Kummer bereitet hätten. Er fragte angesichts der Trennung: „Warum lauft ihr auseinander? Gott hat euch doch gemeinsam gerettet…“(20)
Die Trennung konnte jedoch nicht mehr aufgehalten werden. 1937 wurde im östlichen Teil Paraguays von einem Drittel der damaligen Fernheimer Bevölkerung die Kolonie Friesland gegründet. Später fand eine Versöhnung zwischen den beiden Gruppierungen statt und sogar eine finanzielle Regelung wurde getroffen. Doch eine kritische Aufarbeitung dieser schmerzlichen Erfahrung fand nicht statt. Individuelle und kollektive Gefühle von Schuld und Versagen blieben bestehen.
Diese beiden unterschiedlichen Positionen in der Fernheimer Bevölkerung prallten wenig später noch heftiger aufeinander, als der Konflikt zwischen den sogenannten Völkischen, den Sympathisanten des Dritten Reiches, und den sogenannten Wehrlosen, den Gegnern von Nationalsozialismus und Rückkehr nach Deutschland, ausbrach. Austragungsort dieses Konflikts war vor allem die Schule.
Auf den ersten Blick hatte es den Anschein, als ginge es in dem Streit um die Schule um den Gegensatz von Kultur und Religion. Das war nur bedingt der Fall, denn der Konflikt spielte sich vornehmlich auf der politischen Ebene ab, d.h. das eigentliche Spannungsfeld erstreckte sich zwischen den beiden Polen Kulturpolitik und Gemeindepolitik. Auf der einen Seite versuchten die Sympathisanten des Nationalsozialismus eine Volkstumspolitik im Sinne der auswärtigen Kulturpolitik des Dritten Reiches in Fernheim zu verwirklichen, weshalb sie auch die „völkische Bewegung“ genannt wurde. Zu ihr gehörte ein großer Teil der Lehrer, unterstützt von der Kolonieverwaltung, einem kleineren Teil der Prediger und einem großen Teil der Bürgerschaft. Auf der anderen Seite formierte sich die „antivölkische“ Gruppe, die von der Mehrheit der Prediger, einigen Lehrern sowie einem Teil der Gemeindeglieder und einem engagierten Teil der Elternschaft getragen wurde und im Laufe der Zeit verstärkte Unterstützung durch das MCC von Nordamerika erfuhr.
Kompliziert wurde die Austragung der objektiv bestehenden Differenzen zwischen den beiden Gruppen besonders dadurch, dass man auf der politischen Ebene agierte, Politik als solche aber ablehnte und infolgedessen keine adäquaten Mittel und Methoden zur Konfliktbewältigung hatte. Zwar verfügte man sowohl auf Kolonieebene als auch auf Gemeindeebene über wichtige demokratische Grundelemente wie beispielsweise freie Wahlen, Mehrheitsbeschlüsse und repräsentative Stimmabgabe, doch es fehlte die organisierte Willensbildung und Interessenvertretung, wie sie die Parteien im staatlichen Bereich wahrnehmen.
Zwei grundlegende Gegensätze bestimmten in dieser kritischen Zeit das Geschehen in Fernheim. Da gab es die Trennung zwischen den „Völkischen“ und den „Wehrlosen“, und die Trennung innerhalb der Brüdergemeinde. Keine dieser Gruppierungen konnte letzlich als Sieger hervorgehen. Die Völkischen waren bereit, den Chaco zu verlassen und nahmen notfalls auch in Kauf, dass sie in Deutschland zur Werhpflicht einberufen werden würden. Die Antivölkischen sahen ihre Bestimmung im Chaco und hielten auf jeden Fall am Prinzip der Wehrlosigkeit fest.
Bis zum Juli 1940 hatten sich bereits 210 Personen für die deutsche Einbürgerung entschieden, wie Legiehn an Unruh schrieb und dabei betonte, dass unter ihnen 160 Familienväter seien. Das war ein hoher Bevölkerungsanteil, denn Fernheim hatte zu der Zeit insgesamt 290 Familien, von denen inzwischen 8 Familien Reichsdeutsche waren. Im September desselben Jahres berichtete Kliewer, dass sich sogar 240 Personen einbürgern lassen wollten und der BDMP 232 Mitglieder zähle.(21)
Diese Entwicklung zugunsten der völkischen Bewegung in Fernheim beunruhigte das MCC in Nordamerika immer mehr. Denn eine Rückwanderung in dem genannten Ausmaße würde ein Scheitern ihres Siedlungsprojektes in Paraguay bedeuten und damit einen großen Prestigeverlust nach sich ziehen. Noch im August 1938 hatte Professor H. S. Bender, der im Auftrag des MCC die Mennonitensiedlungen in Brasilien und Paraguay besucht hatte, in Bezug auf die Kolonie Fernheim geschrieben, dass sie die bedeutendste und interessanteste Siedlung aller Mennoniten in Paraguay sei, da sie das große Wohltätigkeitsprojekt des MCC repräsentiere. Fernheim sei die bestorganisierte und geistlich gesundeste Kolonie in Paraguay, ja in ganz Südmerika.(22) In seinen Augen war Fernheim nicht nur ein „materieller Erfolg“, sondern auch in religiöser und kultureller Hinsicht lobenswert.(23)
Im Juni 1940 schickte der Vorstand des MCC an alle Leiter der verschiedenen Organisationen sowie an alle Bürger der Kolonie ein Schreiben, in dem er die Position des MCC angesichts der gespannten Situation in Fernheim darlegte. Ausführlich wurde dann zum Problemfeld Schule Stellung genommen, indem die Lehrer aufgefordert wurden, sich an die mennonitischen Prinzipien wie z.B. die Wehrlosigkeit zu halten und sich von der Politik fernzuhalten, denn sie seien Diener und nicht Führer der Kolonie.(24)
Zu einer Auseinandersetzung zwischen Befürwortern und Gegnern der völkischen Bewegung in Fernheim kam es auch in der Mennoniten-Brüder-Gemeinde, die ihre Glieder zu einer Beratung am 11. Mai 1944 im Dorf Lichtfelde eingeladen hatte. Die strittigen Punkte bezogen sich auf die Weiterführung der Zentralschule sowie auf die künftige Führung der Gemeinde. Da der MCC-Direktor W. Smith dem Koloniekomitee in Fernheim den Vorschlag gemacht hatte, zwei vom MCC vermittelte mennonitische Lehrer aus Nordamerika für die Zentralschule anzustellen, hatte Bernhard Wall diese Frage zur Beratung an die Gemeinden weitergeleitet. Die Anhänger von Kliewer und Legiehn sprachen sich jedoch offen gegen eine solche Maßnahme aus, so dass die Frage zur Entscheidung an die Kolonieversammlung überwiesen wurde. Auch in der Frage der zukünftigen Gemeindeführung konnte man sich nicht einigen und beschloss, sich am 21. Mai 1944 nochmals in Filadelfia zu einer weiteren Beratung zu versammeln.(25) Schließlich kam es am 4. Juni 1944 zu einer Trennung der Gemeinde, indem man die beiden bisherigen Zweiggemeinden in zwei selbständige Gemeinden aufteilte, wobei sich in der einen Gemeinde die „völkischen“ und in der anderen die „wehrlosen“ Gemeindeglieder versammelten. Erst 1947 konnten die beiden Gemeinden nach mühevollem Einsatz des alten mennonitischen Predigers Benjamin B. Janz aus Kanada versöhnt und wieder vereinigt werden.(26)
Drei schmerzliche Trennungen hatten die Fernheimer Bürger erlebt und das Wohlwollen des MCC fast verscherzt. Dennoch konnte das MCC Fernheim nicht aufgeben, zuviel stand dabei auch für die eigene Organisation auf dem Spiel. Die hoch gehaltene Einheit war mehrfach zerbrochen worden und dies hatte gezeigt, dass auch die Musterkolonie Fernheim vor den Gefahren der Spaltung und Trennung nicht gefeit war. Man fühlte sich daher in mehrfacher Hinsicht als Versager und bemühte sich in der Folgezeit, die Einheit unter der Bürgerschaft und in den Gemeinden wieder herzustellen und reagierte schnell und scharf auf abweichende Meinungen und Gruppierungen.
Wie die KfK die Ereignisse in Fernheim seit 1933 interpretierte, konnte man in ihrer Erklärung vom 11. September 1945 nachlesen, die Stellungnahme und Schuldbekenntnis zugleich sein sollte:
- „Fernheim ist seit Anfang seines Bestehens zuerst mehr harmlos, dann aber auch bewußt weiter in die Politik hineingezogen worden. Einmal war es das Gefühl der Dankbarkeit für unsere Rettung, dann der furchtbar schwere Anfang im Chaco, die zum Anlaß wurden, dass eine uns fremde Weltanschauung hier Eingang fand und für manche zur Falle geworden ist, zu weit mitzugehen. Andere Brüder, die das für Sünde hielten, hatten nicht immer genügend Mut, dagegen aufzutreten. Hierin liegt unser Verschulden, und wir müssen uns nun einigen, einen Weg zurückzufinden, damit möglichst alle wieder gewonnen werden können.“
3. Nachwirkungen der Erfahrungen aus der völkischen Zeit
Drei schmerzliche Auseinandersetzungen, die schließlich zu Trennungen führten, hatte die Kolonie Fernheim in den 30er und 40er Jahren erfahren. Diese kollektiven traumatischen Erlebnisse zeigten in der Folgezeit Nachwirkungen, die sich sowohl auf schulischer Ebene als auch im politischen Bereich äußerten. Ich kann an dieser Stelle nur einige Beispiele dafür anführen, will aber mit meinen Ausführungen dazu beitragen, diese Dinge bewusst zu machen, und dazu anregen, diese und neu auftauchende Konflikte offen und gelassen anzupacken und gemeinsam eine Lösung zu finden. Versagen ist allgemein menschlich und niemand ist davor geschützt. Versagen aber muss eingestanden und aufgearbeitet werden, so erst kann es überwunden werden.
Die entscheidende Weichenstellung für das künftige Schulwesen in der Kolonie Fernheim kam mit den neuen Richtlinien KfK-Richtlinien, die am 18. September 1945 diskutiert und angenommen wurden.(28) In diesen KfK-Richtlinien war nun nicht mehr von „deutsch-mennonitischer“, sondern von „christlich-mennonitischer“ Erziehung die Rede, und der Bezugspunkt war nicht mehr Deutschland, sondern eindeutig das neue Heimatland Paraguay. Die Bildung in den Schulen sollte nach der Vorstellung der KfK „auf der Grundlage positiver Auslegung der Heiligen Schrift“ beruhen und „in vollem Einklange mit dem mennonitischen Glaubensbekenntnis“ stehen. Durch das „Studium einschlägiger Literatur“ sollte dem Schüler eine „christliche Weltanschauung“ vermittelt werden. Betont werden sollten in Erziehung und Unterricht „die Grundsätze und Lehren des Friedens, einfache schlichte Lebensweise, Geradheit des Charakters, Heiligkeit der Ehe und des Heimes und Freiheit des Gewissens.“ Nach Auffassung der KfK sollten in diesen von „christlich-mennonitischen Grundsätzen“ geprägten Schulen „führende Kräfte für Gemeinde, Schule und bürgerliches Leben“ herangebildet werden. Das so gepflegte geistliche und kulturelle Erbe sollte aber nicht nur den Bürgern der eigenen Siedlung zugute kommen, sondern die Schule sollte eine „Anstalt sein, durch die das kulturelle Erbe unserer Väter und die geistigen Kräfte des Mennonitentums sich Segen spendend auf die sie umgebenden Volksgruppen auswirken.“(29)
Obwohl in der Einleitung dieses Dokumentes betont wurde, dass in Erziehungs- und Bildungsfragen „Gemeinde, Schule und [Kolonie-]Amt Hand in Hand gehen müßten“, wobei eine enge Zusammenarbeit anzustreben sei, ohne „dass ein Teil von den genannten drei herrschend über die anderen stehen sollte“, machte der Text selbstredend klar, dass die KfK angesichts der Krisensituation in Fernheim beanspruchte, in Zukunft das Steuer der Bildungspolitik in die Hand zu nehmen. Damit war der „völkischen“ Bildungspolitik eindeutig eine Absage erteilt und den „christlich-mennonitischen“ Bildungsbestrebungen ein neuer Rahmen gegeben worden, der in Zukunft von Lehrern und Schülern zu beachten war.
Bestätigt wurden die Gemeinden durch B.B. Janz aus Kanada, der 1947 nach Fernheim gekommen war, um die Versöhnung zwischen den „Völkischen“ und „Wehrlosen“ herbeizuführen. Er sagte im Blick auf die Zukunft des Fernheimer Schulwesens: „Man sollte auf den Kurs in unserer Zentralschule achtgeben. Die KfK sollte als ein Institut dastehen, das bei der Anstellung der Lehrer in der Zentralschule bestimmend einwirken könnte und sollte. Die Prediger können sich schier totpredigen, wenn in der Zentralschule das Gegenteil gelehrt werde.“(30) Diese Formulierung erweckte den Eindruck, als ob die Zentralschule in der Gefahr stände, eine nichtchristliche Schule zu werden. Dabei hatte es nie zur Debatte gestanden, auch nicht während der „völkischen Zeit“, die christlich-mennonitischen Bildungsprinzipien aufzugeben. Fritz Kliewer und die anderen Lehrer, die die „völkische Bewegung“ unterstützten, hatten nie einen Zweifel daran gelassen, dass sie nach wie vor überzeugte Mennoniten seien. Unterschiedliche Auffassungen gab es allerdings darüber, wie weit der Rahmen gespannt werden konnte, um noch als „christlich“ bzw. „mennonitisch“ gelten zu können. Lehrer und Siedler waren sich darin einig, dass die Schulen nach biblischen Maßstäben geführt werden sollten, doch unterschied man sich im Blick auf die Konsequenzen, die daraus für die Bereiche Politik, Kultur und Moral zu ziehen seien. Daher wurden in der Folgezeit der Schulrat und die Schulleiter der Zentralschule wiederholt von den Predigern und Eltern zur Rechenschaft gezogen, wenn tradierte Maßstäbe bedroht zu sein schienen.
Durch die Auslandaufenthalte einiger Lehrer sowie durch den Einfluss der verschiedenen Auslandslehrer herrschte in der Folgezeit unter der Fernheimer Lehrerschaft eine durchaus pluralistische Auffassung im Blick auf Erziehung und Bildung und ihre biblische Begründung. Auf der Abschlusskonferenz des Fernheimer Lehrervereins im Jahre 1990 stellte Peter P. Klassen in seinem Jahresbericht fest, dass es unter ihnen sowohl die „Pietisten“ und „Liberale“ als auch die „Charismatiker“ und „Fundamentalisten“ gäbe, die alle davon überzeugt seien, für ihre Auffassung eine biblische Begründung zu haben. Das wäre so lange durchaus akzeptabel, als die Lehrer bereit seien, die Überzeugung der Kollegen zu respektieren. Gefährlich und damit im Erziehungsbereich unakzeptabel sei die Einstellung eines Lehrers allerdings dann, wenn er für seine Erkenntnis Absolutheitsanspruch erhebe und sie den Schülern als allein gültige Auffassung vermittle. Über solche Versuche hätten sich sowohl Eltern als auch Kollegen bei ihm schon beschwert.(31)
1993 referierte der Prediger und Lehrer Victor Wall auf einer Studienkonferenz der Mennoniten in Paraguay über das Thema „Grundlage für ein christliches Schulkonzept“, in dem er u.a. der Schule folgenden Auftrag zuschrieb: „Eine christliche Schule darf nicht nur Selbstzweck sein. Sie weiß sich der Gemeinde und der Gesellschaft verpflichtet.“ Wie umfassend er die Verpflichtung des Lehrers der Gemeinde gegenüber interpretierte, machte er in seinen Ausführungen ebenfalls klar: „Alle christlichen Schulen werden von einer bestimmten theologischen Ausrichtung geprägt. Für die Trägergemeinden ist es recht, wünschenswert und sinnvoll, dass die theologische Ausrichtung der gesamten Schulsituation dem Glaubensbekenntnis der Trägergemeinden entspricht. Gemeint ist hier nicht allein der Bibelunterricht, sondern die Erziehungsphilosophie, die Überzeugungen des Lehrers, Wissenschaft, musische Fächer, Schulatmosphäre und Disziplin.“(32)
Im Oktober 1993 stellte die KfK in Fernheim ihre „Erziehungsziele für die Schulen der Kolonie Fernheim“ zur Diskussion, die über den Erziehungsprozess in der Schule recht einseitige Grundsätze enthalten, was bereits aus der Sichtweise von Schüler und Methode hervorgeht. Der Lernende wird dabei so gesehen: „Das Kind, der Sohn, der Jugendliche, sogar Erwachsene müssen unterwiesen werden. Der Lernende kann sich immer auf die Unterweisung verlassen, weil Lehrer und Schüler beide Gott fürchten. Der Schüler wird als der zu Belehrende betrachtet.“(33) Hier wird wohl das Klassenzimmer mit dem Kirchenraum und das Lehrerpult mit der Kirchenkanzel verwechselt. Das zeigt auch die Aussage über die in der Schule anzuwendende Methode: „Unterweisung, Beratung, die helfende Hand, Disziplin und Ermahnung sind die Methoden, damit der Lernende weise wird. (Kein Lernen ohne Unterweisung – keine Unterweisung ohne Lernen.“(34)
Es ist nicht verwunderlich, dass viele Lehrer in Fernheim mit diesen und anderen Vorstellungen dieser „Erziehungsziele“ nicht einverstanden waren. Den Versuch der KfK, die Lehrer dazu anzuhalten, auf der Grundlage dieser „Erziehungsziele“ eine detaillierte „Glaubensverpflichtung“ zu unterschreiben, wurde von Peter P. Klassen auf der mennonitischen Lehrerverbandstagung im Februar 1994 so charakterisiert: „Man kann es nicht anders deuten, als dass es hier um die Verabsolutierung einer ganz bestimmten Glaubensvorstellung und Bibelinterpretation geht, die auf die Schule übertragen werden soll.“(35) Klassen stellte dann die These auf: „Die Verabsolutierung des Glaubens auf schulischer Ebene ist der Tod der Schule und auch der Tod der Gemeinde“, und zwar aus folgenden Gründen: „Der Schulträger muß bereit sein, auf fachliche Qualität der Lehrer auch zu verzichten, wenn das erste Kriterium eine bestimmte Glaubensauffassung ist.“ Eine solche Einstellung verursache aber auch das Ende der Gemeinde, denn, so Klassens Schlussfolgerung: „Wer will nicht dem Frömmigkeitsanspruch entsprechen, wenn es darum geht, eine Lehrerstelle zu bekommen? Je stärker und konsequenter der Glaubensdruck, desto größer die Gefahr der Heuchelei, eine Gefahr, die in engen geschlossenen Glaubensgemeinschaften ohnehin groß ist… Der Glaube muß Inflation erleiden und daran stirbt er.“(36)
Ein weiterer Versuch, von oben her mehr Einfluss auf die Schule zu nehmen, kam in der letzten Zeit von Seiten der Verwaltung. Durch das neue Schulstatut aus dem Jahre 2003 wurde ihr Einfluss wesentlich verstärkt. Es fällt auf, dass die Stellung des Schulrates sehr geschwächt worden ist, während der Einfluss der Verwaltung durch seinen zuständigen Vertreter erheblich an Einfluss gewonnen hat. Er und nicht der Schulrat ist der Sitzungsleiter des Bildungskomitees, er beruft die Sitzungen ein. Er ist in Verwaltungsfragen der direkte Ansprechpartner für den Direktor des Colegio und den Primarschulleiter. Der Schulrat hat hauptsächlich beratende Funktion im pädagogischen Bereich, die Lehreranstellung erfolgt jedoch durch den jeweiligen Schulleiter.(37)
Es fällt auf, dass sowohl die KfK als auch die Verwaltung durch ihre Reglementierungen versuchen, die Einheit von Kolonie, Gemeinde und Schule zu garantieren. Diese Einheit scheint ihrer Meinung nach aber nur dann gesichert zu sein, wenn sie von oben reglementiert wird. Wieso sie aber die Auffassung vertreten, dass Schule und Kultur in ihren Händen besser aufgehoben sind als in den Händen der Lehrerschaft und der Bildungsinstitutionen, ist nicht einzusehen. Die Frage, ob hier die Angst vor dem Auseinanderdriften der einzelnen Bereiche oder das Bedürfnis nach autoritärer Führung im Vordergrund steht, ist nicht leicht zu beantworten. Mehr Vertrauen von Seiten der Gemeinden und der Verwaltung zum Kultursektor der Kolonie würde meines Erachtens dessen Arbeit erleichtern und kreatives Denken und Handeln zur Entfaltung kommen lassen, was letzlich beiden Sektoren und damit der ganzen Gemeinschaft zu Gute kommen würde.
Die Angst vor der öffentlichen Auseinandersetzung und der Bildung verschiedener Gruppierungen innerhalb der Koloniegesellschaft scheint die Kolonieverwaltung zu veranlassen, die Meinungsbildung teilweise einzuschränken und bei abweichenden Meinungen rigoros zu reagieren. Hier ein paar Beispiele.
1969 forderten die Kolonieverwaltung und die KfK von Fernheim ein Schreibverbot zum Thema „Dr. Fritz Kliewer“, nachdem Abram Löwens Aufsatz „Ein kurzer Rückblick auf das Leben und Wirken von Dr. Fritz Kliewer“ zu Kontroversen innerhalb und außerhalb der Siedlung geführt hatte. In einem Schreiben an die Redaktion der „Mennonitischen Rundschau“ wandten sich die Vorsitzenden dieser beiden Institutionen mit folgendem Wortlaut:
- „Wir glauben und sind davon überzeugt: dass die gegebenen Darstellungen nicht alle den Tatsachen entsprechen. dass es nicht an der Zeit ist über die dunklen Geschehnisse vor 25 Jahren zu sprechen, noch zu schreiben, zumal mit Gottes Hilfe Zerwürfnisse geregelt werden konnten und ein brüderliches Verhaeltnis in der Kolonie, in den Gemeinden und auch von Bruder und Bruder gepflegt wurde, dass der Artikel nicht hätte geschrieben, noch veröffentlicht werden sollen, dass darüber keine Diskussion in unseren mennonitischen Blättern folgen dürfte.“
Erst 20 Jahre später begann man damit, öffentlich die historischen Ereignisse aus den 30er und 40 Jahre in der Kolonie Fernheim zu beschreiben und zu analysieren. Den Anfang machte Heinrich Dürksen in seinen Lebenserinnerungen, der seinerzeit als Oberschulze das oben genannte Dokument unterzeichnet hatte.
Seit vielen Jahren gibt die Verwaltung der Kolonie Fernheim ein Informationsblatt heraus, das wertvolle Informationen über die Kooperative und Kolonie Fernheim enthält. Schade ist, dass dieses Blatt, das in jeden Fernheimer Haushalt geschickt wird, keine Stellungnahmen und Meinungsäußerungen der Bürger aufnimmt. Denn so wird die Meinungsbildung aus der Öffentlichkeit verbannt und in die Tererérunden verdrängt. Wollen Bürger öffentlich ihre abweichende Meinung bzw. kritische Stellungnahmen kundtun, so sind sie auf andere Medien angewiesen, so z. B. auf „Neues für Alle“.
So geschah es beispielsweise in dem nun folgenden Fall. Als eine Bauerngruppe die Kolonieverwaltung wegen der Aufbewahrung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte hart kritisierte und dabei die Meinungen in erregter Form vortrug, stießen sie auf wenig Verständnis und harten Widerstand. Die Auswirkungen dieser Auseinandersetzung veranlassten einen Bürger zu folgendem Kommentar in „Neues für Alle“: „Wie immer dem auch sei, ich habe den leisen Verdacht, dass diese unangenehme Differenz in unserer Kolonie in einen sinnlosen Machtkampf ausgeufert ist… Doch es fehlt an einer vorbildlichen Form, öffentlich und mit Verantwortung einer kritischen Gesellschaft gegenüber, freie und ohne Angst gekennzeichnete Meinungsverschiedenheiten äußern zu dürfen. Denn wie wollen wir dem Kern der Sache näher kommen, wenn wir es nicht einmal wagen dürfen, das zu sagen, was wir tief im Innern empfinden.“ Und er fragt dann: „Hat das hier etwa mit diktatorischen Formeln zu tun gehabt.“ (39)
Dieser Artikel wurde ebensowenig als hilfreich angesehen als die Einwände der oben genannten Bauerngruppe. In einem Leserbrief antwortete ein anderer Bürger ohne auf die eigentliche Problematik näher einzugehen und nahm die Oberschulzen und den Aufsichtsrat in Schutz, indem er auf ihre Frömmigkeit und Integrität hinwies.(40)
Würde das Informationsblatt gleichzeitig auch zu einem Diskussionsblatt für Bürger geöffnet werden, so könnte man meines Erachtens die Auseinandersetzung versachlichen und ggf. steuern durch zusätzliche sachliche Information an die Bürger. Die jetzige Situation ist auf die Dauer unbefriedigend, denn die Bürger wollen nicht nur informiert werden, sondern auch die eigene Meinung öffentlich äußern dürfen. Dabei könnte auch die Diskussionskultur gefördert werden. Manche Bürger wollen im Grund die Sache klären helfen, greifen aber in Ermangelung einer adäquaten Ausdrucksweise Personen an, wodurch andere Bürger sich wiederum herausgefordert fühlen, die Kolonieführung in Schutz zu nehmen. Das alles war bereits während der völkischen Zeit der Fall. Damals, ebenso wie heute fehlt eine geeignete Konfliktlösungsstrategie, die zu einer Versachlichung der Auseinandersetzung und damit zu einer schmerzloseren Lösung führen könnte.
Dass eine Konfliktlösung durch einen differenzierten Meinungsfindungsprozess möglich ist, zeigt das folgende Beispiel. Vor einigen Jahren stand die MBG-Filadelfia in einer schwierigen Konfliktsituation. Es ging um die Frage, ob die Gemeinde sich angesichts ihrer Größe teilen oder eine größere Kirche bauen sollte. Hinzu kam, dass eine Gruppe von Gemeindegliedern den Bau eines Daches für das Volleyballspiel verlangte. Die Lage war gespannt. Um zu einer Lösung zu kommen, wurde ein Ausschuss gebildet, der die Frage eingehend studieren und der Gemeinde präsentieren sollte, damit eine zufrieden stellende Lösung gefunden werden könnte. Dieser Aussschuss bemühte sich durch ein vielseitiges methodisches Vorgehen die Angelegenheit zu versachlichen und den Meinungsprozess langsam durchzuführen. Es wurden Podiums- und Plenumsdiskussionen durchgeführt, Mitglieder des Ausschusses präsentierten Lösungsvorschläge und deren Konsequenzen durch ein Rollenspiel, Informationen aus der Nachbarkolonie wurden eingeholt, Gemeindeglieder berichteten über Erfahrungen aus den Gemeinden in Nordamerika. Es war ein langsamer Erkenntnisprozess, der aber dann nach etwa zwei Jahren den Entscheidungsprozess wesentlich erleichterte und zu einer allseitig befriedigenden Lösung führte, die darin bestand, dass sich die Gemeinde teilte und alle Gemeindeglieder entscheiden konnten, zu welcher Gemeinde sie gehören wollten. Die Gemeinde war in diesen Prozess voll eingebunden und alle, ob einfaches Gemeindeglied oder Vorstandsmitglied, konnten ihren Beitrag leisten. Für manche Ausschussmitglieder gab es dabei neue Erfahrungen. Als ein ehemaliger Oberschulze eine Podiums- und Plenumsdiskussion leiten sollte mit dem Ziel, die Meinung der Gemeinde herauszufinden, bekannte er: Ich habe schon viele Koloniesitzungen geleitet, aber dort wusste ich immer, wo ich hinwollte, und hier soll sich die anzustrebende Zielsetzung erst aus der Diskussion ergeben.
Die Geschichte hat gezeigt, dass die Bürger der Kolonie Fernheim für die eigene Siedlung, aber auch für die anderen Kolonien Hervorragendes geleistet haben. Das trifft sowohl auf den Schulsektor als auch auf den Kooperativssektor zu. Die Erwartungshaltung von außen und der Erfolgsdruck von innen sowie die Angst vor dem Versagen haben sie jedoch in Rollen gedrängt, die sie in ihrer Flexibilität und Kreativität eingeschränkt haben. Die Scheu vor dem offenen Konflikt und der Mangel an Konfliktlösungsstrategien haben dazu geführt, dass die Verantwortlichen in Kolonie und Gemeinde oft überreagiert haben. Ich meine, mehr Gelassenheit und ein Bekenntnis zu ihrem Sosein, ohne auf ihre Rollenverpflichtung zu schielen, würde ihre Gesamtleistung erhöhen und nicht mindern.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Benutzte Quellen und Literatur:
- Bender, Harold S.: With the Mennonite Refugee Colonies in Brazil and Paraguay. A Personal Narrative. In: Mennonite Quarterly Review 8 (1939) 1, S. 59-70. IX-6-3 Mennonite Central Committee and other Correspondence, 1940-45, File 19.
- Dürksen, Heinrich: Daß du nicht vergessest der Geschichten, Lebenserinnerungen, Filadelfia, 1990.
- Klassen, Peter P.: Die Mennoniten in Paraguay, Bd. 1. Reich Gottes und Reich dieser Welt. 2. erweiterte und aktualisierte Auflage. Bolanden-Weierhof 2001.
- Klassen, Peter P.: Die deutsch-völkische Zeit in der Kolonie Fernheim, Chaco–Paraguay 1933-1945. Ein Beitrag zur Geschichte der auslandsdeutschen Mennoniten während des Dritten Reiches. Bolanden-Weierhof 1990.
- Komitee der Flüchtlinge (Hrsg.): Vor den Toren Moskaus oder: Gottes gnaedige Durchhilfe in einer schweren Zeit. Yarrow/B.C. (1960).
- Kossok, Manfred: Die Mennoniten-Siedlungen Paraguays in den Jahren 1935-1939. In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 8 (1960) 2, S. 367-376.
- Materialien aus dem Bundesarchiv Potsdam.
- Materialien aus dem Archiv Fernheim, Chaco Paraguay.
- Mennoblatt, Filadelfia, Fernheim, Chaco Paraguay.
- Ministerio de Economía: Las colonias Mennonitas en el Chaco Paraguayo. Asunción 1934.
- Neff, Christian (Hrsg.): Bericht über die Mennonitische Welt-Hilfs-Konferenz vom 31.8.- 3.9.1930 in Danzig. Karlsruhe o.J.
- Neues für Alle, Asunción, Paraguay.
- Neufeld, Hans (Juan): Affaire Dr. Fritz Kliewer in Fernheim 1940-1944. „Wie es war“, mit Anhang, Asunción 1988 und 1991.
- Postma, J. S.: Fernheim – fernes Heim? Maschr. Manuskript o.O. und o. J.
- Ratzlaff, Gerhard: An historical-political Study of the Mennonites in Paraguay. Maschr. Magisterabeit der California State University 1974.
- Ratzlaff, Gerhard (Hrg): Die Mennoniten in Paraguay, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Studienkonferenz der Mennoniten in Paraguay, Asunción 1993.
- Röhrs, Hermann: Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1968.
- Thiesen, John D.: The Mennonite Encounter with National Socialism in Latin America, 1933-1944. Maschr. Magisterarbeit der Wichita State University 1990.
- Thiesen, John D.: Mennonite and Nazi. Attitudes among Mennonite Colonists in Latin America, 1933-1945. Wichita, 1998.
- Unruh, Benjamin Heinrich: Fügung und Führung im mennonitischen Welthilfswerk 1920-1933. Humanität in christlicher Sicht. Schriftenreihe des Mennonitischen Geschichtsvereins Nr. 8. Karlsruhe 1966.
- Warkentin, Jakob: Die deutschsprachigen Siedlerschulen in Paraguay im Spannungsfeld staatlicher Kultur– und Entwicklungspolitik, Münster-New York-München-Berlin 1998.
- Wiens, Hans: „… Dass die Heiden Miterben seien.“ Die Geschichte der Indianermission im paraguayischen Chaco. o.O. 1989.
- Wiens, Peter: Die KfK Fernheim, ein geschichtlicher Überblick 1931-1991. Asunción 1992.
Fussnoten:
Überarbeitete Fassung des Votrags auf dem Symposium am 22.5.2004 | |
Über die Situation der Flüchtlinge in Moskau und ihre Ausreise nach Deutschland wird ausführlich berichtet in Komitee der Flüchtlinge [1960]. | |
Vgl. hierzu Unruh 1966. | |
Vorbemerkung in Las Colonias Mennonitas 1934. | |
Mennoblatt Nr. 7, Juli 1937, S. 4. | |
Welthilfskonferenz 1930, S. 137 | |
Zitiert nach Mbl 4 (1933) 6, S. 2. | |
Akten des AA im Archiv Fernheim, Bericht des deutschen Gesandten Büsing an das AA vom 20.6. 1938. | |
BA Potsdam 09.01.AA 69558, B. 77 f. | |
BA Potsdam 09.01.AA 69558, Bl. 59. | |
Ebd., Bl. 60. | |
Prot. der Kolonieversammlung am 28.9.1937. A Fernheim. | |
BA Potsdam 09.01.AA 69558. Bericht, der nicht für die Presse bestimmt war, v. Nov. 1935. | |
Klassen, Peter P.: Die Mennoniten in Paraguay (2001) , Bd. 1. S. 127 f. | |
Ebd., S. 129. | |
Ebd. | |
Ebd., S. 137 | |
Prot. der Jahressitzung des BDMP vom 20.9.1940. | |
Bender 1939, S. 67. | |
Ebd., S. 70. | |
Ebd. | |
Bericht über die „Bruder-Beratung im Dorfe Lichtfelde„ am 11.5.1944, vorhanden in IX-6-3 Mennonite Central Committee, CPS and other Correspondence, 1940-45, File 19. | |
Klassen, P. P. 1990, S. 131 f. | |
Zit. nach Klassen, P. P. 1990, S. 131. | |
Die Richtlinien der KfK über „Zweck und Aufgabe der Fernheimer Schule“ sind abgedruckt in Wiens, P. 1992, S. 43 ff. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Überlegungen, die bereits 1993 in einem Vortrag geäußert wurden, veröffentlicht in Studienkonferenz der Mennoniten 1993. | |
1932 hatte der Missionsbund „Licht den Indianern“ eine Missionsarbeit unter den Indianern im Chaco begonnen, die nun weiter ausgebaut werden sollte. Siehe hierzu Wiens, H. 1989. | |
Zit. nach Wiens, P. 1992, S. 42. | |
Jahresbericht von Peter P. Klassen auf der Abschlusskonferenz des Fernheimer Lehrervereins am 9.11.1990. A Fernheim. | |
Referat von Victor Wall, gehalten am 3.2.1993, veröffentlicht in Studienkonferenz der Mennoniten 1993, S. 60 ff., Zitate S. 74 f. | |
Erziehungsziele der KfK vom Oktober 1993, S. 7 der maschr. Fassung. | |
Ebd. | |
Das Redemanuskript, auf das hier Bezug genommen wird, wurde mir freundlicherweise von Peter P. Klassen zur Verfügung gestellt. | |
Ebd. | |
Schulstatut vom 1.4.2003. | |
Kopie des Briefes im Archiv Fernheim. | |
Neues für Alle vom 11. Januar 2002 | |
Neues für Alle vom 8. Februar 2003 |
Ein Tribut an John Howard Yoder: Gedanken zum christlichen Friedenszeugnis in Paraguay
Gundolf Niebuhr
Einleitendes
Am 30. Dezember 1997, am Tag nach seinem siebzigsten Geburtstag, starb J. H. Yoder plötzlich an Herzversagen in seinem Büro an der Universität Notre Dame. Seitdem ist sein Name in mennonitischen und anderen Zeitschriften vielleicht noch häufiger genannt worden als vorher. Nachrufe befassten sich in sehr kompakter Form mit seinem Beitrag für die Theologie des 20. Jahrhunderts. Im Juni 2001 fand am Bienenberg, Schweiz, ein Symposium statt, welches sich spezifisch mit seinem Beitrag für die Friedenstheologie befasste. Im März 2002 gab es eine Tagung an der Universität Notre Dame, um sich mit seinem theologischen Nachlass auseinanderzusetzen. Wiederholt ist auch in Paraguay und Argentinien angeregt worden, eine ähnliche Tagung anzuberaumen, was auch zu empfehlen wäre, bis jetzt aber noch aussteht. Als wir das gegenwärtige Symposium planten, schien es natürlich, im Kontext der Arbeit am Thema „Politik, Privilegiertheit und Friedenszeugnis“ mindestens einen Vortrag seinem Nachlass zu widmen. Das kann offensichtlich nicht ausreichend noch erschöpfend sein, wohl aber anregend. Und es wäre zu begrüßen, wenn heute hier der Entschluss reifen könnte, bei einer zukünftigen Gelegenheit sich gründlicher mit ihm zu befassen.
Der gegenwärtige Vortrag sollte in einem doppelten Sinne ein Tribut an Yoder darstellen: a) indem wir hinhören auf seine Botschaft und fragen, wie sie uns betrifft, und b) indem wir ernsthaft über unsere Rolle als Christen in Paraguay nachdenken, machen wir weiter mit der theologischen Aufgabe, die er uns nach seinem Tod gewissermaßen anvertraut hat.
Biographisches
Wie bei geistigen Größen unter den Menschen jedoch üblich, fordert die Arbeit an Yoder auch ihren Tribut an Mühe von den Leuten, die diese Aufgabe übernehmen. Zunächst ein paar Worte zu meiner eigenen Begegnung mit J. H. Yoder: Im August 1986 kamen meine Frau und ich an das gemeinsame Seminar der Mennoniten in Elkhart zum Studium. Zu dem Zeitpunkt war Yoder schon nicht mehr als Professor dort tätig. Das Seminar hatte z.T. gerade durch seine Arbeit einen akademisch weithin respektablen Ruf erhalten. Er war jedoch schon seit 1977 teilzeitig an der Universität Notre Dame, einer privaten katholischen Hochschule vom Orden der Verbiter, tätig gewesen. 1985 übernahm er dort einen vollzeitigen Lehrstuhl und zog sich damit ganz vom mennonitischen Seminar zurück. Er wohnte jedoch auf Nachbarschaft des Seminargeländes und kam gelegentlich zur Arbeit in die reichhaltige Bibliothek. Seine Erscheinung war nicht sehr Vertrauen erweckend. Er war groß, hatte eine dicke Brille, einen dichten Ziegenbart, wirkte schweigsam und abweisend. Hinzu kam, dass er meistens wenn er übers Seminargelände schritt, einen kleinen Kassettenrecorder bei sich hatte und fleißig während des Gehens darauf sprach. Der Grund war, dass er sich keine Gedanken entwischen lassen wollte, die ihn zwischen Bibliothek und Zuhause evtl. heimsuchen würden. Dieser Wesenszug war auch nicht dazu angetan, ihn mal kurz anzuhalten, Hallo zu sagen und ein Weilchen zu plaudern. Er war äußerst diszipliniert, las viel, schrieb Vorträge, machte Reisen und führte Dialoge mit Studenten und Experten aus verschiedenen Fachbereichen. Trotzdem überlegte ich: „Es darf doch wohl nicht wahr sein, dass ich meine Jahre hier in Elkhart verbringen werde, ohne Yoder getroffen und mit ihm persönlich gesprochen zu haben“. Außerdem gaben mir manche Kollegen unter den Studenten zu verstehen, dass Yoder gar nicht so unzugänglich sei, wie er wirke, dass man ihn nur anzurufen brauche, und er für einen Abend einladen würde.
Gesagt getan. Er lud ein in sein geräumiges, aber schlichtes Haus an der Benham Avenue und wir verbrachten einen Abend in seinem Schreibzimmer im Gespräch über seine Schriften, über die Hauptthemen seiner Theologie und auch die Lage der Gemeinden in Südamerika. Er erzählte etwas aus seiner Zeit in Montevideo und Buenos Aires in den Jahren zwischen 1966 – 71. Wir sprachen über den Dialog zwischen Täufertum und Befreiungstheologie, der in jener Zeit angelaufen war und zu dem er auch seinen Teil beigesteuert hatte. Bei alledem wurde mir klar, dass er nicht der formelle und verschlossene Akademiker war, wofür ich ihn gehalten hatte. Im Gegenteil, er war ein schlichter Mensch, offen, interessiert, und wo er gebraucht wurde, konnte man sich auf ihn verlassen. Allerdings, bei gesellschaftlichen Veranstaltungen war er nicht bereit den Unterhalter zu spielen. Wenn er in ein Gespräch gezogen wurde, musste es seriös sein, man musste zum Thema kommen. Zielloses Plaudern überließ er gern anderen. Außerdem gab er neugierigen Fragestellern gern folgenden Rat: „Wenn ihr wissen wollt, was ich gedacht habe, dann lest, was ich geschrieben habe. Ich habe nämlich alles aufgeschrieben, was ich gedacht habe“. Das war sicher ein gut gemeinter Ratschlag, aber leider etwas schwer zu befolgen. Darauf kommen wir später noch zurück.
Yoder wurde am 29. Dezember 1927 in Smithville, Ohio, geboren. Seine Eltern und Großeltern hatten zu den amischen Mennoniten gehört, waren aber Teil einer Reformgruppe, die ausgestiegen war und sich der Konferenz der Altmennoniten angeschlossen hatte. Er ging als Jugendlicher an das Goshen College und schloss schon 1947, mit knapp 20 Jahren, sein Studium dort ab. 1949 ging er zusammen mit vielen anderen jungen Leuten mit dem MCC nach Europa, um bei der Aufbauarbeit der Nachkriegszeit zu helfen. In Frankreich stationiert, lernte er dort seine zukünftige Frau kennen, Anne Marie Guth, eine französische Mennonitin. Sie heirateten 1952 und hatten gemeinsam sieben Kinder.(2)
Während seines Europaaufenthaltes ging er für die doktoralen Studien mit Walter Eichrodt, Werner Baumgartner, Oskar Cullmann, Jaspers und Barth an die Universität Basel.(3) 1957 promovierte er mit einer Dissertation über die Gespräche zwischen Täufern und Reformatoren im frühen 16. Jahrhundert. Es wurde ein zweibändiges Werk, welches heute wohl vergriffen, aber u.a. in der Bibliothek vom CEMTA zu finden ist.
1958 begann seine akademische Laufbahn als teilzeitiger Professor am Seminar in Elkhart. Ganz sesshaft wurde er nie. Wie gesagt, war er dauernd auf Reisen, z.T. als Gastprofessor in anderen Ländern oder als Vortragsredner bei verschiedenen Symposien, die sich meist mit den Themen Freikirchen und Friedenszeugnis befassten.
Auf der Mennonitischen Weltkonferenz in Amsterdam 1967 wurde er von Vertretern aus der Dritten Welt ziemlich hart kritisiert. Seine Ideen würden nur in Nordamerika und Europa zutreffen, nicht aber in den armen und korrupten Ländern des Südens. Er nahm diese Herausforderung an und erklärte sich bereit, in den folgenden Jahren am ISEDET in Buenos Aires und am mennonitischen Seminar in Montevideo Kurse zu geben und Dialoge mit Vertretern der lateinamerikanischen Theologie, gerade auch der Befreiungstheologie zu führen. In wenigen Monaten lernte er Spanisch. In Argentinien war der Empfang zuerst kritisch und distanziert, aber mit der Zeit sah man ihn als durchaus ernst zu nehmenden Gesprächspartner. Während dieser Zeit (bis 1971) kam er auch einige Male in die Mennonitenkolonien Paraguays und hielt bei einer Gelegenheit Vorträge in Loma Plata.(4) Seine Rezeption bei den Mennoniten Paraguays war jedoch nur marginal. Ich habe Kommentare gehört, in denen man Befremden darüber äußerte, dass ein solch bekannter Theologe ohne Bibel hinter die Kanzel trat, um einen Vortrag zu halten. Etwas gemildert wurde die Kritik dann doch, als man beobachtete, dass er am Schluss ein kleines Neues Testament aus der Rocktasche zog und einen Vers daraus vorlas. Weitere Kommentare zu Thema und Inhalt des Vortrags sind mir nicht bekannt geworden.
Die 70er und 80er Jahre waren zweifellos die produktivsten Jahre in seinem Wirken, in denen auch die meisten von ihm selbst veranlassten Publikationen erschienen.
Es gab auch Schattenseiten in Yoders Leben. Schon ca. 1985 war bekannt, dass er sich sexueller Fehltritte schuldig gemacht hatte. Für einige Zeit herrschte in seiner Gemeinde Unsicherheit darüber, wie die Anschuldigungen einzuordnen seien und wie man disziplinarisch vorgehen könnte. Im Jahr 1992 wurde die Indiana-Michigan Abteilung der Mennonitischen Konferenz eingeschaltet und Yoder musste sich einem disziplinarischen Verfahren stellen. Das war schmerzhaft für ihn, aber er willigte ein, tat Buße und wurde 1996 wieder als volles Mitglied und auch als Lehrer der Kirche installiert.(5) Diese Erfahrung sagt uns, dass auch er seinen Schatz in irdenen Gefäßen trug, aber es sagt zugleich, dass er die Kirche ernst nahm, sie liebte, und bereit war sich selbst dem zu stellen, was er gelehrt hatte.
Schriften und Schwerpunkte in Yoders Denken
Jeder Theologe will in seinem zeitgeschichtlichen Kontext verstanden sein, deshalb ein kurzer Blick in dieser Hinsicht: 1944 hatte H.S. Bender seinen Artikel „The Anabaptist Vision“ im amerikanischen Journal für Kirchengeschichte veröffentlicht. Damit war gewissermaßen der Startschuss für eine neue Generation von Forschern im Mennonitentum gegeben. Bender war auch Yoders Lehrer in Goshen gewesen. Er hatte sich einen überdurchschnittlich begabten und treuen Jünger erhofft, was dann aber doch nur teilweise Realität wurde, denn die beiden konnten sich später nicht gut verstehen. Trotzdem erinnert sich Yoder sehr klar, dass er 1948 von Bender und Orie Miller den feierlichen Auftrag bekommen hat, die Friedenserziehung in der mennonitischen Kirche zu fördern.(6) Jedenfalls war dieser Neuansatz in der Täuferforschung immerhin die Triebfeder hinter Yoders Theologie.
Der andere bestimmende Faktor war die Aufbruchstimmung in den Nachkriegsjahren. Pazifistische Gruppen aus verschiedenen Lagern stellten Krieg und Gewalt prinzipiell in Frage. Sie forderten alternative Ansätze, aktive Friedensarbeit, soziale Gerechtigkeit, Schluss mit Kolonialismus, Rassendiskriminierung usw. Bei seinem eigenen Einsatz im Nachkriegseuropa war er zutiefst beeindruckt von der Notwendigkeit radikal neuer Denkansätze, gerade in den Kirchen. Zusammen mit anderen Vertretern evangelischer Freikirchen wurden Mitte der 50er Jahre die Puidoux-Konferenzen ins Leben gerufen. Die Absicht hierbei war ursprünglich, beim Weltkirchenrat eine Stimme für das Friedenszeugnis zu erheben, aber es wurde mehr daraus; eine regelrechte Begegnung zwischen Landes- und Freikirchen, wie es sie seit der Reformation nicht mehr gegeben hatte.(7) Mit einer Gruppe von Studenten und MCC-Arbeitern startete er die sog. „Concern group“ (Gruppe mit einem Anliegen), die sich stark machte für die Friedenslehre und auch längere Zeit eine eigene Zeitschrift herausgab, die „Concern papers“. Die schon erwähnte Forschung zu seiner Dissertation über die Gespräche zwischen Täufern und Reformatoren vertiefte mehr noch als bei Bender den Gedanken, dass die radikale Reformation einen durchaus gültigen Ansatz zum Verständnis der christlichen Theologie bieten konnte.
Die großen Themen bei ihm sind: Frieden, Sozialethik im breiteren Sinne, freikirchliche Ekklesiologie und Ökumene. Dabei ist von vornherein zu erwähnen, dass die Friedenslehre aufs engste verbunden ist mit seiner Ekklesiologie, also dem Verständnis der Kirche und ihrer Rolle in der Welt. Leider ist es im gegenwärtigen Rahmen nicht möglich, sein theologisches Denken auf gebührende Weise darzustellen. Einige methodische Hinweise jedoch zu seiner Arbeit: Wie schon erwähnt, gab er gern den Rat, seine Schriften zu lesen, wenn man wissen wolle, was er denke. Damit hat es nun aber einiges auf sich. Mark Thiessen Nation aus dem Fuller Seminar hat sich im Zuge seiner Doktorarbeit die Mühe gemacht, eine Bibliographie von Yoders Schriften aufzustellen. Diese wurde 1997 publiziert und umfasst 61 gedruckte Seiten. Die Menge ist jedoch nicht so tragisch wie die Frage der Zugänglichkeit. Aus eigener Initiative sind 17 Bücher von ihm erschienen, wobei die „Politik Jesu“ mit Abstand das bekannteste ist. Thiessen bemerkt, dass Yoder mit diesem Werk die Mennoniten auf die theologische Landkarte der großen Kirchen gesetzt hat.(8) Es kam 1972 erstmals in Englisch heraus und 1981 auch in Deutsch. Die allermeisten seiner Schriften sind Vorträge, Aufsätze oder Stellungnahmen, die in ganz verschiedenen theologischen oder ethischen Fachzeitschriften erschienen. Vieles blieb auch unpubliziert und kursierte jahrelang nur in mimeographierter Form unter Studenten oder Freunden. Die Stone Vorlesungen an der Princeton Universität von 1980 kursierten lange in solcher Form, bis sie, fast durch Zufall, in einer Sammlung seiner Schriften gedruckt wurden.(9) Oft waren es andere Leute, welche dabei die Initiative ergriffen.
Yoder war ein Ethiker. Sein einziges Werk zur systematischen Theologie „Preface to Theology“ (Vorwort zur Theologie) wurde lange Zeit nur als fotokopierte Sammelmappe in Elkhart bei den Seminaristen von Hand zu Hand gereicht, bis es schließlich gedruckt wurde. Ebenso das Werk „Christian Attitudes to War, Peace and Revolution“ (Christliche Haltungen zu Krieg, Frieden und Revolution). Kurz, Yoder hat viel geschrieben, hat aber nicht allzu großen Wert darauf gelegt, dass seine Schriften publiziert wurden. Er hat viel theologisch gedacht, aber ein abgerundetes System von Theologie war nicht seine Priorität. Wir müssen bei ihm zuerst nach Methode und Geist der theologischen Arbeit fragen, nicht nach dem System.
Hat man nun auch eine gute Portion seiner Schriften beisammen, ist das Problem keineswegs gelöst. Ein ziemlich hoher Einsatz an Motivation ist gefragt, soll man ein Buch von ihm nicht vorschnell beiseite schieben. Einmal ist der Stil relativ trocken, oft mit Fachjargon durchsetzt, zum anderen bewegt er sich dauernd über die Grenzen von Fachbereichen hinweg. Die Interdisziplinarität macht es oft mühsam ihm zu folgen, wenn er von Exegese auf Geschichte springt, dann auf Moraltheologie, Rechtswissenschaft, Philosophie oder internationale Politik (das kleine Buch „He came preaching Peace“ bildet da eine gute Ausnahme). Die Kompetenz in so verschiedenen Disziplinen hat ihm jedoch auch viele Kontakte eingebracht. Dies hat dazu geführt, dass er von Rechtsanwälten, hohen Militärs oder anderen Menschen, die sonst nie mit Friedenstheologie etwas am Stecken hatten, ins Gespräch kam und schließlich ernst genommen wurde.
Weiter ist von verschiedenen Personen hervorgehoben worden, dass Yoders Auftreten, seine Form des Dialogs friedfertig war.(10) Er versuchte nicht mit schlagfertigen Argumenten zu überzeugen. Schon von Natur aus war er kein Dogmatiker. Seine Ansicht war, dass man mit Vorbild und Lebensstil besser überzeugt als mit Argumenten, ja dass man von vornherein gar nicht dauernd Überzeugungsarbeit zu leisten hat. Man hat hinzuhören, man hat jeden Menschen in seiner Stellung, in seiner Arbeit zu verstehen und erst, wo man sich diese Mühe gemacht hat, kann man darauf aufmerksam machen, wo das Evangelium in seiner/ihrer Situation evtl. relevant wäre. Dieser Grundzug an Yoder ist dankbar anerkannt worden, gerade auch in nicht-mennonitischen Kreisen.
In einer Januarnummer des Mennoblattes steht eine Rede des Bundespräsidenten Johannes Rau, kurz bevor er die Mennoniten in Uruguay besuchen wollte. Er setzt sich mit der Barmer Erklärung der Bekennenden Kirche auseinander und fragt, wie wohl die Mennoniten in ihrer vermeintlich unpolitischen Haltung darüber denken würden. Und er äußert die Hoffnung: „Vielleicht habe ich ja mehr Zeit, als das Protokoll eines Staatsbesuches es eigentlich zulässt, mit den Menschen dort zu sprechen, über Kirche und Politik …. über den Alltag von Christen in Staatsämtern“.(11)
Es ist bis heute symptomatisch für Mennoniten gewesen, dass sie schwer zugänglich waren für solche Gespräche, weil sie entweder schlecht vorbereitet darauf waren, wenig Interesse zeigten oder einfach nur ihre Stellung verteidigen wollten, statt ein wirkliches Gespräch zu führen. Yoder ist diesbezüglich seiner Konfession vorausgeeilt, denn er war ein kompetenter Gesprächspartner, gerade für solche Fragesteller. Das machte ihn zum pünktlichen Gast bei der nationalen Kirchenkommission in den USA, in Genf beim Weltkirchenrat, in anderen ökumenischen Gremien und nicht zuletzt da, wo er lehrte, an einer katholischen Universität.
Yoder und die Russlandmennoniten
Es wurde schon angedeutet, dass man in unseren Kreisen offenbar Verständigungsschwierigkeiten mit diesem Theologen hatte. Bei einer Gemeinschaft, die sich über Jahrhunderte zur Friedenshaltung bekannt hat, muss das zunächst etwas befremden. Ein paar Überlegungen dürften da weiterhelfen. Da ist sicher die unterschiedliche politische Weltanschauung zu berücksichtigen. Yoder war von der amerikanischen Demokratie, mehr noch, von der politischen Aufbruchstimmung der Nachkriegsjahre geprägt. Russlandmennoniten waren von der Monarchie des Zarentums geprägt und hatten ein tiefes Misstrauen gegen die französische Revolution mit den darauf folgenden westeuropäischen Demokratien entwickelt. Zum Teil äußerte sich dieses Misstrauen in den apokalyptischen Trends im späten 19. Jahrhundert. Man hielt am Gottesgnadentum des Kaisers fest, man sah sich als Günstling und Bittsteller bei der Regierung, aber man war nicht in der Lage, so frei und selbstbewusst in die politische Arena zu treten, wie es in einer Demokratie möglich ist.
Die Siedlungsstruktur und das Selbstverwaltungssystem hatte eine Sachlage eingeleitet, in der eine interne Politik notwendig war, die einem Staatsapparat in Miniatur glich. Darauf hat Peter P. Klassen in seinen Büchern immer wieder hingewiesen. Hier musste man Institutionen schaffen, musste man Funktionen übernehmen, die mit dem Geist der Bergpredigt nicht gut harmonierten. Das mag mit ein Grund sein, wieso man mit Yoder nicht gut mitgehen konnte. Es kann wohl, wenn auch etwas generalisierend, gesagt werden, dass Mennoniten in Russland denselben Prozess durchmachten wie die Kirche am Übergang zum Mittelalter. Damals wurden die Mehrheit der Bevölkerung und auch die Herrscher christlich, sie mussten sich als Christen in der Welt einrichten, was Aufgaben mit sich brachte, deren Ausübung ursprünglich nicht akzeptiert worden war. Kurz, es entstand das bekannte Phänomen der Volkskirche, was auch in Russland der Fall war. Kolonie und Gemeinde waren mehr oder weniger deckungsgleich. Da vor allem amerikanische Mennoniten dieses Phänomen skeptisch betrachteten, haben wir uns womöglich auch etwas angegriffen gefühlt, jedenfalls klingt ein leicht defensiver Ton auch gelegentlich aus den Büchern von Herrn Klassen, was allgemein die Stimmung unter uns reflektieren dürfte.
In Russland kam ein weiterer Faktor hinzu, nämlich der Reichtum. 1907 stellte ein junger Mennonit in der Odessaer Zeitung die Frage: „Warum stellen Mennoniten die Kosaken an zu ihrem Schutz?“ Er schreibt einen längeren Artikel und äußert sich besorgt darüber, wie sich dieser Tatbestand mit der Wehrlosigkeit reimt. Harry Löwen und James Urry haben diese Frage zum Anlass genommen und eine gründliche Abhandlung darüber geschrieben, wie der ständig wachsende Reichtum dazu führte, dass Mennoniten ihre Besitztümer schützen mussten, und zwar immer häufiger, und wie dieser Trend schließlich auch zur tragischen Notwendigkeit des Selbstschutzes führte.(12) Über den Selbstschutz hat man bei uns allgemein wenig gesprochen, ähnlich wie über die völkische Zeit. Es waren extreme Zeiten und wir wollen ja nicht den Eindruck erwecken, dass wir zu Gericht sitzen über die Generation, die so handelte, obwohl es selbst damals sehr differenzierte Stellungnahmen gab. Aber im Interesse der Gegenwart werden wir die Geschichte zu befragen haben, denn niemand braucht heute viel Phantasie um zu sehen, dass in manchen Hinsichten die gegenwärtige Lage ähnlich ist. Kaum jemand verliert noch Gedanken darüber, wie es denn ist, wenn ein halbes Dutzend bewaffneter Polizisten vor Supermarkt und Bank stehen. Kaum jemand zweifelt, dass diese schießen würden und auch scharf schießen würden, wenn ein Überfall käme. Und wahrscheinlich erwarten wir auch, dass sie schießen würden. Ja, wir könnten noch einen Schritt weitergehen und fragen: Auf wie vielen Estancias, in wie vielen Haushalten liegen Schrotflinte oder Pistole griffbereit?
Zum anderen können wir ziemlich empört reagieren, wenn ein 18-jähriger Bursche beim Bajakursus sagt, er würde schießen was das Zeug hält, wenn man fragt, wie er reagieren würde, falls er angegriffen würde. Junge Leute sind wohl noch sensibler für die Widersprüchlichkeit unserer Lage, ihre Antworten noch ehrlicher. Wir Erwachsenen finden uns offenbar mit dem Hinweis ab, dass die Lage nun mal so ist, dass es keine Lösung für die Problematik gibt und wir uns folglich müssen so gut wie möglich einrichten müssen. So ist diese Welt nun mal, man muss es akzeptieren, wenn ein Ideal nicht mehr haltbar ist. Und wie die Lage in Russland oder in Paraguay ist, dafür können die Nordamerikaner ohnehin kein Verständnis aufbringen.
Etwa so mögen viele bei uns gedacht haben, wenn sie mit dieser Friedenstheologie konfrontiert wurden.
Überlegen wir weiter, wie die Privilegiertheit das politische Selbstverständnis und sicher auch das Friedenszeugnis bei Russlandmennoniten geprägt hat. Im englischen Sprachgebrauch liegen die Begriffe „privilege and power“ (Privilegium und Macht) bezeichnenderweise sehr eng zusammen. Die Bitte um Privilegien hat uns zur Politik geführt, schon von Preußen her. Und wo man politisch handelte, da ging es fast immer um die Sicherung von Privilegien. Natürlich wollte man ursprünglich auch das christliche Friedenszeugnis aufrecht erhalten, als man in Preußen um Befreiung vom Wehrdienst einkam. Über kurz oder lang musste es aber dazu kommen, dass Freiheit vom Wehrdienst mit einer Sonderstellung, mit Privilegiertheit verbunden wurde. Wehrlosigkeit wurde etwas, das man von einem wohlwollenden Herrscher geschenkt bekommt, statt eine theologisch verankerte Überzeugung. Ich möchte dies jetzt einmal die „privilegierte Auffassung der Wehrlosigkeit“ nennen. Die Regierung gab, die Gemeinschaft empfing dankbar und musste sich in der Folge dann auch als brave, fortschrittliche Gemeinschaft zeigen, denn man fühlte sich irgendwie bei der Regierung verschuldet.
Die privilegierte Auffassung führte weiter dazu, dass man sich in Zeiten politischer Stabilität kaum Rechenschaft über die Wehrlosigkeit zu geben brauchte. Es erübrigte sich zu fragen, ob und wie man als Gemeinschaft ein aktives Friedenszeugnis darstellte. Man hatte ja das Privileg, es brachte eindeutige Vorteile, dadurch dass die Jungen zu Hause auf der Wirtschaft arbeiten konnten bzw. nicht der moralischen Gefahr des Soldatenlebens ausgesetzt waren. Auch politisch tätig zu werden, war kaum notwendig, sofern das Abkommen mit der Regierung eindeutig und stabil war. In Russland wurden die Privilegien „für alle Ewigkeit“ gegeben. Erst als klar wurde, dass diese „Ewigkeit“ nach weniger als 100 Jahren zu Ende war, setzte sich der politische Mechanismus wieder in Gang, um nach langen, zähen Verhandlungen schließlich den Forsteidienst zu erwirken. In Paraguay haben wir uns in den Jahrzehnten vor und während der Stroessnerzeit auf ähnlichen Bahnen bewegt. Oft geschah dies mit dem ausdrücklichen Hinweis, den Löwen ja schlafen zu lassen, solange er schläft. Damit sollte gesagt sein, dass man es vermeiden sollte, Fragen aufzurollen, die eventuell zu einer Überprüfung der bestehenden Privilegien führen könnten. So wurde auch die Friedenslehre in den Missionsgemeinden sparsam vertreten, denn man fürchtete Probleme, falls nun die nationalen Gemeinden auch auf die Wehrdienstfreiheit pochen würden.
Mir scheint, dass es längst fällig ist, diesen Privilegiertheitscharakter unseres Friedenszeugnisses bzw. unseres ganzen politischen Denkens neu unter die Lupe zu nehmen. Und das nicht nur, weil es uns selbst zutiefst geprägt hat, sondern auch weil es das Bild der Umwelt von uns prägt. In unserem Land hat die Privilegiertheit der Mennoniten zu unausrottbaren Mythen unter dem Landesvolk geführt. Zum Beispiel ist allen klar, dass Mennoniten keine Steuern zahlen. Auch Akademiker und Botschafter anderer Länder kommen und fragen neugierig, wie es denn sein kann, dass wir keine Steuern zahlen. Zum anderen beobachten wir in Paraguay immer wieder – dazu braucht man nur den Mennonitenstand bei der Expo besuchen – dass wir gern auf die wirtschaftliche Tüchtigkeit und auf unsere Missions- und Hilfsprojekte im Land verweisen, meist mit dem unterschwelligen Gedanken, eine Rechtfertigung für die Sonderstellung abzugeben.
Als der Christliche Dienst mit dem ersten großen Projekt, Km 81, 1951 gegründet wurde, war dies ausdrücklich das Motiv. Es wurde von MCC-Vertretern so vorformuliert. Der C.D. sollte ein Dankeschönprojekt an die Regierung sein dafür, dass sie uns aufgenommen und die Privilegien gegeben hatte.(13) Und nicht selten, im Nachhinein, wenn von irgendeinem Winkel her kritische Anfragen kamen, hat man gern auf Km 81 oder andere Projekte verwiesen, um dafür zu argumentieren, dass Mennoniten dem Lande doch nichts schuldig bleiben, dass sie trotz Wehrfreiheit ihren Beitrag oder mehr als das leisten. Bei einer Gelegenheit, als ich mit Vertretern einer ausländischen Botschaft über den C.D. sprach, meinte ein Mann achselzuckend: „Ja, wenn ihr keine Steuern zahlt, könnt ihr euch schon ein paar Wohltätigkeitsprojekte leisten“.
Kurz gesagt, es hat sich in Paraguay eine Symbiose ergeben, in der die Bevölkerung uns, wenn auch nur sehr vage definiert, als privilegierte Volksgruppe ansieht und erwartet, dass wir uns diese Stellung irgendwie „verdienen“ müssen. Auch bei uns herrscht eine ähnliche Auffassung. Ein Schreiber aus unserer Mitte äußert sich in seinem Buch besorgt: „Der Chaco ist kultiviert und erschlossen. So ergibt sich die Frage, womit wir bereit sind, heute für unser Glaubensprinzip Opfer zu bringen.“(14)
Es wird zu bedenken sein, welche Aufgaben, vielleicht auch welchen Ballast diese Eigenart der geschichtlichen Entwicklung uns heute mitgibt. Es wird zu fragen sein, wie die Begründung für politische Abstinenz und für die Wehrlosigkeit von der theologischen Ebene auf eine mehr pragmatische, somit eigennützige Ebene verlagert wurde. Damit musste der Überzeugungscharakter dieser Grundsätze geschwächt werden.
Es entging der russischen Bevölkerung nicht, dass Mennoniten während des Ersten Weltkriegs, wo das Land fast verblutete, strikt wehrlos waren, aber als die Banden die Kolonien bedrohten, fast über Nacht wohlbewaffnete Selbstschutzgruppen da standen, militärisch durchaus tüchtig.(15) Während der völkischen Krise in Fernheim stand die Wehrlosigkeit wieder auf dem Tapet, weil es allen einleuchtete, dass man nach der Rückkehr ins Reich zu den Waffen greifen müsste. Kliewer bemühte sich die Leute zu überzeugen, dass Wehrlosigkeit nie ein wirklicher Glaubensartikel der Mennoniten gewesen sei, sondern nur eine persönliche Überzeugung. Wo diese eben nicht da sei, könne man genauso gut Christ sein und trotzdem zu den Waffen greifen.(16) Die Zahlenangaben sind unsicher, aber es ist klar, dass ein guter Teil der Fernheimer und Friesländer bereit waren hierauf einzugehen. Da das MCC so stark auf Wehrlosigkeit gepocht hatte, kam wiederholt der Hinweis von hier, dass ja in Nordamerika auch viele Gemeinden das Prinzip aufgegeben hätten, dass man folglich keine Vorhaltungen machen könne.
Als 1947 der erste Überfall der Ayoreos auf mennonitische Siedler verübt wurde, rief man das Militär herbei, während unsere Jungen mit geschulterten Mausergewehren nachts in den Straßen der nördlichen Dörfer patrouillierten. Die Liste könnte zweifellos verlängert werden, wobei man hinzufügen muss, dass es immer Ausnahmen gab, Stimmen, die dafür plädierten die angestammte Überzeugung gründlich zu durchdenken, bevor man handelte.
Was die Politik betrifft, haben wir in Paraguay unter Stroessner meist beteuert, eine unpolitische Gemeinschaft zu sein oder sein zu wollen, und es hat viele Personen in den eigenen Reihen überrascht, wie schnell wir nach dem Februar 1989 diese Position revidiert haben. Wie wir zuerst noch zögernd, dann aber ziemlich rapide in die Politik eingestiegen sind mit der Begründung, dass ja ein Land wie unseres von christlichen Politikern, die noch Werte haben und Werte vermitteln wollen, nur profitieren kann. Außerdem hat der Christ auch eine weltliche Aufgabe, soll dem Mitmenschen mit seinen Gaben dienen, und wo er das von einer politischen Position aus effektiver tun kann, da ist es gewissermaßen seine Pflicht, es zu tun. Anfänglich war unsere Politik auch noch weitgehend farbenblind, d.h. auf Personen ausgerichtet. Heute sehen wir, dass die Farben auch schon wichtig werden. Somit ist ein weiterer methodischer Schritt in Richtung Integration getan. Frage: Ist es nicht zumindest seit Johann Cornies so, dass wir meinen, eigentlich das Zeug zu haben um unserem Land zu helfen? Der Zar in Russland sah die Tüchtigkeit dieser Landwirte und gab Cornies erstaunliche Vollmachten, um Russen, Tataren und Juden in Südrussland wenn möglich auf die Beine zu helfen. Er zeigte einen großen Dynamismus, zum Teil natürlich mit recht guten Resultaten. Jedenfalls erlebte die eigene Gemeinschaft einen wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung. Als es in Paraguay nach 1989 die Möglichkeit gab und später auch die Aufforderung da war, sich politisch zu engagieren, mögen solche Corniesschen Überlegungen mitgespielt haben, als das Ruder relativ schnell herumgeworfen wurde und Mennoniten mit dem Segen ihrer Gemeinde in die Politik einstiegen.
Impulse aus Yoders Denken für uns
Nach dieser längeren Charakterisierung unserer Denkvoraussetzungen fragen wir nun, welche Impulse aus Yoders Theologie uns evtl. zur Neuorientierung dienen könnten. In der Tat wäre es naiv anzunehmen, dass Yoder die guten Begründungen für unsere Lebenssituation nicht gesehen oder verstanden hätte, dass seine Friedensideale somit an unserer Realität scheitern müssten. Er hörte nicht da auf, wo wir anfingen, sondern er fing genau da an, ging aber weiter. Das bohrende, geduldige Fragen nach den Voraussetzungen der üblichen Argumentation in der christlichen Sozialethik war eine oft bewunderte Eigenschaft an ihm. Ein Argument mag noch so überzeugend klingen, es muss deshalb noch nicht wahr sein. Vor allem werden Christen misstrauisch sein, wenn anscheinend ganz überzeugende Argumente dennoch den klaren Anweisungen des Evangeliums widersprechen.
Es wäre auch grundfalsch anzunehmen, dass er die Russlandmennoniten irgendwie ausgesondert hätte, um sie zu kritisieren oder ihnen eine Lehre zu erteilen. Das theoretische Fundament für seine Ethik entstand im nordamerikanischen Kontext, geprägt von einer zivilen, nationalistischen Religiosität, in der viele Kirchen auch heute noch bereit sind, die Kriegsabenteuer von George Bush ohne Rückfragen abzusegnen. Yoders frühe Auseinandersetzung, schon in den 50er Jahren, drehte sich um die Werke der beiden bekannten Theologen und Ethiker Reinhold und Richard Niebuhr, Lutheraner aus der Missouri-Synode. In ihren Schriften räumen diese beiden ein, dass Machtanwendung, Waffengewalt, polizeiliche wie militärische Funktionen in dieser Welt unumgänglich sind, dass der Christ, als verantwortlicher Bürger dieser Welt, also berechtigt ist solche Funktionen auszuüben, wenn auch mit gewissen Einschränkungen. Es ging also um die These vom gerechten Krieg, so oft Gegenstand der ethischen Diskussion in der Kirche.
Wie schon vorhin angedeutet, gibt sich Yoder hier mit „schlagenden“ Beweisen nicht so schnell zufrieden. Er fängt bei der Christologie an. Dass Jesus Christus als Mensch an einem konkreten Punkt der Geschichte mit seinem Leben, Lehren, Wirken und Sterben uns den Willen Gottes kundgetan hat. Dass er diesen Weg für seine Kirche vorgezeichnet hat als einen gangbaren, realen Weg, der, wenn auch durch Leiden, Marginalisierung, Machtlosigkeit gekennzeichnet, doch der einzige Weg für die Kirche sein kann, die sich als Träger dieser Geschichte sieht. Was wollte Jesus Christus, als er seine Kirche gründete? Aufgrund vorsichtiger neutestamentlicher Exegese sagt Yoder, dass er eine alternative, neue, sichtbare Gemeinschaft in der Welt gründen wollte, die im Zeichen und als Zeuge des kommenden Gottesreiches leben würde. So verstand sich die Urkirche als kleine, oft schwache Gemeinschaft, die auf Kollisionskurs mit der dominanten Gesellschaft im römischen Reich lebte. Eine Gemeinschaft, die verfolgt und verachtet war, weil sie sich zu Christus als dem Herrn bekannte, nicht zum Kaiser, nicht zum Status quo der griechisch-römischen Kulturwelt. Dadurch dass das Christentum im 4. Jahrhundert zur Reichsreligion wurde, trat eine radikale Wende ein. Die breite Masse der Bevölkerung wollte oder sollte christlich werden. Ein christliches Herrschaftssystem musste errichtet werden. Christliche Soldaten, die in den Krieg marschierten, wurden üblich.
Viel Diskussion hat es um Yoder und Konstantin gegeben. Es schien Lesern (auch mir) immer wieder, dass Kaiser Konstantin die ganze Last dieser Wende auf sich nehmen musste. Dem ist nicht so. Schon in seinen früheren Schriften sagt Yoder, dass Konstantin eine Chiffre darstellt für einen Prozess, den die Kirche durchmachte, schon vorher und in verstärktem Masse nachher.(17) Der Verlust des Minoritätsstatus brachte für die Kirche ganz neue Probleme. Sie musste jetzt ethische Maßstäbe finden, die der breiten Volksmasse mehr oder weniger angepasst waren. Sie musste, wie Yoder sagt, die Seele der Gesellschaft werden. Sie musste einen gemeinsamen minimalen ethischen Nenner finden, der realistisch erschien, der politisch gehandhabt werden konnte. Solche Manövrierung machte die Ethik der Bergpredigt von vornherein utopisch. Manche Kirchenväter ließen es sich eine Menge Apologetik kosten, diese neue Sachlage zu begründen, sie doch schlecht und recht in die christliche Weltanschauung zu integrieren.(18)
Es ist nicht die Berufung der Kirche, die Ruder der Staatsgeschäfte zu führen, es ist nicht ihre Aufgabe, eine minimale Ethik für die Welt bereitzustellen. Der Staat ist Teil der Schöpfungsordnung Gottes, er soll eine Gesellschaft garantieren, in der sich die Kirche entfalten kann, aber er ist ein vorübergehendes Phänomen. Denn das eigentliche Ziel der Geschichte ist das kommende Gottesreich, welchem die Kirche jetzt zeichenhaft (sakramental) entgegenlebt. Deshalb, so Yoder, ist die Handlung richtig, die der Gestalt des kommenden Reiches entspricht.(19)
Die Urkirche hatte ein bescheidenes Konzept von Macht und Machthabern. Ob der Kaiser gut war oder weniger gut, spielte nur eine untergeordnete Rolle, denn der Herr der Geschichte ist Gott, nicht die jeweiligen politischen Machthaber. Die Gesellschaft fällt noch längst nicht auseinander, wenn der Herrscher nicht christlich ist.(20) Der Fortschritt der Geschichte liegt nicht in den Händen der Mächtigen, sondern der Schwachen, sagt er mit Tolstoi und M. L. King. Für die Kirche ist ein Leben nach den ethischen Vorgaben des Evangeliums eine sichtbare Proklamation. Sie betrachtet die Geschichte doxologisch, liturgisch, von ihrem göttlichen Ursprung her, auf ihr göttliches Ziel hin. Die Kirche ist nicht verantwortlich für die „Effektivität“ ihres ethischen Handelns, wohl aber für ihre Treue dem Herrn gegenüber. „Die christliche Gemeinschaft ist die einzige Gemeinschaft, die davon ausgeht, dass sie nicht herrschen braucht, weil Christus herrscht.“(21) Es war von vornherein ein Fehler, dass die Kirche in die Rolle des Moralwächters für die ganze Gesellschaft geschoben wurde, sich schieben ließ. Und Yoder fügt hinzu, wenn es möglich wäre, die Welt mit solchen Mitteln zu christianisieren, dann hätte die Kirche über mehr als 1500 Jahre reichlich Gelegenheit dazu gehabt. Das Experiment hat sich als nicht durchführbar erwiesen. „Laß die Kirche Kirche sein“, plädiert er in einer Vorlesung.(22) Trotzdem schafft er keinen Kirche-Welt-Dualismus, bei dem dann wieder die Aufgabenbereiche des Christen in zwei Sphären geteilt werden könnten. Der einzig zulässige Dualismus, sagt er, ist der zwischen Männern und Frauen, die Jesus als den Herrn bekennen, und solchen, die es nicht tun.(23)
Darf ein Christ hohe politische Ämter bekleiden oder nicht? So ist mit Bezug auf Yoder oft gefragt worden. Er würde uns keine „ja – nein“ Antwort geben. Sein Buch „Die Politik Jesu“ ist wohl oft als affirmative Antwort verstanden worden. Er geht jedoch in diesem Werk der Frage nach, wie die Politik Jesu aussah. Dass wir, auch als Christen, politisch relevant sind, darüber besteht kein Zweifel. Jede Handlung, die öffentlichen Charakter und Konsequenzen hat, ist eine politische Handlung. Insofern war Jesus in seinem Auftreten auch, und sogar stark politisch relevant. Zu beachten ist jedoch die Methode. Diese war eben der Weg des Kreuzes, in bewusster Ablehnung jeder Versuchung, nach Machtmitteln zu greifen um seine Sendung zu erfüllen. Dass Christen politisch Einfluss nehmen dürfen, evtl. sogar gefordert sind dies zu tun, wenn es darum geht die Gesellschaft gerechter, humaner zu gestalten, Missbräuche abzuändern, die Stimme gegen Korruption zu erheben, darüber äußert sich Yoder sehr klar.(24) Er ist jedoch vorsichtig beim Umgang mit Begriffen und würde somit auch hier gleich hinzufügen, dass „politisch Einfluss nehmen“ nicht gleich ist mit „ein politisches Amt bekleiden“.
Mir scheint, Yoder möchte uns darauf aufmerksam machen, dass es keine allzu große Rolle spielt, ob jetzt ein mennonitischer, ein katholischer oder ein baptistischer Christ ein politisches Amt bekleidet, oder gar ein Nichtchrist. Wie die Kirche in diesem Land ihr Kirche-sein lebt, das wäre ihm wichtiger. Und auch die Verständigung der verschiedenen Kirchen untereinander, ihr geschlossenes Zeugnis für das Reich Gottes, sieht er als unerlässlich. „Wo Christen nicht zueinander finden, da ist das Evangelium an dem Ort nicht wahr“ sagt er.(25) Allein diese Aussage dürfte manchen Stoff zum Nachdenken liefern.
Müssen wir das, was wir an Hilfsprojekten schon durchführen oder noch gern tun möchten, als Vorzeigeschild brauchen? Als Rechtfertigung für irgendeine Sonderstellung im Land? Müssen wir damit irgendetwas erkaufen? Können wir nicht einfach sagen, wir betreiben Km 81, Kinder- und Altenheime, weil es uns der Herr im Evangelium so befiehlt? Können wir nicht einfach sagen, wir treten ein für Wehrdienstfreiheit, für Friedenserziehung, für friedliche Methoden des Zusammenlebens, weil der Herr uns diesen Weg vorgezeichnet hat? Können wir da wo politisch Einfluss genommen wird, danach schauen, dass es um gerechtere Lebensbedingungen für alle Menschen im Land geht, wie W. Thielmann es schon 1989 in einem Vortrag formulierte?(26) Uns allen liegt die Situation des Landes schwer am Herzen. Im Zuge der Demokratisierung ist auch ein erschreckendes moralisches Defizit sichtbar geworden. Wir als christliche Kirchen im Land stehen ziemlich ratlos da mit der Frage: Was ist passiert – wie konnte solch ein Vakuum entstehen, wo doch alle Kirchen meinen, ihren redlichen Teil zur Evangelisierung des Landes beizutragen? Und es ist sicher eine aufrichtige Sorge um unser Land, die manche Leute aus unseren Reihen in politische Ämter geführt hat. Dagegen ist auch möglicherweise kein Einspruch zu erheben. Yoders prophetische Stimme mahnt uns jedoch, ein gesundes Maß an Skepsis zu entwickeln und macht zugleich Mut, Wege zu suchen um Kirche zu sein, die sich dem Evangelium, dem Weg des Kreuzes verpflichtet weiß.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Bibliographie:
Bibliographie:
- Dürksen, Heinrich, Dass du nicht vergessest der Geschichten. Lebenserinnerungen von Heinrich Dürksen, Filadelfia, 1990.
- Hauerwas Stanley et. al. ed., The Wisdom of the Cross. Essays in Honor of J. H. Yoder, W. B. Eerdmans, Grand Rapids, 1999.
- Postma, Johann Sjouke, Fernheim, fernes Heim, Maschinenschr. Ms., Asunción, 1948.
- Thiessen Nation, Mark, A Comprehensive Bibliography of the Writings of John Howard Yoder, Goshen College, Goshen, 1997.
- Yoder, John Howard, The Ecumenical Movement and the faithful Church, Focal Pamphlet, Scottdale, 1958.
- Yoder, John Howard, The Christian Witness to the State, Faith and Life Press, Newton KS, 1964.
- Yoder, John Howard, The Politics of Jesus, W. B. Eerdmans, Grand Rapids, 1972.
- Yoder, John Howard, Nevertheless, Herald Press, Scottdale, 1976.
- Yoder, John Howard, The Original Revolution, Herald Press, Scottdale, 1977.
- Yoder, John Howard, Preface to Theology: Christology and Theological Method, AMBS Elkhart, 1981.
- Yoder, John Howard, Christian Attitudes to War, Peace and Revolution, Goshen Biblical Seminary, 1983.
- Yoder, John Howard, He Came Preaching Peace, Herald Press, Scottdale, 1985.
- Yoder, John Howard, The Royal Priesthood: Essays Ecclesiastical and Ecumenical, Herald Press, Scottdale, 1998.
Fussnoten:
Nähere Daten bei Mark Thiessen Nation, Mennonitische Geschichtsblätter 1999, S. 199 ff. | |
ebd. | |
Mündliche Mitteilungen von Ewald Reimer, 16. Februar 2004. | |
Mark Thiessen Nation in MQR, Juli 2003, p. 364. | |
J. H. Yoder, He came preaching Peace, Herald Press, Scottdale, 1985, p. 5. | |
Paul Peachy in Mennonite Encyclopedia, Vol. V., Scottdale 1990, p. 738. | |
Mark Thiessen Nation in MQR, Juli 2003, p. 364 | |
J. H. Yoder, The royal Priesthood, M. Cartwright ed., Herald Press, Scottdale, 1994. | |
Siehe die Vorträge beim Symposium am Bienenberg, www.peacetheology.org. | |
Mennoblatt Nr. 2, 2004, S. 9. | |
Harry Löwen/James Urry, Protecting Mammon, JMS, 1991, p. 34 ff. | |
Mündliche Mitteilung von Dr. John Schmidt, 8. 3. 1997. | |
H. Dürksen, Dass du nicht vergessest der Geschichten, Filadelfia, 1990, S. 202. | |
Vgl. Anton Sawatzky, Wer das Schwert nimmt…, Mennoblatt Nr. 9, 1958, S. 5. | |
J. H. Yoder, The Christan Witness to the State, Faith and Life Press, Newton, 1977, p. 24. | |
Siehe ebd. p. 87. | |
ebd. p. 136. | |
J. H. Yoder, The royal Priesthood, M. Cartwright ed., Herald Press, Scottdale, 1998, p. 178. | |
ebd. S. 177. | |
ebd. S. 168. | |
ebd. S. 171. | |
Mennonite political conservatism, Vortrag im CMBC, Winnipeg, 1979. Kassette davon in der Bibliothek des CEMTA. | |
J. H. Yoder, The royal Priesthood, M. Cartwright ed., Herald Press, Scottdale, 1998, p. 291. | |
Podiums- und Plenumsdiskussion
Zusammengefaßt von Beate Penner
Unter diesem Thema fand am Freitag, den 21. Mai, abends eine Podiums- und Plenumsdiskussion statt. Geleitet wurde die Diskussion von Hans Theodor Regier. An dem Gespräch beteiligten sich Michael Rudolph, David Sawatzky, Jacob Harder, Heinz Ratzlaff, Gundolf Niebuhr und Hermann Ratzlaff.
Zuallererst wurde definiert, was Politik überhaupt ist. Mit einer Definition aus Meyers Handlexikon wurde diese Frage eingeleitet: „Politik ist berechnendes auf Durchsetzung bestehender Ziele gerichtetes Verhalten, u.a. durch Führung und Vertretung eines Gemeinwesens auch eines Interessenverbandes oder einer Partei.“ Dazu kamen dann einige Kurzdefinitionen der Podiumsteilnehmer:
„Politik ist die Sorge um das Gemeinwohl, in anderen Worten, jeder der mithilft, dass sich in der Gesellschaft etwas verändert, ist politisch“ und „Politik ist die Gestaltung einer öffentlichen Ordnung“. Eine weitere Bestimmung aus Meyers Handlexikon lautet: „Aus der Interessenbestimmtheit ergibt sich der Kampfcharakter der Politik, es geht um Machterwerb und Machterhalt und nicht notwendigerweise nur um das Gemeinwohl.“ Was soviel heißt, dass es in der Politik nicht nur um christliche Nächstenliebe und Sorge um den Mitmenschen und das allgemeine Wohl geht, sondern dass meistens sehr starke individuelle und parteipolitische Interessen vertreten werden. Dabei ist es unumgänglich, Macht auszuüben. Und dies geschieht nicht immer in positiver Hinsicht. Oft wird die Macht missbraucht. Es wurde festgestellt, dass Politik zunächst einmal wertfrei ist. Ob sie nun gut oder schlecht ist, hängt davon ab, wer die Politiker sind und wie sie mit der ihnen anvertrauten Macht umgehen. In der mennonitischen Gesellschaft wurde Politik bisher als etwas Negatives angesehen. Schon in Russland und Kanada und auch bis vor einigen Jahren noch in Paraguay zog man sich so gut wie möglich aus der Politik zurück. Man war der Meinung, Politik sei nichts für Mennoniten. Heute gilt es, das Konzept von Politik zu revidieren.
Daraufhin ging man über zu der Frage, was eigentlich der Unterschied zwischen Staats- und Koloniepolitik sei. Auf diese Frage ging man nur sehr kurz ein. Der einzige Unterschied, der genannt wurde, war der, dass die Staatspolitik in Parteien organisiert und dementsprechend Politik ausgeübt werde, während in der Koloniepolitik ohne offiziell organisierte Parteien gearbeitet wird. Inoffiziell unterscheiden sich die politischen Strategien aber oft nicht.
Dann nahm man Stellung zu folgender Frage: Warum dürfen oder sollten sich Mennoniten an der Politik beteiligen? Was bei diesem Punkt klar gesagt wurde, war dass im Prinzip jeder politisch sei. Politisch sein bedeutet nicht nur ein politisches Amt zu bekleiden. In einer demokratischen Republik sei es unmöglich, dass ein Bürger nicht politisch sei; egal was er tue. Wenn man beispielsweise wählen geht, ist man politisch. Geht man nicht wählen, ist man auch politisch. Dass die Mennoniten sich also politisch beteiligen ist unumgänglich. Das haben sie auch schon seit 1927, seit sie in Paraguay leben, getan. Bisher zwar unbeabsichtigt und auch nicht öffentlich. Einige Beispiele, die diesbezüglich erwähnt wurden:
- Die Mennoniten im Chaco wurden im Chacokrieg 1932-1935 von der nationalen Regierung als politisches Werkzeug eingesetzt.
- Die Mennoniten beschleunigten den Bau der Ruta Trans Chaco und die Elektrifizierung im Chaco.
Aufgrund dieser Tatsachen sollte man die Fragestellung anders formulieren. Anstatt zu fragen, ob sich die Mennoniten an der Politik beteiligen dürfen bzw. sollen, müsste man lieber fragen: Wie sollen sie sich beteiligen? Wir als mennonitische Gemeinschaft haben dem Landesvolk auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene viel zu bieten. Unser Kooperativswesen und unsere Nachbarschaftshilfe wurden und werden im Land immer noch als vorbildlich angesehen. Gewarnt wurde jedoch vor einem Gefühl der Erhabenheit und Überlegenheit. Eine Aussage, die mehrere Male fiel, war ähnlich: Wenn wir in die öffentliche Politik einsteigen, sollten wir dies nicht als Mennoniten tun, sondern als gebürtige Paraguayer, die öffentlich die Gelegenheit nutzen, mennonitische Werte und Prinzipien vorzuleben und zu vermitteln.
Die Beteiligung an der Politik hat zur Folge, dass man ab jetzt nicht mehr von den „Stillen im Lande“ sprechen wird. Es wird einen sozialen Wandel geben, die eigene Identität und unser Image nach außen werden sich verändern. Es liegt an uns, ob zum Positiven oder zum Negativen.
In diesem Zusammenhang ergab sich auch die Frage, wieso wir als Mennoniten uns überhaupt an der öffentlichen Politik beteiligen wollen. Welches sind unsere Motive und unsere Absichten? Handeln wir nur aus christlicher Nächstenliebe? Geht es uns darum, unserem armen Landesvolk weiterzuhelfen oder verfolgen wir eigene Interessen?
Anschließend nahm man Stellung dazu, ob die Mennoniten für ihren schnellen Einstieg in die öffentliche Politik überhaupt entsprechend vorbereitet seien. Tatsache ist, dass die Mennoniten in Paraguay bis vor 15 Jahren politisch gesehen vermeintlich abstinent lebten. D.h. es gab keine öffentliche Beteiligung von Seiten der Mennoniten. In den letzten 10 Jahren sind sie aber so rapide ins politische Rampenlicht geraten, dass man sich fragt, ob sie für solche Aufgaben und Ämter entsprechend vorbereitet wurden; ob sie wissen, wie sie mit der ihnen anvertrauten Macht umgehen sollen.
Ein Teilnehmer war der Ansicht, dass die Mennoniten einerseits gut vorbereitet sind. Unsere Gesellschaft ist vergleichbar mit einer demokratischen Schule. Die ganze Gemeinschaftsarbeit ist eingeteilt in Komitees. Über die Hälfte der Gesellschaft arbeitet in einem Komitee. Das bedeutet, dass man lernt sich einzubringen, mitzuplanen, mitzudenken und mitzugestalten. In dieser Hinsicht sind sie seiner Meinung nach gut vorbereitet. Wo sich noch ein Mangel bemerkbar macht, ist im Gesellschaftsdruck. Es ist bisher noch so, dass viele Leute nicht den Mut haben, ihre eigene Meinung zu äußern und diese dann auch zu vertreten. Andersdenkende haben es oft noch sehr schwer in unseren Gemeinschaften.
Ein Teilnehmer antwortete nicht darauf, ob wir gut genug vorbereitet sind, sondern gab folgenden Ratschlag: Es ist nicht wichtig und auch unmöglich, dass wir uns alle öffentlich beteiligen. Wichtig wäre, dass wir die besten Leute vorbereiten, ausbilden und fördern und sie nach dem öffentlichen Eintreten nicht alleine stehen lassen, sondern sie weiterbegleiten.
Als letzter Punkt wurde ein ganz aktuelles Thema angesprochen: Welche Vor- und Nachteile hat die Tatsache, dass die Ehefrau des Staatspräsidenten Gloria Duarte Frutos Glied der mennonitischen Gemeinde ‘Raíces’ ist? Man ging weniger auf die Vor- und Nachteile ein, sondern sprach von Gefahren, die diese Tatsache mit sich bringt. Es ist gefährlich, Glaube und Politik zu nah zusammen zu bringen. Der Glaube kann leicht missbraucht werden, indem man die Bibel als Vorwand für sein Handeln gebraucht. Außerdem wurde davor gewarnt, in eine unkritische Euphorie zu verfallen. Vergessen wir nicht, bis vor kurzer Zeit sprach man wenig von den Mennoniten. Jetzt stehen sie häufig in den Schlagzeilen.
An der darauf folgenden Plenumsdiskussion beteiligten sich außer diesen sechs Podiumsteilnehmern noch weitere Teilnehmer in den Bänken. Man ging auf Themen ein, die im Podium schon angesprochen wurden, es wurden aber auch neue Themen bzw. Fragen aufgeworfen.
Zusammenfassend wurden hauptsächlich folgende Punkte diskutiert:
- Kann man denn wirklich ein politisches Amt bekleiden ohne einer politischen Partei anzugehören? Wie will man ein Projekt durchführen oder etwas durchsetzen, wenn man keine Partei im Rücken hat, die einem die dafür notwendige Macht vermittelt? Daraufhin sprach Herr Heinz Ratzlaff über seine eigenen Erfahrungen in der öffentlichen Politik. Er habe in seiner fünfjährigen Amtsperiode als Abgeordneter keiner politischen Partei angehört, was aber nicht heiße, dass er bei Projekten oder sonstigen Tätigkeiten nicht von einer Partei unterstützt worden sei und deren Vertrauen genossen habe. In diesem Zusammenhang wurde von einem Teilnehmer bemerkt, dass man bei den Wahlen sowohl in der Parteipolitik als auch in der Koloniepolitik zu sehr personenorientiert wähle. Man sollte vielmehr Programme ausarbeiten und präsentieren und daraufhin Personen zur Wahl stellen, denen man das Vertrauen schenkt, dass sie diese Sachprogramme ertragreich durchführen könnten.
- Angesprochen wurde auch hier noch einmal die Frage, die schon im Podium diskutiert wurde: Sind wir genügend vorbereitet für unseren relativ schnellen Einstieg in die öffentliche Politik? Von mehreren Wortmeldungen gab es keine, die diese Frage mit einem klaren Ja beantwortete. Die Meinung allgemein war, dass wir mit einer zu optimistischen Einstellung eingestiegen sind. Wir sollten weniger glauben, die (wie es ein Teilnehmer ausdrückte) „Alleinseligmachenden“ zu sein, sondern mehr an die positiven Seiten und Eigenschaften unserer Mitbürger glauben und sie und ihre Glaubenseinstellung akzeptieren. Erst dann werden wir positiv zusammenarbeiten können.
- Während des Abends fiel immer wieder der Ausdruck, dass wir in der Politik die Gelegenheit nützen sollten, als Paraguayer mennonitische Werte zu vermitteln. Ein Teilnehmer machte darauf aufmerksam, dass zu pauschal von Werten gesprochen werde. Welche Werte wollen wir als Mennoniten denn überhaupt vermitteln? Und um diese vermitteln zu können, müssten sie erst einmal konkret definiert werden. Da wäre z.B. die Wehrlosigkeit. Was verstehen wir überhaupt unter Wehrlosigkeit. Bedeutet es nur, ohne Waffe zu gehen oder Konflikte ohne sie zu lösen? Ist ja gut, wenn man das so macht. Aber was ist dann mit den Mennoniten, die tausende Hektar Land besitzen und ihren Besitz und ihr Vermögen immer mehr erweitern, ohne darauf zu achten, dass ärmere Leute dabei unter die Räder kommen. Ist das gerecht? Verstehen wir so die Wehrlosigkeit?
- Zum Schluss der Diskussion wurde noch einmal das aktuelle Thema der Gemeinde Raíces in Asunción angesprochen. Ein Teilnehmer machte dazu einen Vergleich aus der Geschichte. Er verglich die Situation und Sachlage der genannten Gemeinde mit der Kirche zur Zeit Konstantins. Damals war es so, dass die Kirche plötzlich maßgebend für alle wurde und so entstand die mittelalterliche Staatskirche. In Paraguay scheint es jetzt so, dass die Mennonitengemeinden, besonders die Gemeinde Raíces, ins Rampenlicht geraten sind und von allen scharf im Auge behalten werden. Wo dies hinführt können wir noch nicht sagen. Klar ist, dass die Gefahr da ist, den Fehler aus der Geschichte zu wiederholen, und zwar den, dass die Kirche als Mittel zum Zeck gebraucht wird. Davor sollten wir uns in Acht nehmen.
Wertende Stellungnahme
Interessant und von vielen Teilnehmern als positiv angesehen war, dass an diesem Abend nicht nur grundlegende Einstellungen und Konzepte über Politik diskutiert wurden, sondern dass man auch ganz aktuelle Themen ansprach.
Es war immer wieder herauszuhören, dass sich die mennonitische Gesellschaft in Paraguay sehr geändert hat. Es wäre beispielsweise vor 20 Jahren nicht denkbar gewesen, eine Diskussion in solch einem Rahmen überhaupt durchzuführen. Heute, so ein Teilnehmer, sollten wir es als Stärke ansehen, dass wir fähig sind, über neue Sachen nachzudenken und anders denken zu lernen, und infolgedessen neue Erkenntnisse gewinnen. Von dieser Änderung in der Gesellschaft, d.h. von diesem Mut anders denken zu lernen, zeugte auch die breite Spanne zwischen den einzelnen Meinungen. Die Meinungen gingen von einem Extrem ins andere. Einige Teilnehmer behaupteten beispielsweise, wenn unsere Politiker, die offiziell keiner Partei angehören, fallen, fallen sie in ein bodenloses Loch. Es wäre keine Partei da, die sie auffangen und ihnen wieder auf die Beine helfen würde. Andere Meinungen dagegen waren, dass man nie tiefer falle als in Jesu Arme. Diese Verschiedenheit der Meinungen beobachtete man auch besonders noch, als es um das Thema Mission ging. Einige waren der Meinung, man müsse durch die Beteiligung an der Politik noch mehr die Gelegenheit wahrnehmen unter der Landesbevölkerung zu missionieren. Eine andere Meinung dagegen war, dass die Mennoniten sich und ihren Glauben zu sehr als die ‘Alleinseligmachenden’ ansehen und dadurch zum Ziel haben, das Landesvolk ‘mennonitisieren’ zu wollen. Dieser Teilnehmer appellierte an die Versammlung, mehr an die positiven Seiten unserer Mitbürger zu glauben und weniger darauf zu drücken, dass nur die Mennoniten etwas Gutes leisten können.
Interessant und zu bemerken wäre abrundend noch ein Aspekt, der an diesem Abend nicht so direkt angesprochen wurde. Zu der Zeit, als die ersten Politiker aus unserer Mitte öffentlich in ein Amt einstiegen, gab es in den Gemeinden lange und heftige Diskussionen. Im Allgemeinen war man ganz gegen die öffentliche Beteiligung an der Politik. Heute, knapp ein Jahrzehnt später, wird es gerade von einigen Gemeinden befürwortet, in der Politik mitzuarbeiten und sie so positiv wie möglich zu beeinflussen. Es hat in kurzer Zeit ein großer Wandel stattgefunden. Jeder von uns sollte sich die Frage stellen, ob wir auch zu den Konsequenzen bereit sind oder ob wir aufgrund des schnellen Fortschreitens bald den Boden unter den Füßen verlieren werden.
Herr Jakob Warkentin, Leiter des Geschichtsvereins, schloss diesen Abend mit folgender Anregung: Es sei immer wieder wichtig, dass man begrifflich richtig und sauber argumentiere. Man könne einen Ausdruck verwenden und damit aber etwas ganz anderes meinen, als er in Wirklichkeit bedeute. So sei beispielsweise in unserer Gesellschaft der Begriff ‘Macht’ eigentlich verpönt. Stattdessen spreche man lieber von „Dienst“, übe aber in Wirklichkeit handfeste Macht aus.
Kulturelle Beiträge
Die Vorgeschichte des Hospitals Km 81
Die Würdigung für Dr. John R. Schmidt (und gewiss auch Frau Clara Schmidt) in der letzten Nummer des IM DIENSTE DER LIEBE (Sept.-Dez. 2003, Jahrgang 52) ist treffend und ganz an der Zeit. Dr. Schmidt und Frau haben nicht nur medizinisch für die Leprakranken (u. andere) gesorgt, sondern vielmehr auch geistliche Pflege, Seelsorge und andere Dienste mehr getan und somit der ganzen Station einen sehr hohen „Ton“ gegeben. Die vielen Mitarbeiter, einschließlich auch Dr. Carlos Wiens, wurden somit auf ein hohes Nieveau gestellt, das die ganze Arbeit auf der Station, jeden Patienten und CD Arbeiter beeinflusste und auch die unterstützenden Gemeinden und Kolonien. Km 81 ist ein neues Modell der Missionsarbeit, zu der uns die Nachfolge Christi ruft.
Es kann nun aber gerade uns helfen, wenn wir etwas von der Vorgeschichte des Hospitals Km 81 hören. Viele die diese Geschichte kannten, sind nicht mehr unter uns. „Der Plan war, dass unsere Arbeit ein Dienst an unserem Land als Dank an Paraguay sein sollte,“ sagte Dr. Schmidt, eben weil diejenigen Flüchtlinge aus Russland, die nicht von Kanada aufgenommen wurden, hier ohne Ansehen des Alters, der Gesundheit, usw. Aufnahme – eine neue Heimat – fanden. Viele wanderten später doch von Paraguay nach Kanada aus, aber die gegründeten Kolonien Neuland und Volendam blieben bestehen.
Etwa Mitte der 1940er Jahre hörte man beim MCC schon Diskussion über die Möglichkeit eines Dankprojekts für Paraguay – das schon seit den 1920er Jahre den Mennoniten freundlich gesinnt war. Ob dieses auf Anregung Fernheims oder Mennos geschah, weist die Korrespondenz nicht auf. Jedenfalls wurden die leitenden Leute in Nordamerika und im Chaco sich einig, dass es Lepra (Hansen) Arbeit sein sollte. Außer dem Gefängniß und dem großen Sammlungszaun in Asunción gab es nur Sapucai, wo ein Frachtzug gelegentlich mehr Kranke hinfuhr. Die Leprastation Sapucai war für mich ein Schock, eine furchtbar traurige Anlage, doch von einer amerikanischen Kirche (Disciples of Christ) unterstützt.
Das MCC bemühte sich sehr, die Lepraarbeit in Gang zu bringen, aber keiner der „Direktoren“ des MCC in Paraguay brachte sie in Schwung. Schließlich schickte MCC fünf Männer nach Paraguay, um mit dem Bauen zu beginnen. Aber wo? Es fehlte an energischer Anleitung. Einer der fünf war Homer Martin, der immer Arbeit fand. Ein anderer war Vernon Neuenschwander, der sich bald allgemein beliebt machte, weil er ein Telefonnetz zustande brachte, damit sich die Dörfer und Kolonien so manche Reise ersparen konnten. Die Anderen fuhren bald zurück nach dem Norden. Dieses war alles, ehe ich am 2. Januar 1949 in Asuncion ankam.
Bald kam auch die Regierung ins Spiel, und zwar boten sie ein großes Landstück nahe bei Concepcion, an – die alte Auffassung – so weit entfernt wie möglich von Siedlungszentren. Als ich das Land darauf besuchte, fand ich 92 Familien da ansässig, die meisten schon viele Jahre. Als ich den Major, der mich herumfuhr fragte, was nun zu machen sei, meinte er einfach, dass er sie alle mit militärischer Gewalt umsiedeln würde. Dies gefiehl mir aber gar nicht. Ich bat ihn nichts dergleichen zu unternehmen, ehe er von mir hören würde, welches er mir auch versprach.
Mittlerweile hatten sich ganz neue Behandlungsmethoden in Carville, LA (USA) und in Brasilien entwickelt. Die alte Methode, die Leprakranken in einem entlegenen, abgezäunten Gebiet einzusperren, wie in Sapucai, wich der neuen Methode der ambulanten Behandlung in einem modernen Hospital. Ich reiste bald nach Brasilien, um zwei solcher Hospitäler zu besuchen und war tief beeindruckt. Es schien mir klar, dass solch ein Hospital am besten in der Nähe Asuncións liegen sollte, welches auch Dr. John Schmidt vor kurzem betont hatte. Also ging es nun wieder auf die Landsuche, wobei uns die Regierung ganz zur Seite stand.
Eines Nachts träumte ich: Ich sah eine kleine Anhöhe rechts der Ruta, auf der ich noch nie gefahren war, und gerade da, träumte ich, sei die Lepra Anstalt. Morgens kam mir der Traum etwas komisch vor, aber so ist es eben. Nach etlichen Tagen fuhr ich mit unserem Jeep auf die Ruta, um die neu eingewanderten Mennoniten aus Kanada, die südlich angesiedelt hatten, zu besuchen und -Wunder der Wunder – da sah ich beim Dorf Itacurubi zur Rechten der Ruta die hügelige Anhöhe, die ich im Traum gesehen hatte. War dieses eine Leitung des Geistes, eine Gebetserhörung? Auf dem Rückwege hielt ich in Itacurubi an (ja es war auf Km 81) und holte mir mehr Information.
Von Asunción schickte ich dann unseren treuen Helfer Juan (Hans) Neufeld nach Km 81, um die Kaufmöglichkeit des Landes zu erkundigen. Es waren insgesamt etwa 1148 Hektar (2,835 Acker) und das Land war tatsächlich zum Verkauf angeboten. Zwei kleine Flüsschen liefen querdurch . Nun telegrafierte ich sofort dem MCC Akron diese Nachricht und bat um das nötige Geld für den Kauf. Ich musste recht anhalten, aber schließlich kam es. Am 28. Februar 1951 schrieb ich an Orie Miller in Akron, dass der Kaufvertrag für das Land unterschrieben sei und Hans Teichgraef und Frau aus Filadelfia bald kommen würden, um auf dem Lande als Aufseher zu wohnen, damit nicht andere Fremde sich da niederlassen würden. Auch würde er mit Ackerbau und einem Garten beginnen. Teichgraef sprach nicht nur Deutsch, sondern auch Spanisch und Guaraní, ein großer Vorteil!
Ein wohlhabender Mann, Manuel Ferreira, in Asunción bot sich an, dem Projekt 200 Kühe zu Gs. 200, 100 junge Kühe zu Gs. 160, und 15 Bullen zu je Gs. 600. zu verkaufen, sie sogar alle mit einem Brandmal zu versehen und sie uns auf Km 81 abzuliefern. Wir nahmen dieses Angebot an.
Also, endlich hatten wir das nötige Land und konnten die ersten Schritte zum Aufbau der Klinik unternehmen. Die amerikanische Lepra Mission (ALM) in New York hat mit gutem Rat und wesentlichen finanziellen Beiträgen dem Projekt viel geholfen, sich ursprünglich bis zu 60% der Unkosten zu tragen verpflichtet, doch weiß ich nicht, wie es schließlich ablief. Am 17. April 1951 schickten wir MCC Akron auch unseren weiteren Wunschbrief, um den Aufbau zu beginnen – in der Gesamtsumme von $25.000 – etwa Gs. 500.000, natürlich nach dem Wert des Geldes vor 50 Jahren. Dieses schloss viel ein, einen größeren LKW, verschiedene Sorten Stahl für Zementbau, einschließlich dass Errichten eines Wasserturms, usw. Zement, Glas, Badezimmer-Einrichtungen. Alles nötige Holz usw. sollte in Paraguay gekauft werden.
Am 23. August 1951 fuhren die John R. Schmidt-Familie, zusammen mit der Robert Unruh-Familie von New York ab auf dem Schiff S. S. Brazil mit dem Endziel Asunción. Dr. Schmidt hatte früher schon vier Jahre im Chaco als Arzt gedient. Unruh wollte den Betrieb der Chaco Experimental Farm (Versuchsstation) übernehmen. Ich reiste Ende Mai zurück nach Kanada-USA zu weiterem Studium. Doch vorher hatten wir vom MCC und dem Hilfskomitee in Filadelfia die erste Auflage unseres Nachrichtenblatts für Km 81 fertig gestellt und mit dem Namen Im Dienste der Liebe versehen, wie es auch heute noch heißt. Das war im Jahr 1951. In diesen Tagen habe ich den 52. Jahrgang erhalten! Dem Herrn die Ehre und denen, die auf Km 81 weiter arbeiten, Freude, Erfolg, und Gottes Segen.
Mein Auftrag vom MCC, als ich meine Arbeit von Europa nach Südamerika verlegte, war zwiefältig: mit den Flüchtlingsansiedlungen in Neuland, Volendam und Uruguay sowie auch mit allen Mennoniten den Kontakt aufrecht zu erhalten und, zweitens, die Lepra-Anstalt endlich in Schwung zu bringen. Mit Km 81 unter Dr. Schmidts kommender Leitung war ich wohl zufrieden und hatte auch keine weiteren Träume! Mit der Ansiedlung der Flüchtlinge, die ich meistens aus meiner Arbeit her in Fallingbostel, Gronau usw., kannte, war es mir doch schwer. Wenn ich, z.B. an Friedensheim (das „Frauendorf“) denke, oder wie die Frauen und Kinder in Volendam beim Waldroden schufteten, dann ist es mir immer noch schwer. Da habe ich meine MCC-Aufgabe nicht genügend erfüllt, aber ich tat, was ich konnte, schaffte den ersten „Bulldozer“ an zum Straßenbau—was endlich zur Ruta nach Asuncion zum Markt führte usw. So ist es einmal – Asi es la vida! Vaya con Dios!!
Cornelius J. Dyck, Prof. im Ruhestand
Associated Mennonite Biblical Seminary
Elkhart, Indiana 46517
e-mail: cjwdyck@juno.com
Associated Mennonite Biblical Seminary
Elkhart, Indiana 46517
e-mail: cjwdyck@juno.com
Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben für seinen Freund hingibt.
Zum Andenken an die Opfer der Brandkatastrophe am 1. August 2004 in Asunción und den Hinterbliebenen gewidmet, die fortan damit leben müssen dass ein Platz in ihrem Herzen und ihrer Seele leer bleibt.
Der 39jährige Marco Gutiérrez war Unternehmer und reiste momentan durchs ganze Land, um die ersten Kontakte für sein vor Kurzem gegründetes Unternehmen zu knüpfen. Er war wenige Stunden zuvor von einer längeren Dienstreise zurückgekehrt und war froh, nun endlich wieder bei seiner lieben Frau Victoria und seinen beiden Kindern Ariel und Alissa sein zu können. Der sechsjährige Ariel hatte die Ankunft seines Vaters kaum abwarten können. Ständig hatte er nachgefragt, wann der Papa endlich kommen würde. Er liebte seinen Papa über alles, und sie verbrachten viel Zeit miteinander.
Marco war glücklich. Ihm waren einige viel versprechende Angebote gemacht worden und er war voller Hoffnung, dass sein eben gestartetes Projekt gelingen würde. Ein guter Grund, um mit seiner Familie zu feiern. Marco lud seine Familie ein, beim Supermarkt Ycuá Bolaños essen zu gehen. Dieses gigantische Einkaufszentrum war nah gelegen und verfügte neben einem Schnellrestaurant auch über ein Spielzimmer. Auch die Nichten von Victoria, Jennifer und Sandra, befanden sich gerade bei Gutiérrez, da ihre Eltern verreist waren.
So machte sich die Familie an diesem 1. August, einem sonnigen Sonntagmorgen, um etwa 10 Uhr auf den Weg. Victoria wollte vor dem Essen noch einige Sachen für den Haushalt kaufen. Alle waren bester Laune und froh über die Einladung.
Während Ariel mit Jennifer und Sandra durch den Raum spazierten, erledigten Victoria und Marco den Einkauf. Marco kutschierte den Einkaufswagen, auf dem der Kindersitz der erst viermonatigen Alissa befestigt war. Alissa strahlte ihren Vater an. Marco wurde von einem Gefühl des Stolzes und des Glücks durchflutet.
Nachdem Marco und Victoria die Sachen bei der Kasse bezahlt und in ihrem Wagen, der sich im Erdgeschoss befand, verstaut hatten, begaben sie sich in den „Patio de comidas“, wo sich Jennifer, Sandra und Ariel bereits an einem der wenigen noch unbesetzten Tische niedergelassen hatten. Der Geruch eines guten Asados durchflutete den Raum. Auf dieses Essen hatte Marco sich schon gefreut. Es schien ihm eine angemessene Belohnung für all seine Errungenschaften während der letzten Woche zu sein. Nachdem das Tischgebet gesprochen worden war, holte sich jeder etwas nach seinem Geschmack.
Nachdem Marco sich noch ein saftiges Steak vom Rost geholt hatte, gingen Jennifer und Sandra noch einmal ins Einkaufszentrum, um sich in der Kleiderabteilung nach einem passenden Rock für die Geburtstagsparty ihrer Freundin umzuschauen. Die Feier sollte zwar erst in einer Woche stattfinden, doch man musste sich zeitig um so wichtige Dinge wie um Kleidung kümmern. Da auch Victoria noch beim Essen war, boten sich die Mädchen an, Alissa mitzunehmen. Victoria schaute zu Marco, dieser nickte nur kurz, und die drei Mädchen verschwanden in dem von Menschen gefüllten Raum, nachdem sie abgemacht hatten, sich in ungefähr einer halben Stunde am Ausgang zu treffen.
Marco, Victoria und Ariel befanden sich noch im „Patio de Comidas“, als sich die erste Explosion ereignete. Die im ersten Moment eingetretene und durch den Schock verursachte Stille wurde jedoch sofort von einem Geschrei der Panik und Angst abgelöst. Die Menschen liefen durcheinander, ein Stimmengewirr stellte sich ein, Namen wurden gerufen, Leute klammerten sich aneinander und versuchten im Rauch den Ausgang zu erkennen. Die aus dem Speisesaal entflohenen Leute strebten dem Ausgang an der Santísima Trinidad-Straße zu. Auch Marco und Victoria ergriffen den kleinen Ariel beim Arm und schleppten ihn förmlich aus dem Saal. Während sie dem Ausgang zustrebten, hielten sie Ausschau nach den drei Mädchen, von denen jedoch keine Spur zu sehen war. Vielleicht waren sie ja schon am Eingang und warteten auf sie. Mit dieser Hoffnung eilten sie auf die Straße.
Die Personen im Einkaufszentrum zeigten zwar eine besorgte Miene, von Panik war hier jedoch noch keine Spur. Die Detonation war hier nicht so klar vernommen worden. Auch Jennifer und Sandra hatten den dumpfen Klang gehört, sich jedoch nichts darunter vorstellen können. Während Sandra einen rotgestreiften Rock anprobierte, schaute sich Jennifer nach einer dazu passenden Bluse um. Weiß müsste sie schon sein, sonst passte sie nicht zum Rock. Doch entweder waren die Blusen zu klein oder sie waren zu groß. Typisch. Wenn man schon was Gutes findet, passt es nie. Ärgerlich wandte sie sich von den Blusen ab und ging zurück zu Sandra, die sich für den Rock hatte entscheiden können und ihn nun von einer jungen, attraktiven und freundlichen Verkäuferin einpacken ließ.
Während die Verkäuferin den Rock eingepackte, ereignete sich eine zweite Explosion. Diese war jedoch schon größer, lauter und näher. Es handelte sich um die Autos, die im Erdgeschoss geparkt worden waren, Feuer gefasst hatten und jetzt reihum buchstäblich in die Luft gingen. Sandra zog Jennifer, die Alissa auf den Armen hielt, mit sich, um aus dem Supermarkt zu fliehen. Die Luft wurde dichter und stickiger, je mehr sie sich dem Ausgang näherten. Da hörten sie eine Stimme aus dem Lautsprecher: „Cierren las puertas“.
Marco und Victoria schauten sich verzweifelt um. Ariel klammerte sich ängstlich an Victoria. Doch auch hier war von den Mädchen keine Spur zu sehen. Als sich jetzt die zweite Explosion ereignete und dicker, schwarzer Rauch aus dem Eingang zum Parkplatz hervorquoll, ließ Marco Victoria und Ariel stehen und stürmte entschlossen zurück ins Gebäude. Auf seinem Weg ins Innere, hörte er eine Stimme, die bekanntgab, dass alle Türen geschlossen werden sollten, damit nicht etwa jemand den Raum verlassen könne, bevor er seine Rechnung bezahlt habe. Schert euch zum Teufel, fuhr es Marco durch den Kopf. In dieser Situation konnte man die Leute doch nicht einsperren. Dies ist ein Massenmord. Die Türen verschließen, wenn beinah tausend Personen im Raum sind. Voller Verzweiflung versuchte er an den ihm entgegen strömenden Menschen vorbeizukommen und rief ununterbrochen den Namen seiner Tochter. Allen, denen er begegnete, war eine höllische Angst ins Gesicht geschrieben. Er rief, schrie, brüllte.
Als er endlich im Einkaufszentrum war, stand das ganze Gebäude in Flammen. Feuer fiel von der Decke und brannte Marco auf der Haut. Das Gebäude begann, stellenweise, mit großem Getöse einzubrechen. Marcos einziger Gedanke war, seine Tochter zu retten. Tränen der Ohnmacht strömten aus seinen Augen. Alissa, du darfst nicht sterben, du bist zu jung. Der dichte Rauch machte es Marco beinah unmöglich zu atmen und verhinderte jegliche Sicht. Als Marco in einem Versuch, sich zu orientieren, hochschaute, sah er, wie ein großes brennendes Objekt auf ihn herabstürzte.
Dicke Rauchwolken stiegen aus dem ungefähr dreißig Meter hohen Gebäude und verdunkelten den Himmel. Aus jedem winzigen Loch qualmte es. Die soeben eingetroffenen Feuerwehrleute handelten tapfer und entschlossen. Der Führer der Patrouille gab präzise und prägnante Anweisungen an seine Männer weiter. Während sechs Männer die schweren Schläuche der drei Feuerwagen zur Brandstelle schleppten, war ungefähr ein Dutzend Männer damit beschäftigt, die 15 Millimeter dicken Fensterscheiben mit ihren Beilen einzuschlagen. Durch die Scheiben konnte man verschwommen zahllose Menschengesichter erkennen, die vergeblich an den von den Wachleuten verschlossenen Türen zerrten, um aus diesem Inferno auszubrechen.
Manchmal meinte Victoria, Marcos und Alissas Gesicht in der Tür zu sehen. Als jedoch die ersten Personen mit einem verzerrten Gesicht, nach Sauerstoff schnappend, zu Boden fielen, sank auch Victorias Hoffnung auf ein Wiedersehen mit ihrem Mann und ihrer Tochter und fühlte sich wie von einem Lastwagen überfahren.
Wenige Meter vom verkohlten Körper Marcos entfernt suchten Jennifer und Sandra vergeblich den Ausgang. Jennifer drückte Alissa an sich, die mittlerweile aufgehört hatte zu schreien.
Eugen Friesen, 2. August 2004
La trampa de la vida
Juan se secaba la cara con la manga de su camisa, la cual en un tiempo lejano pareciera haber sido roja. Sentía el calor, ese calor que tortura, quema, lesiona, mata. Dios mío, ¿por qué hace tanto calor? Lo peor era que este calor coincidía con la infinita cantidad de mosquitos que invadían las chacras y que no le dejaban en paz a nadie. No le permitían a ninguno que llevara una camisa de mangas cortas. Y este calor, que ya a media mañana quemaba, como si no tuviera suficientes oportunidades de hacerlo al medio día. De nuevo se pasó con la manga por su rostro y le dolían las picaduras de los mosquitos.
Él no quería quejarse, quería ser agradecido por tener su propio terreno después de tanta espera y de tantas injusticias. Seguía trabajando. El hacha estaba gastada por la cantidad de troncos que tenía que cortar todos los días. La tierra era tan dura que hubiera preferido golpear una calle asfaltada. Más su misión era trabajarla.
No soportaba más el calor y los mosquitos. El sudor le entraba en los ojos y le dificultaba ver. Los mosquitos le impedían respirar. Ya no soportaba más y se fue marchando hacia su rancho, que, por cierto, no era lindo ni lujoso, pero era suyo. Y eso era lo que en estos momentos importaba.
Mientras caminaba hacia su vivienda, pensaba en Angelina. Su esposa era una persona alegre. Se habían conocido hace cuatro años. Él era hijo de unos campesinos pobres; ella, hija única de un terrateniente de la zona. Se da por entendido que sus padres se habían opuesto a esta amistad. Angelina había rechazado la suma enorme de dinero que le había ofrecido su padre para que abandone a ese „bruto maleducado“ y que recobre la razón. Insistía en que lo amaba y sabiendo que sería desheredada, optó por él. Así ocurrió que se había escapado con Juan y se casaron a escondidas.
Angelina barría el patio cuando él llegaba.
– Hola Juan. ¿Cómo te fue en la chacra?
– Había tantos mosquitos que ya no aguantaba más. Por eso vine. – respondió él y no pudo disimular su desánimo.
– Voy a preparar el tereré. Vení, sentate. Vamos a tomar algo y después podrás trabajar con más ánimo.
Mientras ella se fue para traer el tereré, él se sentó debajo del lapacho en la única silla existente que parecía ser más bien un taburete porque ya no tenía respaldo. Le gustaba estar en casa con su mujer. Tenían tres años de casados y él seguía estando enamorado de ella. Cuando Angelina llegó con el tereré, él le cedió la silla y se sentó sobre el piso.
Después de haberla observado un rato le preguntó:
– ¿Y cómo te fue a vos? Te ves cansada.
– Sí, estoy bastante cansada y no me siento muy bien. Se me acabó el agua en el bidón y tuve que ir a buscar de los vecinos. Son apenas dos kilómetros, pero caminando con un balde de agua en cada mano uno se cansa.
– Me lo hubieras dicho. Yo te iba a traer el agua. No quiero que te esfuerces tanto. Ya sabés, la criatura.
– Sí, ya sé. Pero sólo por estar embarazada no puedo dejar de trabajar. Además, vos tenés suficiente trabajo en el campo. – Le pasó la guampa y miró hacia sus zapatos.
– Deberías comprarte zapatos nuevos. Estos ya tienen muchos agujeros y en la chacra puede que haya víboras.
– Cuando tenga suficiente plata voy a comprarme los zapatos.
***
Media hora más tarde Juan ya estaba de vuelta en el campo. Se sentía mejor y le parecía que ya no había tantos mosquitos. Quizás por el viento que soplaba ahora con mayor intensidad. Silbaba una polca mientras trabajaba. Esto siempre lo hacía cuando se sentía bien. Miró hacia sus zapatos. Angelina tiene razón. Ya están muy gastados y tienen muchos agujeros en los costados. Si puedo, a fin de mes me compraré otros.
El hacha caía sobre los troncos y poco a poco ganaba más terreno. El gobierno le dio este pedazo de diez hectáreas. Había sido un pastizal alguna vez. Pero después de no usarlo durante tantos años se había vuelto duro y árido. Esto pasa por no cuidarlo. Me costará mucho esfuerzo para poder sacar por lo menos un pequeño provecho de esta tierra maltratada.
El contrato entre Juan y el gobierno consistía en que él tenía que limpiar este campo y si lograre que crezca algo se podía quedar con él. De ahí su motivación de terminar este trabajo lo antes posible.
Era por el mediodía cuando sintió un leve dolor en su pie izquierdo. Me habré pinchado con alguna espina. Dirigió su mirada hacia el pedazo de tierra ya destroncada y sus pensamientos viajaron al futuro. Se veía jugar con sus hijos en un lindo patio adornado con muchas flores y en cuyo centro yacía un estanque en cuyas aguas se deslizaban algunos patos silvestres y gansos domesticados. Pensar en tener una casa propia, un terreno propio, tener unos hijos sanos y mucho tiempo para compartir con ellos lo hacía sentirse muy feliz.
Decidió descansar unos minutos en la sombra de un palosanto antes de seguir destroncando. Dentro de una hora debería regresar al rancho para almorzar. Era un tiempo sagrado para Angelina, y él lo sabía. Por eso nunca llegaba tarde.
***
– Es raro que Juan no haya vuelto. Nunca antes llegó tarde a la hora de comer. Puede ser que se haya olvidado del tiempo. Demasiado ya quiere terminar su trabajo. Será mejor que vaya a buscarlo. El guiso ya se pone frío.
Angelina se puso sus botas de cuero y encaminó sus pasos hacia el sendero zigzagueado que la llevaría al campo, que quedaba a pocos minutos del rancho.
– ¡Juan! ¡Juaaaaan!
No hubo respuesta alguna y ella siguió buscando y llamándolo.
– Allá está. Sentado debajo de un árbol. Pobrecito, se quedó dormido. Insisto en que no trabaje tanto, que algún día se va a enfermar. Pero siempre me dice que cuando termine de limpiar este campo las cosas cambiarán. Ojalá sea así. Qué haría sin él. No podría vivir. Jamás hubo hombre que supo amar como él lo hace.
Ya se había acercado y lo llamó otra vez. Pero Juan no se despertaba. Mientras lo sacudía se dio cuenta de que le costaba respirar.
– ¡Juan, despertate! Es hora de comer. Volvé a casa. Te preparé un rico guiso.
Juan abrió lentamente los ojos.
– Estoy muy cansado y me duele mi pie.
Angelina le quitó el zapato de la derecha. No había nada. Pero no pudo sacarle el de la izquierda. El pie estaba muy hinchado. Cuando por fin logró quitárselo se percató de que en el tobillo había dos puntos rojos y comprendió que había ocurrido lo que menos deseaba en toda su vida. Comprendió que ya no habría ayuda para Juan, no había gente en los alrededores y ella sola no podía hacer nada. No podía ni siquiera llevarlo a que muera dignamente en su casa. Pero comprendió también que había perdido todo, absolutamente todo y que ni siquiera tenía en donde refugiarse. Esto la desesperaba y sentía como enloquecía.
Quedó con él hasta que expiró, luego se levantó y regresó al rancho.
Eugen Friesen, Paratodo
Die Gedanken des alten Wilhelm
Mein Name ist Wilhelm S. Ich bin schon recht alt. Manchmal denke ich, dass der Tod mich vergessen hat. Mit all der Arbeit, die er auf dieser von Gewalt und Terror beherrschten Welt hat, muss er mich wohl übersehen haben. Wäre ja denkbar. Zwei meiner Kinder sind schon gestorben, sogar ein Enkel. Ich hätte gerne ihre Stelle im Sarg eingenommen, wenn ich ihnen dadurch das Leben hätte zurückgeben können.
Es ist ja meistens so. Diejenigen, die gerne sterben möchten, können nicht, und diejenigen, die das Leben erst zu genießen beginnen, werden aus dem Leben gerissen wie eine junge Pflanze, die aus der Erde gezogen und weggeworfen wird. So war es auch bei uns. Mein Enkel starb bei einem Autounfall, mein ältester Sohn an Krebs, der zweite an einem Herzversagen. Sie waren auch nicht mehr die Jüngsten, aber immerhin. Ich fühle mich schon müde und lebenssatt, doch ich muss noch auf dieser Erde bleiben. Das versteh mal einer.
Doch diese Erinnerungen lenken meine Gedanken in eine nicht vorgesehene Richtung. Eigentlich wollte ich etwas ganz anderes erzählen. Ich bitte um Entschuldigung für diese Abweichung und auch für die, die noch kommen werden, denn ich kann meine Gedanken nicht mehr alle richtig ordnen. Nicht, dass ich die Kontrolle über meine Gedanken verloren hätte, aber ich habe schon so viele Dinge in meinem Leben erlebt, dass meine Gedanken manchmal selbständig zu werden scheinen. Auf jeden Fall gelingt es mir nicht immer, sie so zu kanalisieren, dass ich das Gewollte ausdrücken kann.
Ich denke, ich hatte schon gesagt, dass ich alt bin. Wenn die Informationen in den Dokumenten, die ich über meine Person besitze, sonst stimmen, bin ich momentan 95 Jahre alt. Das ist für einen sterblichen Körper nicht schlecht, finde ich. Geboren wurde ich noch in Kanada, wo ich auch meine ersten Lebensjahre verbracht habe. Die Erlebnisse aus diesen Jahren habe ich sorgfältig in meinem Gedächtnis gespeichert und sie so aufbewahrt, wie es manche Leute mit ihrem ersten Spielzeug machen, um es dann von Zeit zu Zeit hervorzuholen um ihre Kindheitserlebnisse wieder aufwärmen.
Ich denke, dass ich es aus dem Grund so gemacht habe, weil die Zeit in Kanada zu der besseren und leichteren meines Lebens gehört. Natürlich habe ich auch in Paraguay schöne Erfahrungen gemacht, doch die negativen Erlebnisse in den Anfangsjahren waren für mich sehr prägend. Die Ankunft und die raffende Pest in Puerto Casado im Jahre 1926 haben in mir tiefe Wunden hinterlassen. Meine Eltern musste ich beide an diesem verlassenen Ort begraben.
Manchmal habe ich mich später gefragt, ob es die Sache wert war. Wenn ich mir die Gründe unserer Auswanderung aus Kanada nach Paraguay durch den Kopf gehen lasse und sie mit dem Ist-Zustand unserer heutigen Gesellschaft vergleiche, bekomme ich gemischte Gefühle. Als wir aus Kanada auswanderten, hatten wir eine Vision vor Augen. Wir wollten eine Kolonie gründen, wo wir die deutsche Sprache ungehindert unterrichten könnten, wo wir unseren Glauben lehren und ausleben dürften, und wo man uns den Militärdienst erlassen würde.
Da ich schon seit Langem keine körperlichen Arbeiten mehr verrichten kann, habe ich genügend Zeit um zu überlegen. Das ist nicht immer gut, wenn man viel überlegt. Wer zuviel überlegt, gerät in Gefahr, entweder hochmütig oder melancholisch zu werden. Bei mir trifft das Zweite zu. Denn wenn man denkt, merkt man plötzlich, dass die Welt nicht mehr in Ordnung ist. Dazu braucht man übrigens nicht viel Verstand. Aber ich merke, dass ich schon wieder abweiche.
Wie gesagt, war der Wunsch, vom obligatorischen Militärdienst befreit zu werden, ein Grund unserer Auswanderung aus Kanada. Das war unseren Vätern sehr wichtig. Dafür haben sie alles aufgegeben. Manche haben dafür sogar mit dem eigenen Leben oder dem ihrer Kinder bezahlen müssen. Damals, in Puerto Casado. Auch ich hing diesem Ideal an.
Es ist schon einige Jahre her, da wurde ich von einem Jugendwart eingeladen, um auf einem Friedenslehrekursus (ich glaube, er wird auch „Bajakursus“ genannt) etwas über unsere Geschichte in Kanada und unsere Beweggründe zur Auswanderung zu sagen. Ich hatte mich gut vorbereitet. Ich hatte mir vorgenommen, den Jungs etwas über unser gutes System zu erzählen. Darüber, wie gut sie es hätten, dass sie keinen Militärdienst machen bräuchten, und das, ohne sich beim Militär zu einer Inspektion präsentieren noch vor Gericht ihre Gründe zur Verweigerung angeben zu müssen.
Als der große Zeiger der Wanduhr in der Kirche auf die Sieben gerückt war und das Programm beginnen sollte, taumelten die Jungen langsam und missmutig in den Saal. Bevor ich zu Wort kam, machte der Jugendwart die Einleitung. Er stellte den Jungen die Frage, warum sie an diesem Abend an diesem Ort erschienen wären. Na ja, das hätte man auch besser fragen können, finde ich. Ist wohl klar, dass man auf schlechte Fragen auch schlechte Antworten bekommt. So war es auch hier. Denn nach einer etwas längeren Denkpause antwortete einer der Jungen, dass er gekommen sei, weil man ihn dazu verpflichtet und er sowieso nichts Besseres vorgehabt hätte.
Nachdem sich das schallende Lachen gelegt hatte, stellte der eingeschüchterte Jugendwart noch einige Fragen, dieses Mal mit etwas mehr Erfolg. Die Stimmung für den gesamten Abend war jedoch bereits angegeben. So etwas hatte ich nicht erwartet. Heute nennt man das „gewitzt sein“. Früher hätte man das Respektlosigkeit genannt und hätte unbedingt einige Schwielen am Hintern davon getragen. Ja, früher war sowieso alles anders. Manche denken, dass alles besser war.
Auf jeden Fall verlief der Abend anders, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Die Jungs verhielten sich zwar ruhig, manche zu ruhig, denn bei einigen bemerkte ich, wie ihre Köpfe nach vorn fielen und sich auch nicht mehr erhoben. Das konnte auf keinen Fall als andächtiges Zuhören interpretiert werden. Die Gedanken der Jungen waren außerhalb des Raumes, das stand fest. Ich ließ mich nicht beirren und beendete meinen Vortrag mit dem Appell an alle, dass man dieses Vorrecht als solches sehen und es schätzen solle. Dafür hätten schließlich ihre Großväter ihre Heimat aufgegeben. Einige nickten, manche lächelten, andere starrten vor sich hin oder schauten auffällig auf ihre Uhr und wollten mir wohl zu verstehen geben, dass meine Zeit abgelaufen sei.
Ich sagte schon, dass ich viel Zeit habe, um zu überlegen. Das habe ich nach diesem Abend auch ausführlich gemacht. Anfänglich gingen meine Gedanken in Richtung „Wo ist der für die Mennoniten so wertvolle Respekt den Älteren gegenüber geblieben?“ Nach und nach jedoch stieß ich auf Fragen, die mir unbekannt waren. Wo waren unsere Ideale geblieben? Warum hatte unsere Erziehung ihr Ziel verfehlt?
Nach diesem Abend habe ich erstmalig das Privileg der Wehrdienstverweigerung angezweifelt. Tief in meinem Herzen musste ich diesem Jungen, von dem ich bis heute nicht weiß, wie er heißt, Recht geben, obzwar ich mich am Abend sehr über seine Bemerkung geärgert hatte.
Dieser junge Mann, obgleich er sich über den Redner hatte lustig machen wollen, hatte doch den Kern der Sache berührt. Denn die Jungen hatten tatsächlich nichts Besseres zu tun als zu diesem Programm zu erscheinen, denn alle wurden ja dazu verpflichtet. Eine Woche lang Vorträge über verschiedene Themen anhören und schon war man ein friedfertiger Wehrdienstverweigerer. Welche Entscheidungsfreiheit bekommt der einzelne Jugendliche? Wären nicht manche ins Militär gegangen, hätte man ihnen die Entscheidung überlassen? Ist es das Beste, wenn alle den Friedenskursus mitmachen, auch wenn viele von diesen davon nicht überzeugt sind? Oder ist es besser, wenn es nicht unbedingt alle sind, und diese aber aus voller Überzeugung dabei sind?
Ich alter Mann habe mich von einem Jugendlichen eines Besseren belehren lassen. Natürlich bin ich immer noch gegen Gewalt und unterstütze die Wehrdienstverweigerung aus vollem Herzen. Meine Erfahrung hat mich jedoch gelehrt, dass auch bei uns, die wir uns wehrlose Mennoniten nennen, die Friedfertigkeit und Wehrlosigkeit nicht angeboren ist. Deshalb sollte man die Kinder und Jugendlichen mehr zum Frieden erziehen und ihnen nicht nur durch einen einwöchigen Kursus das Ticket ins Land der Friedfertigen überreichen.
Ich bin mir dessen bewusst, dass viele meine Meinung nicht teilen werden. Ich nehme es niemandem übel, denn ich habe schließlich auch lange anders gedacht. Es ist viel bequemer per Privileg wehrlos zu werden als per Überzeugung. Das Eine schließt das Andere nicht notwendigerweise aus, garantiert es aber auch nicht.
Eugen Friesen, 8. Oktober 2004
Toleranz – eine Sache die man aus der eigenen Vergangenheit lernen sollte!
Fröhlich und vor sich hinsummend sieht man die 10jährige Sarah mit einer Tasche in der Hand die Dorfstraße entlang gehen. Sie ist auf dem Weg zu ihrer Oma, die zwei Höfe weiter von ihnen entfernt wohnt. Eigentlich ist es gar nicht ihre Großmutter, sondern ihre Urgroßmutter. Aber da ihre richtige Oma schon vor etlichen Jahren bei einem Unfall starb, ist es für sie die Oma. Es gehört zum Tagesablauf des kleinen Mädchens, diesen Besuch zu machen. Heute hat sie noch frische Plätzchen mit dabei, die ihre Mutter gebacken hat. Schon von morgens an freut sich Sarah auf diesen Besuch. Die Oma kann richtig gut Geschichten erzählen. Meistens erzählt sie von früher, damals, als sie von Kanada in den Chaco kamen. Sarah denkt immer, es muss damals richtig abenteuerlich gewesen sein. Heutzutage erlebt man ja ganz andere Sachen. Nicht so aufregend, findet sie.
Schon von Weitem sieht Sarah, dass die Oma nicht an ihrerm gewohnten Platz unterm Mangobaum sitzt wie meistens, wenn sie um diese Uhrzeit kommt. Da ahnt Sarah schon, dass es der Oma heute mal wieder nicht so gut geht. In der Regel sind die Geschichten an solchen Tagen dann traurig.
Sich dem Hause nähernd sieht Sarah die Oma durchs Küchenfenster. Sie sitzt am Küchentisch und scheint mit ihren Gedanken sehr weit weg zu sein. Ihrem Gesicht sieht man an, dass sie an irgendetwas Trauriges denkt. Zum wievielten Male fallen Sarah die Falten im Gesicht und die Risse in den Händen der Oma auf. Die Oma erzählt oft, wie schwer sie damals gearbeitet haben, als sie sich im Chaco angesiedelt haben. Es muss gar nicht so einfach gewesen sein, denkt sie, kann sich aber die damalige Situation überhaupt nicht vorstellen.
„Hallo Oma“, grüßt Sarah, während sie durch die Küchentür schlüpft und die Tasche mit den Plätzchen vor Oma hinstellt. „Hallo meine Liebe“, kommt die Begrüßung müde zurück. „Warum bist du heute so traurig, Oma?“ „Weißt du, Sarah, ich denke heute den ganzen Tag an deinen Uropa. Es sind nämlich heute genau 20 Jahre her, seitdem er gestorben ist. Deine Mama war damals so alt wie du heute.“ „Oh, und ihr seid bestimmt alle sehr traurig gewesen.“ „Ja, das waren wir. Wir hatten deinen Opa immer sehr lieb.“ „Erzähl mir was von Opa. Ich kenne ihn ja nur von den Bildern, die du hast.“ „Dein Opa war ein sehr strenger Mann. Er glaubte fest an Gott. Zwanzig Jahre lang war er Prediger. Schon in Kanada setzte er sich für unseren mennonitischen Glauben und unsere Traditionen ein. Heute sagen die Menschen, er war einer von den ganz Konservativen. Und doch weiß ich genau, er hat immer versucht, das, was er für Gottes Willen hielt, zu tun.“ „Oma“, unterbrach Sarah sie. „Was ist das, ein ganz Konservativer?“ „Weißt du, meine Liebe, als wir damals im Jahre 1927 aus Kanada auszogen, glaubten wir, keinen anderen Ausweg zu haben, wenn wir unseren Glauben in der Form behalten wollten, wie wir ihn hatten. Die kanadische Regierung wollte uns nämlich zwingen, die englische Sprache in unseren Schulen einzuführen, ihre Lehrer anzustellen und sogar den Religionsunterricht in der Schule verbieten. Das wollten wir nicht. Wir wollten ja, dass unsere Kinder und Großkinder auch noch so leben könnten wie wir. Deshalb entschlossen wir uns, auszuwandern und ein ganz neues Leben, weit ab von aller Welt, anzufangen. Hier im Chaco ging es uns auch sehr gut. Die ersten 25 Jahre. Klar, es war sehr hart, aber man ließ uns in Frieden. Dann kam in den 50er Jahren die Schulreform, d.h. man wollte die ganze Schule und den Unterricht anders machen als bisher. Die Situation war eigentlich wieder genau dieselbe wie damals in Kanada. Nur mit dem Unterschied, dass die Änderung von unseren Leuten kam. Das machte den Opa sehr traurig. Davor waren wir ja gerade geflüchtet. Es zerbrach ihm das Herz, dass unsere Leute sich der Welt so anschließen wollten.“ „Was meinst du mit ‚Welt’?“ Sarah verstand nicht ganz. „Na ja, das Neue, was kam und seiner Meinung nach nicht Gottes Wille war. Dein Opa wollte alles so halten, wie es immer war. Und deshalb bezeichnete man ihn als konservativ oder auch ‚altmodisch’, verstehst du? Am Anfang horchten auch noch viele Leute auf ihn, aber mit der Zeit wurden es immer weniger, bis er eines Tages, mit einigen wenigen anderen, alleine dastand. Die Veränderungen, die jetzt folgten, waren nicht mehr aufzuhalten. Deinem Opa ging es sehr schlecht. Er war sich dessen ganz sicher, dass die Menschen in der Kolonie falsch handelten. Und das machte ihn krank. Er wollte nur das Beste für sie. Die Sorgen um die Gemeinden und Schulen ließen ihn erkranken und nach einigen Monaten sterben.“ Sarah wurde nachdenklich. Obwohl sie den Sachverhalt lange nicht ganz verstand, machte es sie traurig, dass der Opa, der doch anscheinend ein sehr mutiger Mann gewesen war, so leiden musste, nur weil er Gottes Willen befolgen wollte.
Heute ist Sarah selber Mutter von drei Kindern. Ihre Oma ist längst gestorben. Oft denkt sie noch an die täglichen Stunden zurück, die sie mit ihr verbracht und in denen sie vieles über die mennonitische Geschichte gelernt hat. In Gedanken bewundert sie immer wieder die Pioniere, die damals weder Mühe noch Not gescheut haben, sich für die Erhaltung ihres Glaubens einzusetzen. Sie zweifelt daran, nein, sie weiß es eigentlich genau, dass es heute nur wenige Leute gibt, die sich einer solchen Herausforderung stellen würden. Womit sie sich immer wieder beschäftigt ist, dass heutzutage eigentlich wenig von den Personen gesprochen wird, die von der konservativen Tradition nicht weg wollten. Meistens werden jetzt nur die erwähnt, die sich für die Reformen und Erneuerungen in der Kolonie eingesetzt haben. Ist ja auch gut. Sarah selbst ist froh, dass sie heute da sind, wo sie sind. Und sie hält die mutigen Leute, die diese Veränderungen bewirkt haben, auch hoch in Ehren. Aber immer wieder denkt sie an ihren Uropa zurück, von dem sie weiß, dass er ein gottesfürchtiger Mann war. Tief im Herzen wollte er nur Gottes Willen befolgen. Und doch wird er (und andere auch) heute so leicht als ‚Altmodischer’ abgestempelt. Oder sie denkt an die konservativen Mennoniten, die es immer noch gibt, z.B. in Rio Verde. Von ihnen wird behauptet, sie hätten ein gewaltiges Brett vor dem Kopf, da sie so stur an ihren traditionellen Werten festhalten. Klar, das weiß Sarah, werden dort auch Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind. Aber hat man überhaupt das Recht, andere wegen ihrer Meinung oder Glaubensauffassung zu verachten? Ganz bestimmt nicht. Sarah nimmt sich vor, toleranter gegenüber Andersdenkenden zu sein.
Während sie so in Gedanken da sitzt, schlüpft ihre 7-jährige Nora ins Zimmer, umarmt sie und bringt eine Bitte hervor. Sie ist in diesem Jahr eingeschult worden und pflegt regen Kontakt zu ihrer Klassenkammeradin Ana Maribel. Maribel ist Lateinparaguayerin, kommt also aus einem nicht-mennonitischen Elternhaus. Nora bittet jetzt darum, die kommende Nacht bei Maribel verbringen zu dürfen. Sogleich schießen Sarah verschiedene Gedanken durch den Kopf: ‚Was wird meine Tochter in einem Heim sehen und lernen, wo nicht der Glaube an Gott ausgelebt wird? Kann ich das verantworten oder soll ich lieber eingreifen und die Beziehung der beiden Mädchen beenden? Auch wenn die Eltern ganz nett sind und ordentliche Leute zu sein scheinen, sie sind eben so anders als wir.’ Während die kleine Nora noch auf eine Antwort wartet, erinnert Sarahs innere Stimme sie an das Vorhaben, das sie vor wenigen Minuten in Bezug auf Offenheit und Toleranz gegenüber ‚anderen’ Leuten machte. Sarah lächelt ihre Tochter an und denkt im Stillen, dass das praktische Ausleben einer theoretischen Entscheidung gar nicht so einfach ist.
Beate de Penner, Colegio Friesland
Esel blifft Esel
– Ploff! – Met eenem dompen Knaul laund daut greiwe langoahje Tiea hinja dem Veehaunhänja oppe Ead en bleef ligje. Doot. Soo aus Hoada profezeit haud. „Doot ess’a nü“, heiwd hee loos, en tjitjt Jinta en bet vedutzt en doll aun. Doch dee schmüstat bloos, en sed tritj, aus hee no sienem Hocka jintj, om wieda sienen haulf woamen Tereré to drintje: „Tjemt Tiet, tjemt Rot. Soo uck bie daut daumelje Jetiea. Woascht aul seene.“ En wieda leet hee sitj uck nich steare.
– Aunjefonge haud dee Jeschicht met dee greiwe Tieare aul atelje Stund verhea. Hoada haut sitj en poa straume Esels – wann maun dee Langoahre weens soo nanne kunn – enjeschachat. En wiels hee wem bruckt, toom dee de 70 km no siene Fenz ewatooschemacke, naum hee sitj Lustje-Jinta üttem Nobadarp aun. Schaufe deed jana woll nich seeja, oba doofea wist hee sitj met deant. Jlitj en jlitj tjant sitj, docht Hoada, en soo weare see nü beid ob Eselsreis.
No langem schüwe, riete, dretje, tobbre en oajre haude Hoada en Jinta dee beid Tjräte endlich oppem Aunhänja bowe jehaut. See weare dort woll aul meist gaunz aum Enj met eare Jedult en uck met eare Krauft, aus et endlich mol soo wiet wea. „Nü bockt mo en stiepat en weaht jünt soo seeja, aus jie mo welle, oba ons nenlaje woa jie daumelje Tjrete nich meeja.“ Hoada sed daut en bet von bowe, jniesad, en wea doabie gaunz ütte Püst. – Lota foll Hoada bie, daut Jinta doabie uck noch en bet jejniesat haud, oba hee wisst nich, woarom. – Emma noch langsaum aus ne Schildtjrät jintj Jinta no veahre, om loostefoahre, en sed doabie, meeja too sitj selfst aus too Hoada: „Na wach mo, dü woascht aull noch seene, daut wie noch lang nich too Enj send…“ Woo kunn disa daut uck weete, waut doamet jemeent wea.
Dee Reis jintj schwind en ohne irjend eenen Tweschenfaul, waut haud kunnt ommaklich woare. Uck biem aun dee Opplodarie – ooda nü Auflodarie, wiels dee Esels je vom Aunhänja rauf sulle – naunbetje, schauft aulles aus en jeschmeadet Jedriew. Hoada jintj frooh no hinje, trock dee Dea hüach, en docht, daut nü dee Jeschicht too Enj wea. En see wearet uck meist. Dee easchta Esel, dee jinjra en onerfoahrnara, een strauma junga Hinjst, kaum langsaum op dee Opninj too, wackeld en bet met siene groote Oahre, en staupt dann steil rauf, ohne no Jinta ooda Hoada too tjitje, hee wist sitj selfst.
Uck met dem tweeden, dem en bet ällren Kunta, scheen aules leicht, schwind en goot to gone. Langsaum nodad hee sitj dee Auflodarie, stüack den Kopp derch dee Dea, en sad aun, so weens sach Hoada daut, jleewd hee. Von hinje sprenjd hee en bet no, en dann sad dee Esel uck aun, oba ewaroasch, gaunz schwind, bott hee met sienem Hinjarenj aum veaschten Enj von sienem onfriewelljen Jefängnis naunknauld, daut dee Trock mo soo stehnd en schockeld. Doa bleef daut Tjret eenfach stohne, stald siene Oahre steil op, den Bletj stua noh veare, en wacht: ´Nopp sie etj onfriewellich jekomme, onfriewellich woa etj uck gohne´, soo hied sitj Hoada daut, aus dee Esel eenmol schnoof.
Hoada socht sitj eenen Stock, om doamet opp dem Greiwen rommtoopoakre. Hee deed daut, en daut holp nuscht. Tjeen teatjen, tjeen Oahrewackle meeja, tjeen Jeschlon. Dee Esel wea aus Steen. En nü jleewd hee uck too bejriepe, woarom maun von Steenesel red.
Ewa disse Tiet haud Jinta siene Ütrestinj jenome en funk aun, gaunz jemietlich sienen Jerba too drintje. Hoada wull je siene Tiere aulleen auflode, en daut sull hee nü uck doone.
Oba wiels aul daut poakre, schlone, prachre, tobbre en bedde nuscht holp, musst Hoada doch sienen Noba roope. Dee stald sien Jedräntj han, kaum mo langsaum oppe Been, oba hee wist gaunz jeneiw, waut hee wull. „Hast eenen Strank met, Hoada?“, fruag hee. „Secha“, sed dissa kort, „oba etj well daut Mesttjrät nich aunbinje, etj well daut auflode!“ „Etj uck.“ Daut wea aulles, waut Jinta doatoo sed. Den Strank tjriech hee, en doamet stiech hee opp dem Aunhenja nopp. Hoada tjitjt eenfach too. Waut passiere wurd, ohnd hee mo wietleftich. Dee oola Esel bleef wieda stua en onbeweachlich stohne en wackeld mo eenmol gaunz langsaum met siene Oahre, auls dee Strank ewa siene Nes stritjt en rom sienen Hauls jetrocke word.
Dee Strank word nü von Jinta derch dee Hinjadea jeschmete, en aum Post von dee Auflodarie aunjebunge. Hoada ohnd langsaum emma dolla, wautet nü jewe wurd. Dee Esel uck? Wann jo, dann moatjt maun am daut nich aun. En gaunz schwind, eeja disse beid irjentwoo noch protestiere kunne, sprunk Jinta, dee je daut sonst niemols bosich haud, em Foatich nenn, start den Motoa en gauf gaunz haustich Gas. Biem nennhupse hiead Hoada noch een „nü woascht kome, dü Tjret.“
En dee kaum. Daut quietscht en baullad en poamol, en dann kracht daut greiwe, bott nü lewendje Jeschnees längs oppe sied oppe hoade Ead en bleef gaunz stell lidje.
– En nü saut Jinta wada em Schaute unja dem Aulgro en suach aun sienem Yerba. Hoada docht veoajat aun sien Jelt, daut hee derch dissen Esel veloahre jegohne wea, en wull Jinta doafea jlitj stohne lote. Hee sad sitj han en drunk uck tereré. Tooeascht musst hee sitj eenmol beruahje. Doabie tjitjt hee von Jinta wach noh siene Esels – eena munta, dee aundra doot – en dann eefach no unje. Am wulle dee Trone kome; üt Oaja ooda Trüa, daut wisst hee en dem Moment nich.
No atliche Rund Tereré sed Jinta gaunz haustich: „Nü tjitj!“ Oba aus Hoada sitj omdreihd, sach hee wada bloos sienen doodjen Esel. Wiels hee nuscht betret to doone wisst, tjitjt hee wieda nohm Esel, dee doa gaunz ütjestratjt lach, greiw aus dee drieje Ead om am rom.
Met eenst – Hoada trüd siene Oage nich – wackelde dee Oahre wada, en gaunz langsaum hoof daut Tjret sienen Kopp huach, tjitjt en bet om sitj, stalt sitj wieda oppe Veahbeen, en dann stunt hee uck aul gauns opp aulle veeja Kloffe, scheddad sitj, daut´ta fea korte Tiet en sienem eajnen Stoff veschwung, en jintj dann, aus wann am noch nie waut üt siene Rüh jebrocht haud, nohm Krell en beritjt sitj met sienem jinjren Eselsbrooda.
Hoada kunn emma noch nich goot bejriepe, waut ver siene Oage passead, en Jinta saut opp sienen Hocka en wull nich meeja opphieare too lache. Eenmol ewa dem Esel, daut daumelje Tjret, oba kratjt soo seeja uck ewa Hoada siene Grimmausse, dee tjeen Enj nehme wulle.
„Etj Esel“, brommd Hoada en sienen Boat nenn, „oba veeja Feet en lange Oahre hab etj emma noch nich.“
Uwe Friesen, Colegio Loma Plata
Buchbesprechungen
Klassen, Peter P.: „So geschehen in Kronsweide“
Mennonitische Theologie in Geschichten, aber mehr als Geschichten
Warum jeder Peter P. Klassens Buch „So geschehen in Kronsweide“ lesen sollte.
Peter Klassen gibt seinem Buch den Untertitel „Geschichten zur Geschichte mennonitischer Gemeinden und Kolonien“. In Wirklichkeit wird uns jedoch in den 4 Erzählungen viel mehr vorgelegt als Geschichten zur Mennonitengeschichte. Sie ranken sich um den Widerspruch, den die mennonitische Theologie in dem Begriff von der „Gemeinde ohne Flecken und Runzeln“ zusammenzuschmieden versucht hat: dem Widerspruch zwischen der Freiheit des Menschen, in religiösen Fragen seine eigenen Erfahrungen zu machen und nur seinem Gewissen zu folgen, und der Notwendigkeit, die Menschen mit ihren individuellen und meist so verschiedenen Erfahrungen in ein Gefüge einzubinden, das es ermöglicht, die durch die Gewissensfreiheit entfesselten Kräfte in geordnete Bahnen zu lenken.
Jede christliche Kirche sucht diesen Widerspruch auf dem Grund der Bibel und der Tradition zu lösen, und die Mennoniten haben in diesem Bemühen ihre besonderen Akzente gesetzt. Die Lehre von der Gemeinde ist das Herzstück mennonitischer Theologie, und seit der Reformation bis heute trägt ihre praktische Ausprägung die mennonitische Gemeinschaft. Aber wo Widersprüche sind, entstehen Spannungen, die sich im Alltagsleben der Menschen in ganz verschiedenen Schicksalen niederschlagen. Von solchen Schicksalen berichten Klassens Geschichten. Sie sind deshalb nicht nur Geschichten zur Geschichte, sondern auch Veranschaulichung mennonitischer Theologie und eine Aufforderung, über diese nachzudenken.
Da sind zuerst einmal Andreas, der lutherische Trommlerbub, und Helene, das Mennonitenmädchen, die einander lieben und heiraten möchten. Aber mit diesem so verständlichen und natürlichen Vorhaben geraten sie ins Konfliktfeld zwischen mennonitischer Gemeindeordnung, lutherischer Staatskirche und preußischer Verwaltung. Wenn beide ihrem Glauben treu bleiben, scheint es keinen Weg für sie zu geben. Und wäre da nicht Julius Töws, der den Mut hat, die geistliche Führung des Ältesten zu hinterfragen, wer weiß, ob Andreas und Helene das glückliche Ende als Besitzer eines Bauernhofs in einer mennonitischen Kolonie am Dnjepr hätten erreichen können.
Kein glückliches Ende gibt es für Heinrich Dyck. Sein tragisches Schicksal nimmt seinen Lauf in den Auseinandersetzungen um die Entstehung der Brüdergemeinde in den Mennonitenkolonien in der Ukraine. Sein feinfühliges und sinnliches Wesen hält die Spannungen nicht aus, die seinen Familien- und Bekanntenkreis in Aufruhr bringen, und er endet in geistiger Umnachtung. Indem der Leser sein trauriges Schicksal verfolgt, erfährt er Grundlegendes über den Werdegang von religiösen Bewegungen und das Heil und Unheil, das sie den Menschen bringen können.
Die Geschichte von Peter Unger und Martha Hamm beschert uns wieder ein Happy-end. Aber bis dahin müssen die beiden einen jahrelangen Weg von der Ukraine bis an den Fluss Amu Darja in Asien zurücklegen, Claas Epp nachfolgend, der seine Gemeinde an der Ort der Wiederkunft Christi führen wollte. Und von dort wandern sie schließlich weiter nach Nebraska in den USA. Der Leser begleitet das Paar auf diesem leidensreichen Weg und erfährt dabei, wohin religiöse Überspanntheit führen und wieviel Missgeschick fehlgeleitete Glaubensüberzeugung ertragen kann.
Nachdenklich wird der Leser gestimmt durch die Geschichte von Hermann Gies-brecht, dem jungen Prediger der Allianzgemeinde, der auf der Flucht aus der Sowjetunion in den paraguayischen Chaco im Flüchtlingslager in Mölln 1930 von Professor Benjamin Unruh den Auftrag erhält, sich in den neuen Siedlungen für die Überwindung der Gemeindespaltungen einzusetzen. Er tut das aus tiefster Überzeugung, und muss erfahren, dass dieses Bemühen wieder nur zur Festigung einer neuen Gemeinderichtung führt, und dass abgrenzende Regeln, die in der Zeit der gemeinsamen Not überwunden schienen, wieder eingeführt werden. Und doch erkennt er dann im Rückblick aus der Gegenwart, dass Einheit, Kooperation und gegenseitiger Respekt gewachsen sind, wenn auch anders, als der Professor und er es sich vorgestellt hatten.
Das alles und viel mehr wird dem Leser mit Liebe zu historischen Details in anschaulicher Sprache dargelegt. Jede Geschichte hat ihren eigenen Spannungsbo-gen, der bis zum Schluss hält. Meine Frau sagte: „Wenn man eine Geschichte angefangen hat, kann man nicht aufhören, bis man ans Ende kommt“. Die Personen in den Geschichten sind aus Fleisch und Blut, Sünder und Heilige zugleich, jede auf ihre Weise. Und jede hat fast immer die besten und reinsten Absichten, die dann eben doch Leid verursachen. Aber der Leser spürt auch, dass hinter diesem Leid die Hand eines liebenden Gottes waltet.
Klassen schreibt, was ihm nach einem langen Leben mit, in und unter der „Gemeinde ohne Flecken und Runzeln“ aus dem Herzen fließt. Und deshalb kann er den Gemeindegliedern jeglicher mennonitischer Richtung, über spannender und kurzweiliger Lektüre, eine Hilfe bieten, ihre Gemeinde besser zu verstehen, mehr zu lieben und gleichzeitig kritisch zu hinterfragen, was in ihr gelehrt wird. Jedes Gemeindeglied, nicht nur die Prediger, sollte deshalb dieses Buch lesen.
Gerd Uwe Kliewer, Witmarsum, Brasilien
Quelle: Menno Aktuell, April 2003
Quelle: Menno Aktuell, April 2003