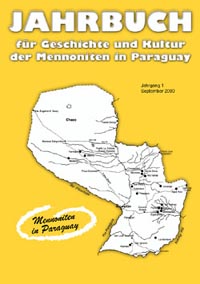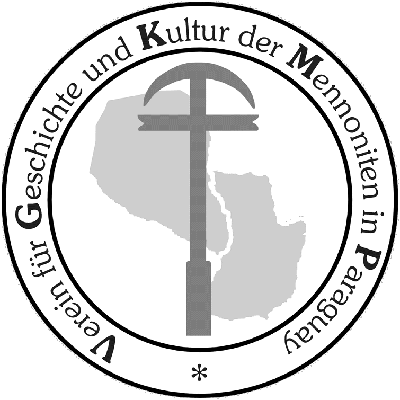Begleitwort zu dieser Nummer
Die in den
Chaco eingewanderten Mennoniten waren ein Agrarvolk. Die bäuerliche Lebensweise war nicht notwendig ein Bestandteil ihres Glaubens, aber es war über Generationen eindeutig die bevorzugte Lebensweise geworden. Das Leben auf dem Land und vom Land hatte schon in Preußen, zu einer Denkweise geführt, in der Land und Existenzmöglichkeit als synonym angesehen wurden. Die Militiarisierung Preußens führte zu Konflikten mit den pazifistischen Mennoniten, wodurch ihnen die damaligen Fürsten das Recht auf Ausdehnung ihres Landbesitzes absprachen. Dass dies eine empfindliche Sanktion war, die den Lebensnerv eines Agrarvolkes treffen musste, war allen klar und war von den Herrschern wohl auch so beabsichtigt.
War die Ausdehnung des Landbesitzes in Preußen zuallererst durch das natürliche zahlenmäßige Wachstum der Dörfer bedingt, so kam in Russland während des 19. Jh. das auf Expansion gerichtete, unternehmerische Element dazu. Johann Cornies gilt als die Person welche die technische Revolution und neue Formen der Marktwirtschaft und des Unternehmertums in die mennonitische
Kultur einpflanzte. Von da an gehörte es zum guten Ton, zum gesellschaftlichen Ansehen des tüchtigen Bauern und zu den Erwartungen einer neuen Marktwirtschaft, dass der
Landbesitz nach Möglichkeit ausgedehnt werden musste um die Produktivität zu erhöhen.
Viel Land, gutes Land, wurde für uns Russlandmennoniten zu einem äußerst wichtigen Begriff. Die Werbung um deutsche Bauern vom Fürsten Potemkin und Katharina der Großen, hatte den Eindruck gegeben dass Südrussland nur spärlich besiedelt sei, dass somit viel Land zur Verfügung stehe. Es stellte sich aber bald heraus, dass dem nicht so war. Es war sogar ziemlich dicht besiedeltes Land. Die Ausdehnungsmöglichkeiten waren schon für die ersten Tochterkolonien kompliziert; oft konnte Land überhaupt nur gepachtet werden. Als viele Mennoniten im 19. Jh. nach Kanada zogen, hofften sie auf den weiten Prärien genügend Land zu finden und mussten feststellen dass die ihnen zugewiesenen Landstriche am Red River nicht menschenleer waren. Gruppen eines Stammes von Einheimischen lebten dort. Und selbst im „gänzlich unbewohnten
Chaco" den H. S. Bender in seiner berühmt gewordenen Rede von 1930 anpries, waren Menschen da, Ureinwohner, die dieses Land seit Jahrhunderten ihre Heimat nannten. Sie waren zwar bereit, diese mit den Neuankömmlingen zu teilen, nicht jedoch, sie abzutreten.
Wenn man mennonitische Blätter oder auch historische und theologische Fachjournale durchgeht, muss es auffallen dass die Thematik von
Landbesitz und -nutzung zwar wiederholt zur Sprache kommt aber selten eingehender behandelt wird. Dabei lässt sich nicht übersehen dass es, wo das Denken einer Gemeinschaft noch nicht ganz säkularisiert ist, auch zu einer theologischen und ethischen Frage werden muss. Im Alten Testament war dies jedenfalls eine ganz zentrale Frage.
Bei uns in
Paraguay hat es in den letzten zwei Jahrzehnten eine ziemlich starke Bewusstmachung in Sachen
Umweltschutz und Formen der Landnutzung gegeben.
Landbesitz und das
Zusammenleben mit andern Kulturen ist Bestandteil dieser Frage, die sich nicht auf Dauer an den Rand der Diskussion schieben lässt.
Die gegenwärtige Ausgabe des Jahrbuches war als eine orientierende Bestandsaufnahme zu diesem Thema gedacht, und als Ermutigung zum Weiterdenken. Nicht alle zugesagten Beiträge kamen ein, so dass das Ziel nur unvollkommen erreicht werden konnte.
Die im kulturellen Teil gesammelten Erzählungen, Berichte und Reisebeschreibungen, bieten Einblick in den Prozess der Erschließung des
Chaco während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dass verschiedene Interessen und Gruppen mit beteiligt waren in diesem Prozess, wird ersichtlich. Als wesentlicher Faktor muss auch noch der
Chacokrieg erwähnt werden, der die Öffnung dieses Gebietes stark beschleunigte.
Allen Schreibern sei an dieser Stelle gedankt. In der Hoffnung dass die hier gesammelten Beiträge zur weiteren Forschung beitragen werden, empfehlen wir auch dies Jahrbuch 2003 allen geschätzten Lesern.
Gundolf Niebuhr

Agronom Robert Unruh
im Gespräch mit einem Bauern auf
Yalve Sanga,
ca. 1965
Vorträge
Das Dorf und die mennonitische Gemeinschaft
Peter P. Klassen
1. Einleitung
„Das Dorf im Abendgrauen" heißt eine Sammlung von Gedichten des mennonitischen Dichters Fritz Senn, herausgegeben vom Verein zur Pflege der deutschen Sprache in Winnipeg, Kanada, 1974. Hier eines seiner Gedichte:
An jedem Abend An jedem Abend naht das Bild:
Das Dorf im Abendgrauen,
Drauf starren dann gerührt und mild,
Die Bauern mit buschigen Brauen.
Trogwagen mit dem Wasserfass
Im Mondschein auf dem Hof zu sehn,
Den Bauern werden die Augen nass,
sie möchten nach Hause gehen!
Die Grillen geigen die ganze Nacht,
Die Knechte singen Heimwehlieder,
Akazien blühen in voller Pracht
Und Frösche quaken hin und wieder!
So lebt sie in unserer Erinnerung fort,
Urwüchsige Steppe, mondbeschienen,
Mit friedlichen Dörfern hier und dort,
Und fleißigen Bauern mit ernsten Mienen.
Und mögen sie drohen böse und wild,
Die Wetterwolken sich türmen und brauen,
In ihrem Herzen ruht es mild,
Das Dorf im Abendgrauen!
(2)
Es ist eine große Sehnsucht nach etwas Verlorenem, die aus diesem Gedicht und auch aus manchen der andern spricht, und die Sehnsucht hat sicher manches an Romantik und Idealisierung geschaffen. Wie vielen der aus Russland Geflüchteten oder Ausgewanderten ist es so ergangen, und wir können diese Erscheinung sicher auch schon bei uns in
Paraguay feststellen.
Ich traf den Schriftsteller Arnold Dyck einige Jahre vor seinem Tod in Deutschland. Er war aus Kanada zu seiner Tochter Hedi Knoop nach Deutschland gezogen. „Es gibt so viel Schönes in der Welt, in Kanada und hier in Deutschland", sagte er, „doch nichts ist schöner als ein mennonitisches Dorf in Russland im Mondenschein."
Auch meine eigenen Erinnerungen tragen bereits romantischen Charakter. Unsere
Familie kam bei der Gründung der
Kolonie Fernheim in das Dorf Rosenort mit 28 Wirtschaften. Die großen Familien hatten viele Kinder und Jugendliche. Die strohgedeckte Schule war also immer mit Schülern gefüllt. Hier fanden auch die wöchentlichen Jugendstunden und die Übstunden eines großen Sängerchores statt. Die häufigen Hochzeiten waren Dorffeste, nach allen Formen und Regeln vorbereitet und ausführlich in der Gesellschaft kommentiert, mit der Vorhersage von Glück oder Leid. Die Jugend spielte auf den Polterabenden Schlüsselbund. „Hell glänzt des Mondes Licht am Himmel droben, und in der Ferne donnern Kanonen. . .", sang sie. (Im nahen Toledo donnerten sie während des Chacokrieges tatsächlich). Es waren die Küchen- oder Bänkellieder, die die wandernden Mennoniten aus Russland und dorthin wohl schon aus Preußen mitgebracht hatten.
Die Begräbnisse versetzten das ganze Dorf in Trauer. „Uj, min Schneppeldoak,"
(3) sagte Justin, unsere große Pflegeschwester, ehe sie zum Begräbnis ging. Sie wusste, dass sehr geweint werden würde, und das war die herzliche Teilnahme am Leid der andern. Wenn der Sängerchor dann das traurige Begräbnislied „Fallende Blätter" sang, blieb kein Auge trocken.
Auch das geistliche Leben erhielt Dorfgepräge. Es war damals für den Einzelnen wohl stärker bestimmend als die Gemeindezugehörigkeit, denn die Glieder der drei Gemeinden waren verstreut auf die ganze
Kolonie, ein Beschluss in Deutschland vor der Auswanderung, wie weiter unten erklärt. Im Dorf waren alle drei Gemeinden vertreten, und man wusste kaum, wer zu welcher
Gemeinde gehörte. Der moralische Druck auf den Sünder aber war im Dorf wahrscheinlich größer als der von der nicht präsenten
Gemeinde her.
Die Schule war groß genug für die sonntäglichen Gottesdienste, und sie war immer voll besetzt. Die
Prediger des Dorfes von den verschiedenen Gemeinden predigten reihum. Die Sonntagsschule am Nachmittag war für alle Kinder Selbstverständlichkeit, wenn auch nicht gerade eine sehr beliebte Unterbrechung des sonntäglichen Badens auf dem Wasserkamp, bei uns Kuta genannt, am Nachmittag.
Das von Russland her mitgebrachte und hier gepflegte Brauchtum schloss neben Hochzeit und Begräbnis auch das
Schweineschlachten, das
Scharwerk und einiges mehr ein. Alles förderte das Gemeinschaftsleben im Dorf und schloss auch Auseinandersetzung, Streit und Klatsch mit ein.
Das Dorfbewusstsein war so ausgeprägt, dass man dem „Butendarpa" mit Vorbehalt und Misstrauen begegnen konnte. Kam ein junger Mann aus einem andern Dorf, um hier ein Mädchen zu suchen und zu heiraten, war er womöglich den Schikanen der Dorfjungen ausgesetzt, und man forderte von ihm eine Zahlung, „Magritsch" genannt.
Daneben entwickelte sich aber auch eine gehobenere Dorfkultur, von der Schule, dem Sängerchor und Musikgruppen wie auch von der Jugendgruppe gepflegt. Alle Veranstaltungen, oft mit großem Eifer vorbereitet, waren sehr dorfeigen; denn bis zum nächsten Dorf waren es immerhin sieben Kilometer, für
Ochsenwagen eine weite Strecke.
Keine Frage, dass so ein geschlossenes Dorfmilieu sehr stark prägend auf die Entwicklung eines jungen Menschen wirkte, wohltuend insgesamt, würde ich sagen. Allerdings gab es auch den Dorftrottel, den Außenseiter oder den Lehrer in allzu gehobener Stellung, auf denen dann der Druck der kleinen Gesellschaft erbarmungslos lasten konnte. Der Gesellschaftsdruck konnte gelegentlich so stark werden, dass Einzelne es vorzogen, das Dorf zu verlassen.
Ein weiteres Erlebnis der Dorfgemeinschaft waren für mich die ersten fünf Jahre meiner Lehrerpraxis in dem Dorf Orloff. Von der pädagogischen Erfahrung her sind diese Jahre später nie übertroffen worden. Hingabe und pädagogischer Bezug von meiner Seite, Liebe und zum Teil Verehrung von Seiten der Schüler vereinigten sich mit einem Eingebundensein in eine wenn auch nicht gerade harmonische so doch integere Dorfgemeinschaft. Auch hier waren die damals kinderreichen Familien in der Lage, die Schülerzahl ständig auf etwa 25 zu halten. Die drei bis vier Schuljahre in einem Klassenraum, beim Eintreffen der
Flüchtlinge 1947 waren es sogar sechs, belebten die didaktische Flexibilität. Die Schule als kultureller Mittelpunkt eines Dorfes kam dabei zur vollen Geltung.
Sicher ist meine Erfahrung des Dorflebens kein Einzelfall. Die Dörfer in den ersten Jahren der Ansiedlung waren gezielt auf diese Funktion als sozialer Organismus ausgerichtet worden, wie weiter unten noch deutlich werden wird. Es muss aber wohl allgemein festgestellt werden, dass dies Vergangenheit ist, wenn man so will, ein verlorenes Paradies.
Das Dorf gehört zu den ältesten Formen menschlichen Zusammenlebens. Mit ein wenig Respekt könnte man auch die früheren Grashütten der Indianer als Dorf bezeichnen.
Die Dorfformen waren und sind sehr unterschiedlich. Sie werden durch sehr verschiedene Umstände bestimmt, zum Beispiel davon, wie sie entstanden und gewachsen sind, von den geographischen Gegebenheiten oder von der politischen Situation her. Vor allem aber spielt auch die
Tradition eine bedeutende Rolle. Man weiß eben, wie ein Dorf sein muss, und so wird es angelegt.
Der Weiler umfasst nur ein paar Hütten. Es gibt den Rundling mit einem Marktplatz im Zentrum, es gibt das Haufendorf, das meist sehr langsam und ungeordnet gewachsen ist. Langgestreckte Dörfer liegen in Tälern, deren Form sie sich angepasst haben.
Im Flachland des Nordens entstanden die Reihendörfer als Waldhufen- oder Marschhufendörfer. Die als Hufen bezeichneten Ackerflächen in einer bestimmten Größe (die Hufen waren auch das Flächenmaß) lagen hinter den in einer Reihe liegenden Höfen, wobei die Hufen dann an den Deich oder an einen Waldstreifen reichen konnten, was gleichzeitig auch zur Aufsicht, zum Beispiel der des Deiches, verpflichtete. Diese Dorfform war besonders auch in den Niederlanden, der Urheimat der Russlandmennoniten, bekannt, wobei die zu beaufsichtigenden Kanäle oft auch die Richtung und Form des Dorfes bestimmten.
Einen besonderen Charakter erhielt das Dorf überall dort, wo es durch Kolonisation entstand. Hier wuchs die Ortschaft nicht organisch über lange Zeiträume, wie das bei vielen Dorfformen in alten Siedlungsgebieten der Fall war. Bei der Kolonisation musste geplant und ausgeführt werden. Das war zum Beispiel in Ostelbien der Fall, wohin sich die westliche
Kultur langsam durch Besiedlung in das slawische Gebiet vorschob.
(4)
Hier, besonders im nördlichen Tiefland, wurde das Straßendorf, einreihig oder zweireihig, die beliebteste Form. Es wurde gern schnurgerade angelegt, was dem Ordnungssinn entsprach. (Noch heute kann man es in
Filadelfia schlecht vertragen, wenn eine Straße schräg verläuft, wie etwa die beim
Lehrerseminar, die ihre Richtung einmal durch die Lage des ersten Flughafens erhielt). Die einzelnen Höfe lagen in den Straßendörfern verhältnismäßig dicht beieinander, was dem Gemeinschaftssinn und dem Sicherheitsgefühl einer Siedlungsgruppe entgegenkam. Hinter den Höfen lagen die Ackerfluren.
Das Dorf in seiner Struktur forderte auch zur Selbstverwaltung heraus. Es bildete eine kleine soziale Einheit. Die Angelegenheiten des Dorfes, ob Schul- oder Kirchenbau, ob Instandhaltung der Straße, die gerechte Zuteilung von Hufen, die Regelung des Gebrauchs der Gemeindeweide, der Allmende, der Unterhalt von Deichen oder Kanälen bis hin zur Anstellung des Lehrers und des Hirten mussten von den Bauern selbst geregelt werden. Einem gewählten Dorfschulzen, meist mit einigen Schöffen, wurde diese Verantwortung übergeben. Ihm stand sehr oft auch die niedere Gerichtsbarkeit zu, d.h. er hatte Streitfragen im Dorf zu regeln.
So wurde das Dorf auch zur Urform politischer Verwaltung und Verantwortung. Im Dorf, das kann man vorwegnehmen, lag auch der Keim dafür, dass die nach Osten geflüchteten
Täufer-Mennoniten sich selbst in die politische Verantwortung begaben. Das war schon in Preußen der Fall. Sie widersprachen damit einem immer noch hoch gehaltenen täuferischen Glaubensgrundsatz, nämlich unpolitisch zu sein, ohne es richtig wahrzunehmen. Im Dorf übernahmen die Mennoniten, jedenfalls wenn sie in einer beachtlichen Mehrheit waren, alle Verantwortung des sozialen, kulturellen und politischen Lebens, wenn auch in stark verjüngtem Maßstab.
(5)
3. Das Dorf und die mennonitische Glaubensgemeinschaft
Das Dorf als Siedlungsgemeinschaft hat sich im Lauf der Jahrhunderte aufs engste mit der Glaubensauffassung und Lebensführung der nach Osten gewanderten Mennoniten verbunden. Das geschah nicht schlagartig oder als ein bewusster Teil des Glaubensbekenntnisses. Es entwickelte sich langsam aus einem Bedürfnis heraus, das allerdings voll der Glaubensauffassung entsprach. Die Gläubigen wollten in einer meist fremden Umwelt, die zusätzlich auch als „Welt" im biblischen Sinn empfunden wurde, auch räumlich beisammen sein, ihr Leben in ihrem Sinn gemeinsam gestalten.
E. K. Francis schildert den Werdegang so: „Die
Wanderungen der Mennoniten geben ihr Suchen nach Ländern, wo es noch Toleranz gab, wieder: Holland, Polen, Russland, die Neue Welt. Immer waren Opfer damit verbunden. Das Zurückziehen von der Welt, oder, was dasselbe ist, von einer totalen Gesellschaft, war immer zugleich Mittel, Reibungen zu vermeiden und täuferische Lebensweise unverfälscht zu erhalten. Je vollständiger dies geschah, umso besser wurde beides gewährleistet. Das ist auch der Grund dafür, dass die Kolonisation von vielen… als die willkommene Lösung (für ein Leben der Glaubensgemeinde im Diesseits) angesehen wurde. Als die Mennoniten von Holland nach Polen zogen, wurde ihnen nicht nur Lebensunterhalt und religiöse Toleranz zugesichert, sondern in vielen Fällen auch die Möglichkeit geboten, geschlossene Siedlungen zu gründen. Die Selbstgenügsamkeit des Dorflebens zu jener Zeit wie auch die völkisch-kulturelle wie sprachliche
Absonderung von den meisten Nachbarn erlaubten ein hohes Maß an Isolation. Doch wurden die
Absonderung und Isolation in Preußen nie so vollständig durchgeführt wie später in Russland und in der Neuen Welt. . ."
(6)
Das, was in Polen und Preußen beinah instinktiv angestrebt wurde, nämlich die geographische Isolation, wurde dann in Russland unter dem Kolonialgesetz der Zaren als ein Geschenk des Himmels empfunden. Die
Absonderung von der Welt im Dorf war verordnet und durch Gesetz abgesegnet. In einem Dorf und dann auch in der
Kolonie durften nach dem Kolonialgesetz nur Mennoniten siedeln, wie in andern Kolonien nur Katholiken oder nur Lutheraner. Dadurch wollte die russische Regierung möglichst Reibungen und Streit vermeiden, und sie kam damit dem Bedürfnis der Mennoniten voll entgegen.
Die Lebens- und Glaubensgemeinschaft, von der Zusammensetzung der Mitglieder her nun deckungsgleich, wuchs hier zu einer Einheit zusammen. Das Verständnis von der apostolischen
Gemeinde, deren Substanz durch Kontrolle über Aufnahme und Ausschluss am besten erhalten werden kann, fand im mennonitischen Dorf seine sichtbare, überschaubare und kontrollierbare Form. Alle kannten alle, man konnte einander helfen, beistehen und im gesellschaftlichen und geistlichen Sinn auch wahrnehmen.
Kirche und Schule, die beiden Garanten für die Pflege des Glaubenslebens nach der jeweils geltenden Auffassung der reinen Lehre waren im Dorf und wurden von der Dorfgemeinschaft in ihrem Sinn unterhalten. Die Schule galt dabei als die Sicherung des Nachwuchses für die
Gemeinde. Der Kampf der konservativen Mennoniten in Kanada um die Schule in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ist ein Beleg dafür.
Diese Entwicklung trug aber den Keim dafür in sich, den Charakter der Glaubensgemeinde zu verändern, wie oben angedeutet. Es war nicht zu vermeiden, dass die Dorfgemeinschaft mit der Zeit nicht mehr das repräsentierte, was eine
Gemeinde ohne Flecken und Runzeln, wie von den Täufern konzipiert, darstellen sollte. Alle erwachsenen Bewohner des Dorfes waren spätestens bis 1860, als die Brüdergemeinde entstand, auch getaufte Glieder der
Gemeinde. Doch die Dorfgemeinschaft, die zugleich auch die
Gemeinde repräsentieren sollte, war eine Gesellschaft geworden, die nun „Heilige und Sünder" mit einschließen musste, wie Francis es formuliert. „Die
Bruderschaft hatte sich in das verwandelt, was sie früher als Kirche bezeichnete, in die Kirchengemeinde der mennonitischen
Kolonie, deren Namen sie nun auch meist trug:
Bergthaler, Chortitzer, Halbstädter
Gemeinde und viele mehr," schreibt er.
(7)
Diese Situation wurde häufig diskutiert, beschrieben und kritisiert, und manche Veränderung hat stattgefunden. Dennoch hatte sich das Dorf als Inbegriff für das mennonitische Gemeinschaftsleben so stark mit der mennonitischen Glaubensgemeinde verzahnt, dass es schwierig wurde, beides voneinander zu trennen. Immer wieder setzte sich bei neuen Siedlungsunternehmen diese Siedlungsform durch, immer wieder sah man in ihr auch einen Garant für ein gesundes Mennonitentum nach der jeweiligen Auffassung.
Allerdings schloss Mennonitentum nun mehr ein als nur die Glaubensauffassung. Von außen her, das heißt von den Menschen der sie umgebenden Umwelt, wurden die Mennoniten als Mitglieder einer Deutsch sprechenden, ethnisch einheitlichen Siedlergruppe angesehen, und so sahen sich die Mennoniten dann oft auch selbst. Das wird im Folgenden deutlich werden.
4. Zur Geschichte des mennonitischen Dorfes
In gewissem Sinn war das mennonitische Dorf schon vor dem mennonitischen Glauben da. So jedenfalls versucht es Adolf Ehrt in seiner Beschreibung des russländischen Mennonitentums nachzuweisen. Der genuine Charakter dieser Menschen, ihre sprichwörtliche Tüchtigkeit und ihr Organisationstalent, wurzele nicht in ihrem Glauben, wie oft und gern angenommen, sondern in ihrer Herkunft. Auch der typische gemeinschaftsbildende Dorfcharakter sei darauf zurückzuführen.
In
Flandern und in andern Teilen der
Niederlande, so stellt er fest, gab es schon im 12. Jahrhundert Dörfer mit einer hochentwickelten Wirtschaft, mit Ackerbau und
Viehzucht. Im Kampf mit der Entwässerung des Bodens entwickelten sie einen wahren wirtschaftlichen Rationalismus, verbunden mit einem ausgeprägten Gemeinschaftssinn. Gerade hier entstanden im 16. Jahrhundert große Mennonitengemeinden. Sie hätten dann, so Ehrt, ihre wirtschaftlichen Fähigkeiten und die Siedlungsform aus dem niederländischen Gebiet mit in das Weichselgebiet gebracht. Die Bedürfnisse des Glaubenslebens verbanden sich hier mit den bereits vorliegenden traditionellen Kenntnissen und Fähigkeiten.
(8)
Im Weichselland war das Dorf als Siedlungsform durchaus nicht selbstverständlich. Viele Bauern siedelten dort in verstreuten Einzelgehöften, so auch viele Mennoniten. Doch Horst Penner weist nach, dass die polnischen Gutsherren den holländischen Einwanderern auf deren Wunsch erlaubten, in geschlossenen Dörfern zu siedeln. Es entstanden die sogenannten Holländerdörfer. Penner nennt Campenau (1584), Markushof (1590) und Altrosengart (1590) im Kleinen Werder.
(9)
Jedenfalls kamen die Mennoniten dann mit einigen Erfahrungen in der Anlage und der Organisation von Dörfern nach Russland.
Das typische mennonitische Straßendorf hat sich dann erst in
Russland in seiner bekannten Form entwickelt. Hier trafen einige Elemente zusammen. Das ebene Land der südrussischen Steppe bot eine gute Voraussetzung für das sauber geordnete Straßendorf. Von der Regierung war das Dorf als kleinste, überschaubare und gut zu verwaltende Landgemeinde verordnet worden, ähnlich wie die Mirskoje, das Dorf für die Russen. Mehrere solcher Dörfer wurden zu einem größeren Verwaltungsbezirk, der
Kolonie oder Wolost, zusammengefasst.
(10)
Über hundert Jahre lebten die Mennoniten in Russland wie selbstverständlich in dieser Dorfform. Sie wussten, wie ein Dorf angelegt, unterhalten und verwaltet werden musste. In immer neue Siedlungsgebiete, den so genannten Tochterkolonien, brachten sie dieses System, und es bewährte sich tadellos. Auch das Gemeindeleben bettete sich immer neu in die neuen Siedlungen ein, und es spielte dabei für diese Dorfform keine große Rolle mehr, welche der nach 1860 bestehen unterschiedlichen Gemeinden dominierend war.
Wie tief sich diese Siedlungsform in die Mentalität der Mennoniten eingraviert hatte, zeigte sich, als 1874 die erste Auswanderung von Russland nach
Kanada zustande kam. Die
Bergthaler, die Russland der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht wegen verlassen hatten und dann in
Manitoba in der Ost- und
Westreserve siedelten, kollidierten hier mit dem geltenden „homesteading". Es war das in Kanada jedem Siedler zugesprochene Recht, auf seinem eigenen Grund und Boden seine Farm anzulegen. Der Siedler fühle sich erst wohl, hieß es, wenn er den Rauch des Nachbarn nicht sehen konnte.
Der Schock der mennonitischen Einwanderer war groß. Sie sollten hier auf das traute Dorf verzichten. Größer noch war der Schock bei den Ältesten der Gemeinden. Wie sollten sie eine
Gemeinde betreuen und wahrnehmen, wenn die einzelnen Farmen weit über das Land verstreut waren?
Herbert Wilhelmy hat diesen Vorgang untersucht, und er stellte fest, dass die mennonitischen Einwanderer eine originelle Lösung fanden. Sechzehn Farmer legten ihre jeweils 160 Acker, die zu einer „Homestead" gehörten, zusammen, und zwar zu einem großen Geviert. Etwa in der Mitte legten sie das Straßendorf Rosengart an, das Wilhelmy als Beispiel anführt. Das Land von vier Farmen war die Allmende, die gemeinsame Viehweide, die andern Farmen wurden so an die Dorfbewohner aufgeteilt, dass alle gleichviel und gleich gutes Land erhielten.
(siehe Karte 1)
Die Gemeindeleitung hatte so eine gute Übersicht über ihre Glieder. Zum Fehlverhalten, das von der
Gemeinde geahndet wurde, gehörte auch, wenn jemand aus der Dorfgemeinschaft ausbrach. Er wurde dann auch aus der Glaubensgemeinde ausgeschlossen. Andererseits konnte ein aus andern Gründen ausgeschlossenes Gemeindeglied durch Meidung von der Dorfgemeinschaft so stark isoliert und unter Druck gesetzt werden, dass es dadurch entweder zum Auszug oder wieder zurück in die
Gemeinde gebracht wurde.
Auf die Dauer ließ sich dieses System in dem freiheitlichen Kanada aber nicht beibehalten. Die unvermeidlichen Auflösungserscheinungen des Dorfes deuteten die Ältesten als Zeichen der Verweltlichung, und sie wurden später mit ein Antrieb für die Auswanderung.
(11)
Bei der Auswanderung nach
Mexiko 1922 kam die Verbindung von Dorf und
Gemeinde noch einmal wieder so recht zur Geltung. Die Dorfgemeinschaften wurden schon in Kanada zusammengesetzt, jeweils 24 bis 28 Wirtschaften, groß genug für einen gesellschaftlichen dörflichen Organismus.
Leonhard Sawatzky schreibt, dass nun die kanadischen Maße mit nach Mexiko genommen wurden. Auf der Grundlage von 160 Ackern, wie eine „Home- Stead" in Kanada, wurden die Wirtschaften eingerichtet und alles im Geviert nach Quadratmeilen angelegt, obwohl in Mexiko Kilometer und Hektar gelten.
So wurde auch in Mexiko das Dorf zur Grundlage des gesellschaftlichen Lebens und auch für die Glaubensgemeinde. Sawatzky weist die bis heute geltende Kraft der Gemeindeverwaltung in diesen Siedlungen nach. Die unveränderliche Siedlungsstruktur sichert auch den konservativen Charakter der Gemeinden ab. Wer heute das Siedlungsgebiet der Mennoniten in Mexiko auf der Karte sieht, ist beeindruckt von der geometrischen Ordnung. Alles verläuft rechtwinklig und möglichst im Sinn der Himmelsrichtungen, und so rechtwinklig scheinen auch die Gemeinden zu bleiben.
(12)(siehe Karte 2)
Nicht weniger ausgeprägt war der Wille, auf dem neuen Siedlungsland wieder Dörfer im Sinn der Erinnerung an Russland anzulegen, als die Auswanderung der konservativen Mennoniten von Kanada nach
Paraguay begann.
Auf der Predigerberatung in Saskatchewan am 17. Januar 1923, bei der es um die Frage der Auswanderung nach
Paraguay ging, wurde nach Punkt 2 des Protokolls beschlossen, „nur in Dörfern anzusiedeln, und zwar mit je 30 Wirtschaften von je 190 Ackern auf jeweils drei Meilen im Quadrat."
(13) Damit sollte dann auch das Bestreben, die alte Gemeindeordnung wieder herzustellen, gesichert werden.
Die Beschlüsse für die Struktur der Dörfer und der ganzen Siedlung wurden in Kanada in völliger Unkenntnis oder jedenfalls in Verkennung der geographischen Situation gemacht. Den Dörfern der
Kolonie Menno wurden dann ab 1927 nach dem paraguayischen Vermessungssystem je eine Quadratlegua zugeteilt, ohne zu berücksichtigen, wie viel für den Ackerbau taugliches Kampland vorhanden war. Da man von Kanada her die Nord-Süd- oder die Ost-West-Richtung als verbindlich sah, ähnlich wie dann auch in Mexiko, kam es zu unglücklichen Dorfanlagen. Wilhelmy untersuchte und beschrieb sie 1936. Am Beispiel des Dorfes
Bergthal wies er nach, wie ungerecht die Verteilung von Ackerboden für die einzelnen Bauern werden konnte, weil die Dorfachse nicht der Achse des Kampes, auf dem das Dorf angelegt wurde, entsprach. Die Dorfachse musste in diesem Fall unbedingt in Nord-Süd-Richtung liegen, während die Kampachse schräg dazu lag.
(14)(siehe Karte 3)
Noch krasser kommt das bei einer Kartenskizze vom Dorf Schöntal von Hendrik Hack zum Ausdruck.
(15)(siehe Karte 4)
Wie stark in der
Kolonie Menno über viele Jahre der Hang zum Dorf blieb, zeigte sich, als das Dorf
Sommerfeld als Zentrum eingerichtet werden sollte. Die Geistlichkeit und wohl auch viele Bürger befürchteten weltliche Einflüsse, gegen die sich ein geschlossenes Dorf immer noch besser wehren konnte als eine relativ offene Stadt. Erst nach großem Widerstand erklärte sich die Mehrheit der Bürger bereit, das nun als
Loma Plata bezeichnete Zentrum in Form einer Stadt einzurichten.
(16)
Die Gründung und Organisation der
Kolonie Fernheim um 1930 verlief nach ähnlichem Muster,
(siehe Karte 5) wenn hier auch einige konservative Elemente wegfielen. Es war hier sogar so, dass einige Beschlüsse gefasst wurden, die dem oben dargestellten Zug, die Gemeindestabilität zu stärken, entgegenzulaufen scheinen. Noch im Flüchtlingslager in Mölln, wo die Dorfschaften für den
Chaco in
Paraguay zusammengestellt wurden, beschloss man, dass weder die Gemeindezugehörigkeit noch die Herkunftssiedlung in Russland noch Familienbande eine Rolle für die Dorfzugehörigkeit spielen durften. Nur Verwandte ersten Grades durften Anspruch auf Zusammenwohnen in einem Dorf erheben. In allen andern Fällen entschied rigoros das Los.
(17)
Die Absicht dabei war, dass eine richtige Siedlungsgemeinschaft entstehen sollte, in der Cliquen nicht allzu starken Einfluss hätten. Bei der Vielfältigkeit der Herkunft aus Russland und auch bei der unterschiedlichen Gemeindezugehörigkeit war das für manche eine harte Maßnahme. Sehr oft kannten sich die neuen Dorfgenossen kaum.
Vielleicht liegt in diesem Beschluss auch eine Wurzel dafür, dass die Gemeinden heute noch um ihre Priorität den Ortschaften gegenüber ringen müssen. Die Dorfgemeinschaften entwickelten sich, wie beabsichtigt, zu einem sehr starken und tragenden gesellschaftlichen Gebilde, das zu einem Teil auch das geistliche Leben mit einschloss, wie eingangs dargestellt wurde. Jedes Dorf wurde sozusagen für sich eine Glaubens- und Schicksalsgemeinschaft.
Andererseits hatten die in so weiter Ferne ohne Kenntnis der Sachlage gefassten Beschlüsse auch fatale Folgen. Die in Mölln zusammengestellten Dorfschaften wurden auf 25 Wirtschaften festgelegt, mit einer zusätzlichen Stelle für die Schule. Das Straßendorf sollte also 13 Hofstellen an jeder Straßenseite haben. Der Grund dafür war plausibel. Eine Dorfgemeinschaft musste stark genug sein, um vor allem eine Schule tragen zu können, und auch für das kulturelle Leben erschien das wichtig.
Doch niemand kannte die Kämpe im
Chaco, die nach Westen von der
Kolonie Menno hin, wo die
Kolonie Fernheim angelegt werden sollte, immer kleiner werden. So kam denn eine Gruppe von 25 Familien oft auf einen sehr kleinen
Kamp, und man musste sich in das Land teilen. Die Hofstellen in dem Straßendorf konnten deshalb manchmal nicht mehr als 70 Meter breit werden. Von den 40 Hektar, die jedem Siedler laut Landvertrag zustanden, waren meist nur fünf Hektar oder auch weniger für den Ackerbau brauchbares Kampland.
Das wird an einer Kartenskizze deutlich, die Wilhelmy 1936 von dem Dorf Friedensruh machte. Auch hier sieht man, dass die gerade Dorfstraße nicht der Kampform entspricht. Wilhelmy wollte aber vor allem nachweisen, dass der
Kamp viel zu dicht besetzt war. (Die auf der
Karte eingekreisten Hofstellen gehören Bauern, die nach Ostparaguay abwandern wollten).
(18)
Nun war anfangs bei den oft spärlich einsetzenden Regen und den langsamen Ochsen auch nicht viel mehr zu bearbeiten als die wenigen Hektar Kampland. Doch sehr bald machte sich die Überbesetzung der Kämpe bemerkbar. Auch lagen die Dörfer meist viel zu nahe beieinander, was die
Viehzucht, die auf die offene Weide angewiesen war, stark behinderte. Bestes Beispiel dafür sind die Dörfer Friedensruh, Schönwiese und Schönbrunn, die sehr dicht beieinander liegen.
Die Abwanderung der Friesländer schaffte dann eine Lösung, obwohl damals bereits auch ein anderer Ausweg erwogen wurde. Das
MCC war bereit, der
Kolonie Fernheim bei der Ausdehnung nach Süden hin zu helfen. Doch dafür waren die Vorbereitungen für die Abwanderung bereits zu weit vorgeschritten. (In unserm Dorf Rosenort blieben 1937 von 28 Familien nur sieben zurück. Fünf kamen aus andern Dörfern hinzu, so dass es dann zwölf waren). Wirtschaftlich waren die Dörfer nun stärker, doch die kulturelle Infrastruktur, wie sie in Mölln geplant worden war, war dabei oft verloren gegangen.
In der Anlage der Dorfstruktur ist man in
Fernheim im Lauf der Jahre flexibler geworden, wie die neuen Dörfer beweisen.
Bei der Gründung der
Kolonie Neuland konnte man sich manche Erfahrungen der ersten Kolonien zunutze machen. Man kannte die Kämpe schon vor der Anlage der Dörfer, und die Größe konnte dem zur Verfügung stehenden Land angepasst werden. Außerdem waren die Kämpe weiter im Süden viel größer als die in
Fernheim.
In der Zusammensetzung der Dorfgemeinschaften ließ man den Siedlern freie Hand. So fanden sich Dorfschaften aus Russland hier wieder zusammen. Es entstanden auch reine Brüdergemeindedörfer und ein
Frauendorf. In Chortitza entstand zu Beginn der Ansiedlung sogar eine konservative
Mennonitengemeinde, die sich dann aber auflöste. Ob sich diese Dorfbesetzung schlechter ausgewirkt hat als die vorgeschriebene in
Fernheim, ist mir nicht bekannt.
Die mennonitischen Einwanderer in
Brasilien, die dort 1930 die
Kolonie Witmarsum anlegten, waren über die ihnen aufgezwungene Siedlungsstruktur zunächst enttäuscht. Nach dem Verfahren der Hanseatischen Kolonisationsgesellschaft erhielt jeder Siedler seine
Kolonie, wie man es nannte, zugeteilt. Das waren Grundstücke nach vorgeschriebener Größe, die dem Lauf eines Flusses folgten, in Witmarsum dem Alto Rio Krauel. Das schmale Tal verursachte, dass die Höfe ziemlich weit auseinander angelegt werden mussten. Für das Gemeinschaftsleben war die auf 17 Kilometer ausgedehnte Siedlung bei den fehlenden Verkehrsmitteln ein großes Hindernis. Auf dem
Stoltz-Plateau war es ähnlich.
(19)
Manche führten die große Uneinigkeit in der Siedlung, die schließlich die Auflösung nach sich zog, zum Teil auf diese Siedlungsstruktur zurück. Als dann die neuen Siedlungen
Colonia Nova in Rio Grande do Sul und
Witmarsum in Paraná gegründet wurden, nutzte man die geographischen Möglichkeiten, um wieder Dörfer anzulegen, wie man sie von Russland her kannte. Näher beieinander liegende Höfe sollten die Dorfgemeinschaft fördern.
Doch diese Siedlungsform entsprach den Erwartungen nicht lange. Die notwendigerweise immer stärker werdende Zentralisierung der Siedlung mit Ausrichtung auf ein Zentrum ließ die Dorfgemeinschaften sehr bald zur Bedeutungslosigkeit verkümmern. Wirtschaft, Kirchen und Schule, die wichtigsten Funktionen des Gemeinschaftslebens also, lagen im Zentrum der Kolonie, und die immer stärker werdende Mechanisierung und die Mobilität durch Autos kam dieser Entwicklung entgegen.(20)
5. Auflösungserscheinungen
Die obigen Ausführungen sind weitgehend Geschichte. Die Gründe für die starke Veränderung der Siedlungsstruktur im Lauf der Jahrzehnte sollen hier nur aufgezählt werden.
Die Hauptursache liegt in
Paraguay wie in Brasilien in der immer stärker werdenden Zentralisierung des öffentlichen Lebens, ein Vorgang, der von der ganzen Gemeinschaft als notwendig angesehen und sehr stark gefördert wurde. Nicht nur das wirtschaftliche und kulturelle Leben drängte auf immer stärkere Ausrichtung auf einen tragenden Mittelpunkt, sondern auch das geistliche. Alle sozialen, kulturellen und kirchlichen Einrichtungen brauchten diese Zentralisierung, durch die sich größere Investitionen rechtfertigten. Auch Handwerk und Gewerbe fanden im Zentrum die besseren Bedingungen vor. Verlierer dabei waren die Dörfer, die dadurch viel an gemeinschaftsbildender Qualität einbüßten.
Die Zentralisierung war in erster Linie ein Trend zur Rationalisierung und zur Hebung der Qualität der Einrichtungen. Eine zentralisierte Schule bietet mehr Möglichkeiten als eine kleine Dorfschule. Doch die Ursache lag nicht nur dort. Auch die Dorfgemeinschaften in sich wurden kleiner und damit schwächer, wie bereits deutlich geworden ist.
Über die notwendige Größe einer Dorfgemeinschaft für einen gesellschaftlichen Organismus hatte man sich in Mölln die richtigen Vorstellungen gemacht. Die Wirklichkeit zeigte, dass das Dorf unter den Gegebenheiten im
Chaco nicht lebensfähig war. In Rosenort zum Beispiel war jenes oben als romantische Erinnerung beschriebene Dorfmilieu nach der Abwanderung der Friesländer verschwunden, obwohl das Dorf wirtschaftlich nun stärker war und bestehen konnte.
Ein anderer sehr wesentlicher Faktor für diesen Wandel war auch die Veränderung der Familienstruktur. Wenn etwa bis 1945 noch fünfzehn bis zwanzig Familien in einem Dorf eine Schule Jahr für Jahr mit der notwendigen Zahl von Schülern beliefern konnten, dann war das 1980 schon nicht mehr möglich. Damals hatte ein Ehepaar acht bis zehn Kinder, heute gelten Familien mit drei Kindern als kinderreich. So wurde zum Beispiel die Zentralisierung der Schulen unumgänglich, wodurch dem Dorf dann wieder ein wertvolles
Kultur– und Gemeinschaftselement entzogen wurde.
Tröstlich ist, dass bei allem Wandel der gesellschaftlichen Strukturen alte verloren gegangene Werte meist durch neue, vielleicht nicht weniger bedeutende, ersetzt werden können.
Literaturverzeichnis
- Ebert, W.: Ländliche Siedlungsformen im deutschen Osten, Leipzig, 1936
- Ehrt, Adolf: Das Mennonitentum in Russland von seiner Einwanderung bis zur Gegenwart, Berlin, 1932
- Hack, Hendrik.: Die Kolonisation der Mennoniten im paraguayischen Chaco, Amsterdam, 1961
- Hershberger, Guy F.: Das Täufertum – Erbe und Verpflichtung, Stuttgart, 1963 (hier: Francis, E. K.: Täufertum und Kolonisation).
- Klassen, Peter P.: Die Mennoniten in Paraguay – Band 1, 2. Aufl., Bolanden – Weierhof, 2001 Klassen, Peter P.: Die russlanddeutschen Mennoniten in Brasilien – Band 1, Bolanden – Weierhof, 1995
- Klassen, Peter P.: Die russlanddeutschen Mennoniten in Brasilien – Band 2, Bolanden – Weierhof, 1998
- Penner, Horst: Die ost- und westpreußischen Mennoniten, Karlsruhe, 1978
- Sawatzky, Harry Leonhard: Sie suchten eine Heimat, Marburg, 1986
- Senn, Fritz: Das Dorf im Abendgrauen, Winnipeg, 1974
- Schmieder, O. und Wilhelmy, H.: Deutsche Ackerbausiedlungen im südamerikanischen Grasland, Pampa und Gran Chaco, Leipzig, 1938
Fussnoten:
| |
| Senn, 1974, 9 |
| „Ach, mein Taschentuch" |
| Ebert, 1936, 21f |
| Penner, 1978, 106 |
| Francis in Hershberger, 1963, 263 |
| Francis in Hershberger, 1936, 264 |
| Ehrt, 1932, 16 |
| Penner, 1978, 140 |
| Ehrt, 1932, 36 |
| Schmieder,Wilhelmy, 1938, 89 |
| Sawatzky, 1986,74ff |
| Klassen, 2002, 250 |
| Schmieder, Wilhelmy, 1938, 96 |
| Hack, 1961, 68 |
| Hack, 1961, 74 |
| Klassen, 2001, 253 |
| Schmieder, Wilhelmy, 1938, 123 |
| Klassen, 1995, 107ff |
| Klassen, 1998, 57 |
Ökologische Aspekte in der Entwicklung der Mennonitenkolonien im Chaco
Wilfried Giesbrecht
1. Einführung
Der Umweltforscher Meyer-Abich schreibt folgendes: „Wirklich betroffen sind wir von der Umweltzerstörung nur dort, wo sie schneller voranschreitet als die gleichzeitige Degeneration unserer Wahrnehmungsfähigkeit im Nahbereich".
Diese Aussage bedeutet, dass wir nicht gezwungenermaßen von den Veränderungen in der Umwelt betroffen sein müssen. Manche Veränderungen, verursacht durch menschliches Einwirken, schreiten langsam genug voran, so dass wir uns an diese gewöhnen, bevor wir sie als solche wahrnehmen. Einige Bäume werden gefällt, aber andere bleiben noch stehen; ein
Kamp wird vom Strauch überwuchert; ein Wasserkamp wird schon seit einigen Jahren nicht mehr überflutet; jeden Tag hängen ein paar Plastiktüten mehr im Gebüsch usw. Diese Veränderungen betreffen oftmals nur kleine Flächen oder der Vorgang vollzieht sich so langsam, dass wir ihn kaum richtig bemerken und uns daher von den Veränderungen in unserer Umwelt auch nicht wirklich betroffen fühlen.
Klar, wenn eine großflächige Rodung gemacht wird, nimmt ein jeder die Veränderung wahr und manche reagieren betroffen darauf, aber das ist an dieser Stelle nicht unser Thema. Das Thema „Wald roden" und die gesetzlichen Bestimmungen dazu werden in diesem Jahrbuch separat behandelt. In den folgenden Ausführungen will ich einige andere Aspekte in der Entwicklung der
Mennonitenkolonien im zentralen
Chaco betrachten und ihre Auswirkungen auf die Umwelt ansprechen.
Der paraguayische
Chaco ist eine Ebene von etwa 260.000 km
2, d.h. er nimmt ca. 60% der Landesfläche Paraguays ein, aber nur etwas mehr als 130.000 Einwohner, also rund 2% der Landesbevölkerung. Das aride Klima ist zum Teil der Grund dieser dünnen Besiedlung, denn die Temperaturen steigen im Sommer bis auf 47°C, wogegen sie im Winter manchmal bis um die 0°C reichen, was jährlich einige Nachtfröste verursacht. In Bezug auf die Winde können wir sagen, dass die warmen Nordwinde mit etwa 70% Anteil vorherrschend sind und diese auch sturmartige Stärken erreichen können. Abkühlung dagegen bringen die Winde aus südlicher Richtung.
Im feuchteren Ostteil des
Chaco fallen bis zu 1200 mm Regen im Jahr, während die jährliche Niederschlagsmenge im trockenen Nordwesten selten mehr als 400 – 500 mm beträgt. Bedingt durch die unterschiedlichen Regenfälle und teilweise auch durch die Bodenbeschaffenheit, wobei diese beiden Faktoren gleichzeitig unterschiedliche Vegetationsformen hervorbringen, unterscheidet man zwischen dem oberen
Chaco und dem niederen
Chaco, die durch eine Übergangszone voneinander getrennt sind.
Der niedere
Chaco bedeckt 47% der Fläche des paraguayischen
Chaco und seine typische Vegetation bilden die ausgedehnten Palmsavannen, unterbrochen von Quebracho-
(Shinopsis balansae) und Algarrobowäldern
(Prosopis sp.). Die Vegetation entlang der Flussläufe besteht aus Galeriewäldern. In den tieferen Zonen der Palmsavannen breiten sich Sümpfe und andere Feuchtgebiete aus.
40% Flächenanteil hat der obere
Chaco, der hauptsächlich aus dornigen Trockenwäldern besteht. Auf dem lehmigen Boden wachsen Baumarten wie Palo Santo
(Bulnesia sarmientoi), gelber Quebracho
(Aspidosperma quebracho blanco), Flaschenbaum
(Ceiba insignis), Labón oder Palo Cruz
(Tabebuia nodosa), Kandelaberkaktus
(Stetsonia coryne) etc. Die am weitesten verbreitete Art ist das Rotholz
(Ruprechtia triflora), das im feuchteren Ostteil zu einem richtigen Baum wächst, während es im trockenen Westen eher ein strauchartiges Gebüsch bildet. In den unteren Schichten des Chacobusches wachsen viele Arten von Kakteen und Bromelien.
Den Trockenwald durchziehen alte, versandete Flussläufe, die sogenannten Bittergraskämpe. Diese Kämpe entstanden vor ca. 3000 Jahren durch Ablagerungen, die vom Pilcomayofluss aus den Anden angeschwemmt wurden. Obwohl es auf den ersten Blick so aussieht, als würde diese Landschaft nur wenige Pflanzenarten aufweisen, sind doch 198 verschiedene Arten als ihr zugehörig identifiziert worden. Vorrangig jedoch besteht die untere Schicht aus
Bittergras und der weitläufige Baumbestand setzt sich größtenteils aus rotem Quebracho
(Schinopsis heterofila), Unrunde’i
(Astronium fraxinifolium), Paratodo
(Tabebuia caraiba) und Jacarandá
(Jacaranda mimosifolia) zusammen.
Im Nordwesten des paraguayischen
Chaco befinden sich die Sanddünen, die nur von einer spärlichen Vegetation bedeckt sind und deren Ausdehnung 4% der Chacofläche beträgt. Dieses Gebiet entstand durch die Einwirkung von Sedimenten, die aus der Zone des Parapitíflusses stammen.
Die restlichen 9% des Chacogebietes bilden die Übergangszone zwischen niederem und oberem
Chaco. Diese Landschaft ist eher eine Mischung aus verschiedenen Vegetationsformen, wobei die
Salzlagunen und Gebiete mit stark salzhaltigen Böden besonders typisch für diese Zone sind. Die Pflanzen hier sind allgemein salztolerante Arten, von denen der Nadelalgarrobo oder Viñal
(Prosopis ruscifolia) wohl als die typischste bezeichnet werden kann.
Als Beispiel dafür, wie sich die natürliche Umwelt auch fast ohne den Einfluss des Menschen oder durch Eingriffe außerhalb des betroffenen Gebietes verändern kann, will ich hier kurz auf das Gebiet des Pilcomayoflusses eingehen. Bis 1940 füllte der Pilcomayo das Sumpfgebiet „Estero Patiño" im niederen
Chaco regelmäßig und von da aus gelangte das Wasser über die Flüsse Confuso, Siete Puntas und unterer Pilcomayo bis in den Paraguayfluss. Durch die Ablagerung der riesigen Sedimentmengen aus Bolivien ist der Pilcomayo nach und nach versandet, so dass sein Wasserlauf zwischen den Jahren 1944 und 2000 um 250 km zurückgegangen ist. Allein im Jahr 1984 verkürzte sich dieser Fluss um 45 km. Die Folge ist, dass weite Landstriche, die früher einmal jährlich überschwemmt wurden und offene Naturweiden bildeten, heute diesen Wasserzufluss nicht mehr erhalten und daher mit Algarrobobusch zuwachsen. Die Art und Weise, in der
Viehzucht in diesem Gebiet betrieben wird, verändert sich dadurch grundsätzlich.
3. Geschichte der wirtschaftlichen Landnutzung
Laut Studien werden die Möglichkeiten der Landnutzung im paraguayischen
Chaco folgendermaßen festgelegt: 7% der Gesamtfläche sind relativ gut für den Ackerbau geeignet, während 43% nur beschränkt für diesen Zweck nutzbar sind. Fast die Hälfte, 46%, gilt als für extensive
Viehzucht verwendbar und die restlichen 4% ermöglichen keine landwirtschaftliche Produktion
(2). Es sei aber darauf hingewiesen, dass der Wald bei dieser Studie nicht als Potenzial für die Produktion miteinbezogen wurde.
Eine der bedeutendsten politischen Entscheidungen für den
Chaco war die Privatisierung der Ländereien nach dem Dreibundkrieg (1870), eine Regierungsmaßnahme, die nie gesetzlich geregelt worden ist. Dies ist auch der Grund dafür, dass heute kaum noch Regierungsland im
Chaco vorhanden ist. Die negativen Folgen dieser ungeregelten Situation spüren wir immer deutlicher je mehr dieses Gebiet für Siedlungs- und Produktionszwecke ins Visier genommen wird. Wäre das Chacoterritorium in den Händen der Regierung geblieben, so hätte diese die Möglichkeit gehabt, mit einem territorialen Ordnungsplan das Land zweckbestimmend einzuteilen. Damit stünde dann auch fest, wo die Landreserven für die Indianer, für den
Naturschutz, für die Produktion, für Siedlungen etc. sind, und man hätte nicht dauernd Streitereien über die Nutzung schon gekaufter Ländereien. Die Privatisierung ging jedoch so weit, dass Anfang des 20. Jahrhunderts die Hälfte des paraguayischen
Chaco in der Hand von 79 Eigentümern war, wovon die Firma Carlos Casado alleine 5.600.000 Hektar besaß. Außer für extensive Viehwirtschaft wurde das Land hauptsächlich zur Ausbeutung von Quebrachoholz genutzt. Dieses diente als Rohmaterial zur Tanningewinnung, wofür mehrere Großgrundbesitzer Fabriken entlang des Paraguayflusses aufgebaut hatten. Die Tanninfabrik von Puerto Casado wurde 1996 als letzte ihrer Gattung nach etwa hundert Betriebsjahren stillgelegt.
Im Jahre 1927 kam die erste Gruppe Mennoniten aus Kanada in Puerto Casado an. Diese gründeten etwa 200 km westlich vom Paraguayfluss die
Kolonie Menno und damit begann die mennonitische Besiedlung des zentralen
Chaco. Damals lebten in dem Siedlungsgebiet etwa 500 Indianer der Ethnie Enlhit, mit denen die Siedler schon vorher freundschaftliche Kontakte geknüpft hatten. Etwas später, im Jahr 1930, legten mennonitische Siedler aus Russland die
Kolonie Fernheim an und 1948 wurde die
Kolonie Neuland von mennonitischen Flüchtlingen aus dem 2. Weltkrieg gegründet. Wo immer diese Siedler auch herkamen, ob von der kanadischen Prärie oder den russischen Steppen, sie waren an offene Landschaften und nördliches Klima gewöhnt. Von daher ist es auch verständlich, dass der
Chaco mit seinem dornigen Busch und hartem Klima fremd oder sogar wie ein Schock auf diese Menschen gewirkt hat. Wie den Siedlern damals zumute war, bringt folgender Brief zum Ausdruck, und ich bin der Ansicht, dass viele, wenn nicht sogar die meisten, ähnlich empfunden haben.
Puerto Casado,
Paraguay, den 15. Mai 1927.
Mein lieber Onkel: Wir sind immer auf derselben Stelle, wo wir aus dem Schiff ausstiegen. Haben auch keine Hoffnung weiterzukommen.
Die
Eisenbahn ist nicht zum Siedlungsland hin gebaut. Und wenn wir auch schon auf unser Land gelangen sollten, bleiben können wir dort doch nicht.
Kein gutes Wasser ist zu finden. Der Boden ist hart wie Stein von der brennenden Sonne. Das Land pflügen, wie wir es von Kanada kennen, geht hier gar nicht. Man kann nicht mal mit dem Spaten Land umgraben. Wenn man etwas anfangen will, muss man schon die Spitzhacke nehmen. Wir haben hier in Puerto Casado in der Weise etwas Land bearbeitet, auch etwas gepflanzt, welches auch aufging und dann aber schnell wieder verschwand. Es hat keinen Sinn, etwas zu pflanzen.
Bitte schreibe meinem Bruder in
Manitoba, er soll nur nicht auch noch die Dummheit begehen, dass er sein Land verkauft, um in diesen unfruchtbaren Teil der Welt zu kommen. Besonders für Kinder ist das Klima schwer.
In 5 Monaten sind schon mehr als 50 Personen gestorben. Ich hoffe Euch bald von Angesicht zu sehen. So schnell es geht, fahren wir zurück nach Kanada.
Dein lieber Neffe, A. F. Friesen.
Zu dieser Einstellung gibt David Sawatzky (
Menno) in einem Vortrag folgenden Kommentar:
„Dieser neuen Umwelt etwas abzuringen um zu überleben, war schier unmöglich. Es entwickelte sich bei vielen Siedlern eine feindselige Haltung der Chaconatur gegenüber, die sich bis heute noch erhalten hat, wenn vielleicht heute mehr unbewusst als bewusst. Die Chacoumwelt war immer klarer Sieger, der Mensch der Unterlegene. Der Siedler fühlte sich machtlos. Dieser natürlichen Übermacht konnte man sich erst durch die Präsenz des ersten Bulldozers richtig entgegenstellen. Somit begann eine Epoche, wo der Mensch anfing Sieger über den Chacowald zu werden, dem man nun mit voller Genugtuung anfing zu Leibe zu gehen. Die Anbauflächen konnten nun, wenn auch nur langsam, vergrößert werden. Niemand hatte Bedenken, dass man zuviel roden würde. Begriffe wie
Umweltschutz, ökologisches Gleichgewicht usw. waren fremd. Durch die darauf folgende Mechanisierung der Landwirtschaft und die intensivierte
Viehzucht begann nun eine Epoche, die man den wirtschaftlichen Fortschritt nannte. Der Mensch war seitdem nicht mehr der Unterlegene, sondern der Stärkere".
Während der ersten Jahrzehnte der Ansiedlung im
Chaco, kämpfte man mehr ums Überleben, obwohl es wirtschaftlich ständig aufwärts ging. Für die wirtschaftliche Nutzung kamen hauptsächlich die Bittergraskämpe in Frage, da hier wenig gerodet werden brauchte, wofür man ohnehin nur Handwerkzeug zur Verfügung hatte. Zusätzlich war der sandige Boden leichter zu bearbeiten und für den Ackerbau gut geeignet.
Erst in den fünfziger Jahren kamen die ersten Bulldozer und man konnte bedeutend umfangreichere Rodungen zur Erweiterung der Anbauflächen machen. Anfänglich durfte beispielsweise in
Menno nur ein Hektar pro Wirt gerodet werden, da die Verfügbarkeit der Maschinen einfach nicht weiter reichte. Etwa zur gleichen Zeit wurden auch die ersten Transportwege mit Maschinen gebaut, welches den Transport der Produkte erleichterte und beschleunigte. In den sechziger Jahren wurden auf der Versuchsstation in
Fernheim Versuche zur Verbesserung der Landwirtschaft durchgeführt. Unter der Anleitung von Agronom Robert Unruh erzielte man bessere Resultate in der Landwirtschaft und es wurde auch der erste Büffelgrassamen aus Nordamerika importiert. Ab etwa 1970 wurde die Landwirtschaft weitgehend mechanisiert. Auch wurden immer größere Flächen für Rinderweide gerodet, wobei die
Viehzucht durch angepflanzte Weide (Büffelgras und andere Sorten) großen Aufschwung erlebte. Heute ist der Ackerbau weit zurückgegangen und besteht zum großen Teil im Anbau von Futterpflanzen für die Viehwirtschaft, die im zentralen
Chaco heute den stärksten Wirtschaftszweig darstellt. Verständlicherweise bleibt dieses wirtschaftliche Wachstum in den mennonitischen Kolonien im zentralen
Chaco nicht ohne Folgen. Die Folgen sind sowohl negativer wie positiver Art und betreffen den ökonomischen, sozialen und ökologischen Bereich.
4. Wirtschaftlicher und sozialer Einfluss der Chacokolonien
Obwohl wirtschaftlicher und sozialer Einfluss der Chacokolonien nicht Hauptgegenstand dieser Ausführungen sind, so sind sie andererseits auch nicht von den ökologischen Auswirkungen zu trennen. Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt stehen im Zusammenhang und von daher will ich hier auch kurz auf die ersten beiden eingehen, bevor der ökologische Aspekt näher betrachtet wird.
Der wirtschaftliche Fortschritt im zentralen
Chaco bringt wie überall auf der Welt eine bessere Lebensqualität oder zumindest einen höheren Lebensstandard mit sich. Der wirtschaftliche Fortschritt schafft Arbeitsplätze, ermöglicht Verbesserungen im Erziehungs- und Gesundheitswesen sowie den Ausbau der Infrastruktur u.a.m. Der wirtschaftliche Fortschritt hat auch bewirkt, dass viele Chacobewohner in das Gebiet der Chacokolonien gewandert sind und dass auch ausländische Investoren ihr Land möglichst in der Nähe dieser Kolonien kaufen. Heute leben im zentralen
Chaco ungefähr 30.000 Personen unterschiedlicher Herkunft, die mehr oder weniger mit dem Wirtschaftssystem der
Mennonitenkolonien verbunden sind. Soziale Schwierigkeiten bis hin zur Kriminalität bleiben da nicht aus und alltägliche Dinge wie Abfallentsorgung und
Wasserversorgung sind immer schwieriger zu bewältigen.
Zweifellos ist unser gut ausgebautes Wegenetz einer der Faktoren der einen starken Einfluss ausübt und das in allen drei Bereichen, d. h. Natur, Wirtschaft und Gesellschaft. In einer flachen Landschaft wie dem
Chaco kann ein Weg, auch wenn er nur 30 cm hoch aufgeschüttet wird, wie eine Abdämmung wirken. Dadurch wird der natürliche Wasserlauf in einer Niederung gestaut, was zu
Überschwemmung der Felder und Weiden führen kann oder die Ursache der Bodenversalzung ist. Auch wenn noch Brücken gebaut werden, ändert sich der natürliche Wasserdurchlauf, weil dabei meist ein breiter, flacher Strom auf wenige Meter eingeengt wird, was an und für sich schon zu einem Stau führt. Wirtschaftlich betrachtet erfüllen die Wege eine sehr wichtige Funktion, da sie uns den Zugang zum Markt ermöglichen, andererseits aber auch das Land teurer machen, da mittlerweile auch auswärtige Käufer gemerkt haben, wie wichtig eine gute Zufahrt zum Landgut oder zur Rinderstation ist. Bedingt durch die vielseitige wirtschaftliche Bewegung auf unseren Straßen bleiben auch Gesellschaft und
Kultur nicht von fremden Einflüssen verschont. Die tatsächlichen Auswirkungen unseres Wegnetzes auf den zentralen
Chaco sind umfangreich genug, um dieses Thema separat zu behandeln.
Immerhin kommen 70% aller Milchprodukte des Landes sowie 45% des Rindfleisches mit Exportqualität aus den Chacokolonien, und auch sonst ist der wirtschaftliche Anteil des zentralen
Chaco an der paraguayischen Produktion beachtlich. Heutigen Tages hat das Wirtschafts- und Sozialsystem des
Chaco eine so bedeutende Rolle eingenommen, dass es oft als Lösung für Entwicklungsprobleme wie Landknappheit und Entwaldung dargestellt wird
(3).
5. Auswirkungen der wirtschaftlichen Landnutzung auf die Natur
Unsere natürliche Umwelt muss als ein dynamisches System angesehen werden, in welchem ständig irgendwelche Veränderungsprozesse stattfinden. Nichts in der Natur bleibt, wie es ist, sondern die ganze Natur ist in Bewegung auf der Suche nach ihrem Gleichgewicht. Daher ist der Eingriff des Menschen in dieses System auch meist drastisch und kann verheerende Folgen haben, sofern er unüberlegt und rücksichtslos vorgenommen wird. Ob nun ein Siedler den Wald rodet oder ein Einheimischer einen
Kamp abbrennt, spielt dabei keine Rolle, denn beide suchen durch ihre Tätigkeit ihre Existenz zu sichern. Stärker tritt dabei in Erscheinung, welche Mittel dem Menschen zur Verfügung stehen und wie dicht die Bevölkerung in dem betreffenden Gebiet ist, d.h. wieviele Einwohner sich in einem begrenzten Gebiet ernähren müssen. Bei der Betrachtung eines Satellitenbildes vom
Chaco sieht man sofort, dass im zentralen
Chaco, wo die
Mennonitenkolonien sind, die stärksten Veränderungen stattgefunden haben. Wie schon vorher erwähnt, sollen hier nicht die Rodungen analysiert werden, sondern vielmehr ist es die Absicht auf andere weniger auffallende Aspekte hinzuweisen.
Die Bittergraskämpe bilden wohl die am meisten veränderte Vegetationsformation und gelten als stark gefährdet, da es im zentralen
Chaco anscheinend keinen
Kamp mehr gibt, der groß genug wäre, um ein Muster dieses Landschaftstyps in seiner ursprünglichen Form zu erhalten
(4). Die Bittergraskämpe haben einen für den Ackerbau bevorzugt geeigneten Boden, sind leicht urbar zu machen und von daher besonders beansprucht worden. Heutigen Tages gibt es noch kleinere Kämpe die jedoch häufig mit Kulturgräsern durchsetzt und auch oft weitgehend zugewachsen sind, da sie aus Schutzgründen nicht mehr periodisch abgebrannt werden, was aber zum Erhalt dieser Graslandschaft erforderlich zu sein scheint. Allerdings müssten diesbezüglich zunächst wissenschaftliche Studien durchgeführt werden um festzustellen, ob oder inwieweit kontrolliertes Brennen sinnvoll für die Erhaltung dieses Ökosystems ist. Der Ñandú oder Pampastrauß
(Rhea americana) hat in dieser Landschaft seinen idealen Lebensraum. Eigentlich müsste diese Vogelart durch das Verschwinden der natürlichen Graskämpe in seiner Existenz bedroht oder zur Abwanderung gezwungen sein, was aber nicht stimmt. Vielmehr ist sie im Gebiet der Kolonien heute häufiger anzutreffen als vor 30 bis 40 Jahren, da ihr Lebensraum durch die Schaffung von Weideflächen erweitert wurde, wobei der Ñandú mit den Rinderherden gut zusammenlebt.
Weitgegend verdrängt dagegen sind Säugetiere, die ein größeres Waldgebiet beanspruchen um zu überleben und zudem von Menschen als Schädlinge oder zur Fleischversorgung verfolgt wurden. Zu diesen gehören besonders Jaguar, Puma, Pekari, Riesengürteltier, Ozelot etc., die heute nur noch am äußeren Rand oder außerhalb der Kolonien anzutreffen sind. Der Spießhirsch und der Fuchs haben es in dieser Hinsicht leichter, da sie sich besser an die Veränderungen in der Natur anpassen. Besonders begünstigt ist der Fuchs, der eher als ein Kulturfolger einzustufen ist und kaum noch natürliche Feinde hat. Außerdem findet er auf den Weiden reichlich Nagetiere für seine Ernährung.
Im oberen
Chaco gibt es mehr als 300 Vogelarten, von denen aber nur 25 Arten endemisch sind, d.h. nur im
Chaco vorkommen. Andererseits gibt es etwa 60 Wandervogelarten, die zu gewissen Jahreszeiten hier leben. Da Vögel im
Chaco keine natürlichen Barrieren (z. B. Gebirgsketten) haben, könnten sie sich theoretisch über den ganzen
Chaco verbreiten, was aber nicht der Fall ist, da sie meist an ein bestimmtes Ökosystem als Lebensraum gebunden sind. Dem entsprechend reagieren sie auch empfindlich auf Veränderungen in ihrem natürlichen Lebensraum. Der Eingriff des Menschen in die Natur kann leicht dazu führen, dass Vogelarten aus einem Gebiet verschwinden, aussterben oder dass sich auch neue Arten ansiedeln. Beispielsweise zu erwähnen wären der Uhu oder Ñacurutú
(Buho virginianus), der im zentralen
Chaco relativ selten geworden ist, und die Moschusente
(Caraina moschuata), die stille, von Wald umgebene Gewässer bevorzugt und sich heute weitgehend aus dem Gebiet der Kolonien zurückgezogen hat. Sicher hat die Jagd auf diese Entenart auch dazu beigetragen, dass sie immer weniger vorkommt. Ein anderer im Koloniegebiet selten gewordener Vogel ist der Königsgeier
(Sarcoramphus papa), der aber in fast menschenleeren Gegenden des
Chaco, wie der Zone am Pilcomayofluss oder im Nationalpark Defensores del
Chaco, noch öfter anzutreffen ist. Überhaupt gelten Vögel allgemein als hervorragende Anzeiger für Veränderungen in der Natur. Das Vorhandensein oder Verschwinden von Vogelarten in einem Gebiet gibt Aufschluss über Wandelprozesse in unserer Umwelt, die oft langsam und für uns kaum wahrnehmbar stattfinden.
Der Kuhreiher
(Ardeola ibis) ist heute praktisch bei jeder Rinderherde auf der Weide anzutreffen und wir können sagen, dass er schon fester Bestandteil der
Viehzucht im
Chaco geworden ist. In Wirklichkeit ist der Kuhreiher kein einheimischer Vogel, sondern stammt ursprünglich aus Afrika, wo er den Großwildherden folgt und die von den weidenden Tieren aufgescheuchten Insekten jagt. Von dort wanderte er vor etwa 60 bis 70 Jahren nach Südamerika. Im zentralen
Chaco Paraguays tauchte er vor ca. 25 bis 30 Jahren erstmals in größeren Gruppen auf. Die Frage ist nur, wieso diese Reiherart sich in Südamerika ansiedelt. Unser Klima ist dem von Afrika recht ähnlich, und als erst die Rodungen immer größer wurden, entwickelte sich eine Landschaftsform, die mit den Savannen Afrikas vergleichbar ist. Als Ersatz für die Großwildherden dienen die Rinderherden und damit sind die Bedingungen geschaffen, dass auch der Kuhreiher hier einen Lebensraum vorfindet, der weit genug an seine Anforderungen angepasst ist. Das Auftreten des Kuhreihers im
Chaco verläuft ziemlich parallel mit dem Aufschwung der Viehwirtschaft in den
Mennonitenkolonien während der siebziger Jahre.
Ein weiteres Phänomen, das besonders im östlichen Teil der Chacokolonien in Erscheinung tritt, ist die Versalzung der Lagunen und Böden. Dieses Gebiet befindet sich ohnehin schon in der Übergangszone zwischen oberem und niederem
Chaco, wo die Salzschichten entweder in geringer Bodentiefe liegen oder ganz an die Oberfläche treten. Das Wetterphänomen „El Niño" hat einen starken Einfluss auf das Wetter im
Chaco. Dieses trat deutlich in den niederschlagsreichen Jahren 1983, 1992 und 1997 in Erscheinung. An dieser Stelle sind besonders die Jahre 1983/84 zu erwähnen, wo die Regenmengen weit über dem Durchschnitt lagen. Hier wirkten verschiedene Umstände wie abgedämmte Lagunen, viel Regen, kahle Böden in salzgefährdeten Gegenden etc. zusammen, wodurch dann ein großer Teil der Lagunen im östlichen Koloniegebiet, entlang des Riacho Yacaré Sur, versalzte. Obwohl es schon immer
Salzlagunen gegeben hatte, erweiterte sich die Fläche derselben beträchtlich im Zeitraum von ein paar Jahren. Damit war aber andererseits auch der Lebensraum für eine neue Vogelart geschaffen, den Flamingo
(Phoenicopterus chilensis). Diese Zugvögel stammen aus Chile und ich habe sie im
Chaco erstmals im September 1990 gesehen. Anfänglich machten die Flamingos im zentralen
Chaco nur einen Halt von drei Monaten im Jahr auf ihrer Reise, heute jedoch scheint eine größere Population das ganze Jahr hindurch die östlichen
Salzlagunen zu bewohnen. Auch der Coscoroba-Schwan
(Coscoroba coscoroba) ist durch die Versalzung der Lagunen begünstigt worden und daher gegenwärtig häufiger anzutreffen als noch vor 20 Jahren.
An Hand von diesen Beispielen erkennen wir, dass die Entwicklung der
Mennonitenkolonien einen beachtlichen Einfluss auf die Umwelt ausgeübt hat. Probleme wie Versalzung, Winderosion, Abfallentsorgung, Wassermangel, Staubbelastung usw. werden spürbarer, aber erfreulicherweise wächst auch das Umweltbewusstsein und man ist bestrebt, Wege zur Minderung der negativen Auswirkungen zu finden. Die positiven Folgen sollen nicht unbeachtet bleiben, denn der zentrale
Chaco ernährt heute viele tausend Personen und die angelegten Wasserreserven (Tajamares und Zisternen) kommen sowohl den Menschen, wie auch den Rindern und Wildtieren zu Gute.
6. Entwicklung des Umweltschutzes in den Chacokolonien (siehe dazu die Karte mit den Naturschutzgebieten)
Wie in jeder Volksgruppe hat es unter den Mennoniten im zentralen
Chaco von Anfang an Naturliebhaber gegeben, die ein Interesse an der Naturbeobachtung und dem
Naturschutz zeigten. Anfänglich waren es wohl nur einzelne Personen, aber deren gute Spuren sind bis in die Gegenwart klar sichtbar. Als die Wirtschaft im raschen Tempo voranzuschreiten begann, mehrten sich auch die Stimmen die ihre Bedenken diesbezüglich äußerten. Die ersten, die für den
Naturschutz eintraten, kamen aus den Reihen der Lehrer und mit einigen anderen Naturfreunden zusammen bildeten sich die ersten Naturschutzvereine. Der damalige Naturschutzverein in
Menno hat in den sechziger Jahren das paraguayische Jagdgesetz (Código rural N° 1248) ins Deutsche übersetzt, damit möglichst alle Bewohner der Chacokolonien Zugang zu dieser Information hatten. In diesem Gesetz wurde genau festgelegt, wann die Jagdzeit war, welche Tiere gejagt und welche nicht gejagt werden durften, wieviele Tiere von den zur Jagd freigegebenen Arten man schießen durfte, welche Jagdmethoden verboten waren etc. Unter ökologischen Gesichtspunkten betrachtet, war das Gesetz sehr gut ausgearbeitet und ein jeder hatte die Möglichkeit im gesetzlichen Rahmen zu jagen.
Nach 1975 legte man die ersten Schutzgebiete in den Kolonien fest und heute hat jede der drei Chacokolonien ihre eigenen Naturschutzgebiete, deren Handhabung, wenn auch nicht gesetzlich festgelegt, so doch durch interne Vorschriften wirksam geregelt ist. Als Beispiele erwähne ich hier einige Naturschutzgebiete die mehr als 2000 ha Fläche umfassen: Campo Maria (
Menno), Corralón (
Fernheim) und Selva Serena (
Neuland), obwohl es noch mehr kolonieeigene Schutzgebiete gibt, so dass ihre Gesamtfläche nahe bei 40.000 ha liegt. Außerdem sind schon manche private Naturparks oder vielleicht eher naturnahe Parks entstanden, was auf ein zunehmendes Interesse an der Chaconatur hinweist. Hinzu kommt, dass jede
Kolonie eine für den
Naturschutz zuständige Abteilung unterhält und auch über die Beratungsdienste immer größeres Gewicht auf die Verbreitung von nachhaltigen Wirtschaftsmethoden legt.
Weiter kann man feststellen, dass die Lerninhalte in den Schulen zu Themen wie Umwelt,
Naturschutz, umweltschonende Entwicklung, Abfallbeseitigung u.a.m. heutigen Tages mehr betont und auch gründlicher durchgearbeitet werden. Besonders bei den jüngeren Generationen ist ein Umweltbewusstsein vorhanden, das sich mit dem von Jugendlichen in Europa oder Nordamerika durchaus vergleichen lässt. Andererseits ist auch bei den Bauern das Bewusstsein vorhanden dass es notwendig ist, bodenschonend und umweltfreundlich zu produzieren, was zudem von den Beratungsdiensten der Kolonien gezielt gefördert wird. Der Zwiespalt zwischen schnellem Reichtum und nachhaltiger Entwicklung wird aber auch in den
Mennonitenkolonien des zentralen
Chaco bis zu einem gewissen Grad bestehen bleiben.
Seit 1995 besteht die „Fundación para el Desarrollo Sustentable del
Chaco", eine Organisation, die sich mit
Naturschutz und nachhaltiger Entwicklung befasst und die unter Mitwirkung von Mennoniten (ehemaliger Abgeordneter Heinz Ratzlaff sowie David Sawatzky, Peter Dürksen, Eduard Klassen, Jacob Harder, Heinrich Dyck u.a.m.) aus dem zentralen
Chaco ins Leben gerufen wurde. Diese Organisation unterhält internationale Beziehungen und ihr Wirkungskreis bezieht sich auf den
Gran Chaco, was auch den argentinischen, bolivianischen und brasilianischen
Chaco mit einschließt. Weiter sucht die „DeSdel
Chaco" auch Arbeiten im Gebiet der
Mennonitenkolonien durchzuführen. Besonders im Gebiet des Riacho Yacaré Sur sind verschiedene Studien gemacht worden und heute gibt es eine Interessengruppe unter den Bewohnern, die nach neuen Nutzungsmöglichkeiten (z. B. Tourismus) der
Salzlagunen sucht. Weiter erwähne ich Laguna Salada, ein Feuchtgebiet im
Chaco, dass demnächst von der UNESCO als „Ramsar-Gebiet" anerkannt werden soll. Laguna Salada, ein 2500 ha großes Schutzgebiet, wäre damit das erste international anerkannte Feuchtgebiet im
Chaco. Der Eigentümer von Laguna Salada, Herr Peter Dürksen (
Fernheim), ist Mitglied der genannten Organisation und ein geschätzter Mitarbeiter in Sachen
Naturschutz.
7. Nachhaltige Entwicklung: Ansichten über die Zukunft- Auf Dauer sollten wir eine gezielte Dezentralisierung in der Besiedlung des Chaco anstreben, denn irgendwann laufen wir Gefahr den zentralen Chaco zu ersticken. Es ist zudem nicht gut, wenn Menschengruppen aus ihrem ursprünglichen Gebiet abwandern, weil sie dort keine Existenzmöglichkeit haben. Die Siedlungspolitik sollte darin bestehen, die Hilfe zu den Bewohnern zu bringen und nicht zu warten bis Menschen in den zentralen Chaco kommen um Hilfe zu suchen.
- Um die Wasserversorgung im zentralen Chaco langfristig zu sichern, muss ein zusätzliches System eingerichtet werden (z.B. Aquädukt). Dieses Versorgungssystem ist nicht als Ersatz für die schon bestehende Wasserversorgung durch Zisternen und „Tajamares" (künstlich angelegte Teiche), sondern als Ergänzung derselben zu sehen. Die Wasserernte (Sammeln von Regenwasser) gewinnt heute weltweit an Bedeutung und auf diesem Gebiet haben wir Chacobewohner viel Erfahrung, die wir an andere weitergeben können.
- Wir werden mehr in Betracht ziehen müssen, dass Umweltschutz, die Entwicklung neuer Technologien sowie die Differenzierung in der Produktion auch Geld kostet. Wenn wir neue Produktionsalternativen und Einnahmequellen entwickeln wollen, was für die Zukunft notwendig sein wird, ist es erforderlich, schon jetzt mehr in die Forschung zu investieren. Vor allen Dingen brauchen wir mehr Kenntnisse über Boden, Klima, Umwelt, Wasser, Natur etc. damit diese Faktoren als Teil der wirtschaftlichen Entwicklung berücksichtigt werden können.
- Wie hoch ist die „Ladekapazität" des Chaco oder wieviele Einwohner können hier pro Quadratkilometer leben und wieviel Land braucht eine Familie, um den Lebensunterhalt zu sichern? Wir haben weder einen Fluss, der unsere Abwässer wegspült, noch einen großen See, der uns mit Wasser versorgt, und die Produktionsmöglichkeiten sind auch begrenzt. Die Siedlungspolitik sollte dieses unbedingt beachten, denn bei den besonderen Eigenschaften des Chaco kann auch nur eine entsprechende Bevölkerungsdichte gelten, damit das Land nicht „überladen" wird.
- Nur wenn wir die Umwelt als Bestandteil unserer Wirtschaft miteinbeziehen, werden wir eine nachhaltige Entwicklung erreichen. Entwicklung ist mehr als wirtschaftliches Wachstum und G. Altner schreibt dazu Folgendes: „Der christlich-biblische Schöpfungsauftrag des „dominium terrae" kann nicht mit seinem neuzeitlichen Endresultat – nutzt alles Nutzbare – gleichgesetzt werden. Dieser Säkularisierungsprozess muss gleichsam als Ungehorsamsgeschichte gegenüber dem Schöpfungsauftrag gesehen werden, der ebenso ein Solidaritätsauftrag gegenüber der Mitkreatur ist".
- Als gute Mennoniten sollten wir ruhig einmal 3. Mose, Kapitel 25 lesen und darüber nachdenken oder die Worte von Paulus in 1. Timotheus 6, 8: „So ihr Nahrung und Kleidung habt, lasst es euch genügen…" beachten. Eine gesunde Entwicklung ist eng mit Zufriedenheit und Dankbarkeit dem Schöpfer gegenüber verbunden.
Bibliographie
- Grzimeks Tierleben, Band 7. dtv, 1975.
- Kanadische Mennoniten bezwingen eine Wildnis. Martin W. Friesen, 1977.
- Statut vom Menno Umwelt Komitee. 1998.
- Código Rural N° 1248. (Übersetzung 1967).
- Iniciativas Transfronterizas de Conservación en el Chaco Paraguayo. Victor Vera y otros, 2000.
- Documento Base sobre el Sector Pecuario y su impacto ambiental. ENAPRENA, 1995.
- Documento Base sobre el Sector Agrícola y su impacto ambiental. ENAPRENA, 1995.
- Außer der Bibliographie habe ich eigene Beobachtungen und Inhalte aus Gesprächen mit anderen Personen in den Aufsatz eingebaut.
- Dank an die Herren David F. Sawatzky und Levi F. Hiebert für die kritische Durchsicht dieses Aufsatzes.
Fussnoten:
| Geschäftsführer der „Fundación para el Desarrollo Sustentable del Chaco" |
| VERA, u.a., 2000 |
| GRAGSON, 1998 |
| SINASIP, 1995 |
Landnutzung in den mennonitischen Kolonien im Chaco unter dem Blickwinkel der Forst- und Umweltgesetze in Paraguay
Rosali Goerzen
Einführung:
Die Produzenten der mennonitischen Kolonien im zentralen
Chaco befinden sich zur Zeit in einem Anpassungsprozess, in dem die gut bewährten Produktionstechniken mit den Forderungen der in
Paraguay gültigen Forst- und Umweltgesetze abgestimmt werden. Diesem Prozess haftet zum Teil etwas Zwanghaftes an, da die Forderungen in Gesetzesform festgelegt sind. Der Prozess wird auch als „von außen auferlegt" empfunden, weil die Gesetze ohne Mitwirkung der
Chaco-Mennoniten formuliert wurden. Die Gesetze sollten das Bewusstsein für den
Umweltschutz landesweit fördern und auch konkrete Vorbeugungsmaßnahmen für nicht rückgängig zu machende Umweltschäden festlegen. Die Formalisierung der Gesetze führt die Investitionsprojekte in
Paraguay durch verschiedene administrative Phasen, die von den arbeitseifrigen und schaffensfreudigen Mennoniten als „Bremsstufen" aufgefasst werden. Projekte, die das Landschaftsbild verändern und die Bodenoberfläche antasten, und Wegebauprojekte sind am stärksten davon betroffen. Mit weniger Problemen haben die „Urbanisierungsprojekte" zu rechnen, denn in
Paraguay wird weiterhin nach Finanzbedarf der Landbesitzer durch Aufteilung Land parzelliert und besiedelt. So kann z.B. eine Fabrik außerhalb der Stadt in kurzer Zeit, je nach Urbanisierungsdynamik, ein neues Stadtzentrum bilden. Das wichtigste und grundlegendste Gesetz zur Umweltgestaltung und Reglementierung der Landnutzung wurde nämlich nicht genehmigt, das Raumordnungsgesetz (Ordenamiento territorial). Trotzdem wird weiter investiert und gearbeitet, besonders in den mennonitischen Kolonien im
Chaco.
Mit viel Idealismus fordern die staatlichen Forst- und Umweltsekretariate heute umweltschonende Maßnahmen bei jedem Investitions- bzw. Rodungsprojekt. Die Reaktionen der
Chaco-Mennoniten auf diese Forderungen sind sehr verschieden.
Dem wirtschaftlichen Erfolg der mennonitischen Kolonien werden heute oftmals die „Umweltschäden" gegenüber gestellt. Dies geschieht nicht unbedingt öffentlich, aber es wird hin und wieder in Austauschseminaren und Treffpunkten mit staatlichen und privaten Teilnehmern erwähnt und in verschiedenen Berichten auch zu Papier gebracht. In der staatlichen Forstabteilung und im Umweltsekretariat wird behauptet, dass das Modell der mennonitischen Produzenten durch Erweiterung der Weideflächen mit Rodungen des Busches nicht unbegrenzt weitergeführt werden kann. Die Tüchtigkeit, der Fleiß und das Erfolgsdenken der Produzenten wird als zu aggressiv für die fragile Chacoumwelt angesehen.
Andererseits wird die Umsetzung der
chaco-angepassten Bauernschlauheit bewundert, die eine Wasserwirtschaft für Mensch und Tier aufgebaut hat und einen wirtschaftlichen Produktionszyklus aufrecht erhält, der jetzt schon mehr als 70 Jahre anhält.
Die folgenden Ausführungen werden aufzeigen, dass die Mennoniten schon vor der Zeit der Inkraftsetzung der Forst- und Umweltgesetze mit Problemen in diesem Bereich zu tun hatten, und dass sie damit aus eigener Kraft nicht fertig wurden.
A. Die Satellitenbilder – stumme Zeugnisse der 70-jährigen Landnutzung
Das Satellitenbild der mennonitischen Siedlungen im zentralen
Chaco Paraguays zeigt einen großen, hellen Flecken, der sich mit unregelmäßigen Grenzen deutlich vom restlichen Chacobusch abgrenzt.
Dazu folgende Karten:
Satellitenbild des
Gran Chaco von 1993
Luftaufnahme eines Teiles der Kol.
Fernheim von 1968
Die neueren Aufnahmen von 1997, 1999 und 2002 zeigen eine Erweiterung dieses Fleckens. Dieses Bildmaterial zeigt unverblümt die Früchte der mennonitischen Arbeitsamkeit im Laufe der Jahre.
Welche Geschichte beinhaltet bzw. erzählt der große Flecken? Anhand eines zeitlichen Ablaufes soll in den nächsten Seiten eine Sammlung von Daten aneinander gereiht werden, die größtenteils aus der
Kolonie Fernheim stammen und keineswegs alle Einzelheiten zum Thema abdecken werden. Einblicke zum Thema Landnutzung geben die Daten aus Berichten des Mennoblatts, von Informationsblättern, Protokollen, Gesetzen und öffentliche Berichten.
a. Die Landnutzung im Existenzkampf bis zur Konsolidierung der Kolonie (1930 – 1972)
Die
Bildung dieses Fleckens begann beim offenen
Bittergras-Kampland, welches als erstes Nutzungsland für die Siedler eingeteilt wurde. Die Dörfer wurden nach dem Vorbild in Russland zweireihig angelegt. Die Hofstellen wurden durch Los auf die Familien verteilt. Jeder Hof hatte je nach Größe des Kampes ca. 5 ha Ackerland. Das Buschland hielt man vorerst für unbrauchbar. Man lebte in Zelten und übte den Umgang mit wilden Ochsen und wilden Kühen, die man von Casado übernommen hatte. Es herrschte Mangel an Lebensmitteln. Die Kühe gaben die Milch nur nach dem Ansaugen der Kälber ab. Mit einer Tagesproduktion von 1 bis 1,5 lt Milch pro Tag musste eine
Familie sich glücklich schätzen.
Brunnen mussten gegraben werden, um Trinkwasser für Mensch und Vieh zu haben. Die großen und kleinen Bäume und Sträucher wurden mit Handgeräten beseitigt. Der Boden musste traditionsgemäß „pflugrein" gemacht werden. Dörferlandschaften entstanden mit baumfreien Straßen, Höfen, Gärten und Feldern. Den Arbeitseifer kennzeichnete das Motto: „Wir müssen uns den Verhältnissen anpassen und mit den vorhandenen Kulturen vorwärts kommen" (P. Klassen, 50 Jahre
Fernheim). Man sammelte also eigene Grunderfahrungen mit Baumwolle, Erdnüssen, Bohnen, Mandioka, Süßkartoffeln, Mais und Wassermelonen, beobachtete das Chacoklima und die fremde
Chaco-Pflanzenwelt. Aus Dankbarkeit für die Errettung aus Russland „akzeptierte" man die Chacoumwelt mit allen ihren Widerwärtigkeiten. Man wohnte in einem Lande des Friedens, wo man seines Glaubens leben konnte.
1931 wurde im Zentrum der
Kolonie mit dem Bau des Industriewerkes begonnen. Hier wurden folgende Dienstleistungen angeboten: Bauholz sägen mit einer primitiven Kreissäge, später mit einer Gattersäge, Ölpressen der Erdnüsse und Kafir mahlen. Man nutzte die Hölzer der
Chaco-Baumarten wie Paloblanco, Paratodo, Urundey, gelben und roten Quebracho, Algarrobo, Tintbaum. Das gesägte Holz wurde in Form von Brettern, Latten und Balken für den
Brunnen-, Haus-, Möbel- und Wagenbau eingesetzt. Die Kooperative funktionierte als ein Handelskomitee mit einem Konsumladen. Dieses Komitee übernahm die Koordinierung der Heranschaffung der notwendigen Lebensmittel und verwaltete auch das wichtige Kapital der Bauern: Arbeitszeit im gemeinschaftlichen Einsatz zum Aufbau der Kooperative und anderer gemeinschaftlicher Einrichtungen. Anfänglich ging es um das Heranholen der Produkte und Waren von der Endstation, später auch um den Bau von Krankenhaus,
Industriewerk, Kooperative. In den Dörfern wurden in Gemeinschaftsarbeit Zäune gezogen, Straßen gereinigt, Schulhäuser gebaut,
Brunnen gegraben und Vieh gehütet. Für den Betrieb der Dampfmaschine wurde das Holz von den Bauern aufgekauft.
1933 und 1934 waren die Regenmengen gut, und die Baumwollerträge ließen Hoffnungen auf bessere Zeiten keimen. 200 Pferde wurden zur Erleichterung der Bewirtschaftung des Landes gekauft.
Der Fleiß und die Arbeitsbereitschaft der Mennoniten-Siedler wurde 1934 vom Ministerio de Economía in
Paraguay beschrieben: „…Hütten im Herzen des
Chaco …; …man sieht sie, Hand am Pfluge Furchen ziehend als Sendboten des Fortschritts fruchtbare Erde für die Wirtschaft des Landes erschließen. Edle Früchte sprießen aus ihren Äckern!"
„Diese Pioniere hatten nicht viel Sinn für die Natur und ihre Schönheit. Man hat eher den Eindruck, dass sie einen Feind bekämpften und erst zufrieden waren, wenn der letzte Baum gefallen war und an seiner Stelle Kulturpflanzen, wenn auch oft kümmerlich, in Reih und Glied standen"
(2). „In manchen Dörfern gab es den Beschluss, in Gärten und auf den Straßen auch die vereinzelt stehen gebliebenen prachtvollen Urundey- und Quebrachobäume zu fällen, weil sie ein beliebter Sammelplatz für die schädlichen Papageien und Stärlinge sind. Der erzielte Gewinn scheint jedoch in keinem Verhältnis zu dem Verlust zu stehen. Auffallend ist die ausserordentliche wirtschaftliche Tatkraft der Kolonisten mit einer stumpfen Gleichgültigkeit gegen landschaftliche Schönheit"
(3). „Die Siedler empfanden die Natur als bedrohender Feind und oft ging man radikal gegen die Vegetation vor"
(4).
1937 übernahm die Kooperative die Landtitel vom
MCC und die heutigen Friesländer siedelten nach Ostparaguay um. Die Hofgrößen wurden von 40 auf 100 ha erweitert. „In einzelnen Dörfern lagen 1937 schon große Dünen, die die Straßen sperrten, Obstbaumpflanzungen und Zäune bis zur halben Höhe verschüttet und sich vor den Häusern gestaut hatten".
(5)
Zwischen 1938 und 1944 wurde die Molkerei eingerichtet, das Palosantogeschäft wurde in Gang gesetzt, eine Geschäftsfiliale in Mcal. Estigarribia gegründet und die
Viehstation auf Laguna Porá übernommen. 1940 wurde eine größere Dampfmaschine und ein Dynamo in Betrieb gesetzt.
1944 wurden das Dorf Landskrone und 1946 die Dörfer Hohenau und Blumental südlich von
Filadelfia auf größeren Kämpen gegründet. Von 1945 bis 1949 wurde eine Entkernungsanlage für Baumwolle in Betrieb gesetzt. 1947 wurden die ersten langfristigen
Kredite von der paraguayischen Staatsbank gewährt. Als Garantie standen die schon erworbenen Ländereien und der Viehbestand.
Bis hierher war die Landnutzung mit ihren Eingriffen in die Natur auf die Bittergraskämpe beschränkt geblieben. Diese Sandkämpe dienten als erste Ackerflächen, weil nur das
Bittergras entfernt werden musste, um zu pflügen und Saat einzustreuen. Mit dem Beginn der Mechanisierung in der Landwirtschaft erweiterte sich die Landnutzung auf die schluff- und tonhaltigen Buschböden des sogenannten Buschlandes.
1947 wurde die Versuchsstation in Zusammenarbeit mit dem
MCC gegründet. Sie sollte Mittel und Wege finden, um die vielen Produktionsprobleme der Siedler zu lösen. Sie wurde auf Kampland aufgebaut. Ziel für die Zukunft blieb die Bepflanzung des Buschlandes mit Weidegräsern. Die ersten Versuche mit Pflanzenschutzmitteln gegen Ameisen und Heuschrecken wurden hier durchgeführt. Die Gründung dieser Station dürfte der Anfang einer planmäßig organisierten Beratung auf dem Land- und Viehwirtschaftssektor gewesen sein, obzwar sie anfänglich bei vielen Bauern nur ein freundliches Lächeln hervorrief.
1949 war „das Windtreiben und die Kraftlosigkeit des Bodens" für
Menno Klassen (Versuchsstation) schon ein Beratungsthema. Er beschrieb damit ein Grundproblem der Kampböden. 1952 wurden Versuche mit Maschinen im Erdnussanbau durchgeführt, wodurch diese
Kultur an Fläche zunahm.
1953 kam der Bulldozer von Harry Harder USA, im
Chaco zum Einsatz. Gleich im nächsten Jahr traf mit Vern Buller der zweite Bulldozer ein. Beide Bulldozer wurden hauptsächlich im
Wegebau eingesetzt. Diese Bulldozer zeigten, wie man den Chacobusch „besiegen" konnte und ließen neue Hoffnung aufkommen.
1955 wurde das 25-jährige
Jubiläum gefeiert und die Landesregierung erkannte, dass die
Kolonie die Wüste des
Chaco in einen Garten verwandelt hatte.
Das 1956 eingeführte Büffelgras verwandelte den gerodeten, lehmigen Buschboden in Weideflächen für die Rinder. Somit wurde der
Chaco-Garten erheblich vergrößert.
Im Mai 1956 liest man im
Mennoblatt von Lehrer Heinrich Ratzlaff, der aus Gesprächen mit den Bauern den Bedarf an größeren Flächen betonte: „Uns stört der Busch, wir müssen Raum schaffen. Wir brauchen Maschinen, um bei dem ersten Frühlingsregen recht viel in die Erde bringen zu können, nicht 10, sondern 50, ja 100 ha müssen wir beackern. Wir brauchen neue Kulturen, …wir brauchen Dauerpflanzungen. Wir brauchen neue Gräser für unser Vieh usw. usw".
Im Dezember 1956 meldete sich im
Mennoblatt die vorausschauende Stimme von E. Oehring (Versuchsstation) zum Windschutz für die Felder. „Man beabsichtigt ja, mit den neugekauften Maschinen die Anbauflächen zu vergrößern. Dabei wird das Problem auftauchen, dass man diese größeren Flächen durch Windschutzstreifen gegen die Nord- und Südstürme schützen muss, um die Gewalt dieser Stürme zu brechen. …Die Schutzstreifen müssen von Ost nach West angelegt werden".
Der Wert des Buschbodens wurde durch das Weidepotenzial des Büffelgrases erkannt. So wurde der Buschboden für die Dorfsiedler 1960 vermessen und zugeteilt. Dann begannen die ersten mechanisierten und großflächigen Rodungen des Chacobusches. Weideflächen mit Büffelgras wurden angelegt, der Futteranbau mit Sorghum wurde erweitert, die Weiden wurden eingezäunt. Das Büffelgras (Cenchrus ciliaris L.) wurde aufgrund seiner Trocken- und Frostresistenz die wichtigste Kulturpflanze, und breitete sich wie ein Flächenbrand aus.
Kredite förderten die ersehnte Erweiterung der Produktionsfläche und die Mechanisierung der Produktion.
So erlebten die kleinen Siedlungspunkte der ersten Jahre eine flächendeckende Ausbreitung auch außerhalb der zum Teil offenen Sandkämpe. Die
Bildung und Gestaltung des großen Fleckens hatte angefangen.
1961 war die
Ruta Transchaco als Schönwetterstraße bis
Filadelfia fertig. Milchprodukte und Eier wurden auf den Markt in
Asunción gebracht.
Dem Bau der
Ruta Transchaco war eine wirtschaftlich-soziale Studie von amerikanischen Fachleuten vorausgegangen, die das Produktionspotenzial des paraguayischen
Chaco hervorhob und die Bedeutung der Straße betonte. Die Studie machte die umstrittene Feststellung, dass die mennonitischen Siedlungen im fruchtbarsten Teil des zentralen
Chaco liegen. Diese Feststellung betrifft ganz bestimmt den Regosol-Kampboden, welcher von den Mennoniten bis dahin für die Siedlungsplätze der Dörfer und für den Ackerbau benutzt wurde. Diese Bodenart ist einmalig im zentralen, paraguayischen
Chaco zu finden, wie es die Bodenkarte vom MAG-BGR, vom Dez 1999 zeigt. Es war jedoch nicht der besondere Mennoniten-Spürsinn, der diesen Boden als potenzielles Siedlungsland definierte, sondern Fred Engen und die Tobaindianer im Mai/Juni 1920 bei der Begegnung mit den Lengua-Indianern. Es war jene Aktion, die im Telegramm zusammengefasst wurde: „Ich habe das verheißene Land gefunden". Ein Jahr später wurde die Aussage von den Delegierten der kanadischen Mennoniten bestätigt. Es schien ein Gebiet zu sein, in dem es möglich sein würde, im Zeichen des Friedens auch die Entwicklung eines materiellen Wohlstandes zu erreichen.
Der Erdnussanbau stieg seit 1960 auf über 1.000 ha. Durch die Mechanisierung und die kostengünstige Ernte wurde immer mehr in diesen Sektor investiert. Drei neue Dörfer wurden gegründet: Neuwiese im Westen, Valencia und Molino im Süden. Die eifrigen Bauern hatten jedoch bald Probleme mit der Monokultur im Erdnussanbau, und die Auswirkungen der Winderosion kam ins Gerede.
1967 wurde in der Landesverfassung festgelegt, dass der Staat die Naturressourcen schützen und die Grundlagen für die Nutzungsordnungen gesetzlich regeln werde.
1968 fotografierten die Amerikaner den
Chaco mit schwarz-weiß Fotos. Die Fotos zeigen die gradlinig eingezäunten Felder in den Dörfern auf Kampboden, meistens ohne jeglichen Schonstreifen. Paraíso-Bäume wurden zu jener Zeit an den Dorfstraßen gepflanzt, aber nicht als Windschutz für die Felder. Große Obstgärten wurden hinter den Wohnhäusern und vor dem ersten Feld gepflegt. Zwischen den Kämpen und Dörfern sieht man den Busch. Die Vermessungsschneisen von 1960 durchziehen den Busch. Die „3 Jeep breiten" Wege aus Vern Bullers Zeit sind klar zu erkennen.
Im August des Jahres 1968 schickte Agr. Robert Unruh einen Artikel ans
Mennoblatt mit dem Vermerk, dass dieser in mancher Hinsicht zutreffend für die Chacosituation sei. (In der schweren Dürrezeit 1967 gingen Rinder aus Weide- und Wassermangel ein oder mussten notverkauft werden.) Er glaubte, „…dass es auch bei uns an einer Revolution der Landwirtschaft fehlt, besonders bei der
Viehzucht und ihrer Pflege". Der Beitrag aus der „Freien Presse" beschreibt die jahrzehntelange Holzausbeute der wertvollen Arten des La Pampa-Territoriums in Argentinien. „Alles übrige wurde an Ort und Stelle verbrannt. Die Gegend verwandelte sich in eine Wüste, weil niemand sich die Mühe nahm, neue Bäume zu pflanzen. Landwirte zogen aus. Westwinde trieben die ausgetrocknete Humusschicht in das nahe Meer. Um dieses zu ändern, sind ein neues Verantwortungsgefühl und eine neue Einsicht begleitet mit Krediten notwendig…". Der Artikel sollte Gedanken anregen. Es folgten dann im
Mennoblatt später zwei Artikel zu diesem Gedankenanstoß.
Im November 1968 schrieb J. Ekkert bedenklich und vorausschauend über Buschroden im
Mennoblatt Nr. 21:
„Die versandeten und verbrannten Böden, die ein Spielball des Windes geworden sind, drohen auch uns, wenn nicht rechtzeitig eine entsprechende Planung einsetzt… Und andererseits ist es notwendig, in den schon bestehenden Rodungen und unter
Kultur genommenen Feldern Vorkehrungen zu treffen, um das Land gegen Sonne und Wind zu schützen….Planloses, rücksichtsloses Roden der bestehenden Wälder und ständiges Säen und Ernten, ohne jemals dem Boden etwas wiederzugeben, das heißt Raubbau und führt zu Erosion des Bodens durch Sonne und Wind … Mancher mag denken, dass meine Befürchtungen voreilig sind; der Chacobusch ist so groß, da können wir noch ohne Bedenken drauflos walzen. Noch ist viel Busch, das stimmt. Aber zeitige Planung ist viel leichter durchzuführen als dann, wenn die Situation zu schnellem Handeln drängt.Verdorbenes ist in diesem Falle kaum gut zu machen. Sachkundige können uns sagen, wieviel Prozent Buschland stehen bleiben muss, um in den klimatischen Erscheinungen negative Störungen vorzubeugen….Eine wirkungsvolle Neuaufforstung scheint mir vorläufig unmöglich … Es ist daher ein viel kürzerer Weg zum Ziel, wenn wir von Anfang an bei Buschrodungen für Weideland die meisten Bäume stehen lassen….in
Menno wurde die Feststellung gemacht, dass die Kühe mehr Milch geben, wenn sie auf Weide mit vielen Bäumen stehen, im Gegensatz zu solcher Weide, wo keine Bäume stehen….Auch Fleischlieferung wird dann größer sein, wenn das Rind Schatten und Weide aneinander finden kann. Den ganzen Tag der Hitze ausgesetzt zu sein, kostet ungemein viel Energie…Bäume stehen lassen kostet mehr beim Roden… Das aber ist einmalig. Den Nutzen aber hat der Eigentümer des Landes zeitlebens. Es ist auch vorteilhafter, die Weidefläche der Länge nach in Ost-Westrichtung anzulegen und häufig Waldstreifen stehen zu lassen, die den Nordwind bremsen… Viel ist gewonnen, wenn wir das Land, das wir jährlich bebauen, so gut wie möglich gegen Sonnenbrand und Sturm verteidigen oder schützen. Gefährdet gegen Sonnenbrand sind besonders die abgeernteten Erdnussfelder, die von jedem Unkraut frei sind…Für Bermudagras haben wir Bestimmungen, dass der Besitzer dafür verantwortlich ist, dass des Nachbars Garten nicht mit seinem Nachwuchs verunreinigt wird. Für Treibsand wäre eine solche Bestimmung genau so berechtigt…"
Im Dezember 1968 schreibt Franz Wiens im Artikel „Unsere Felder":
„…Bezüglich des Waldrodens hatte mancher schon allerlei schwere Gedanken…Darum ist es an der Zeit aufzumerken, wohin wir mit unserer tollwütigen Roderei kommen und Vorsorge treffen…Wenn wir in Abständen von 500 m Baumreihen pflanzten, auch quer über unsere Felder, …scheint sehr notwendig zu sein. Zudem sind unsere bald 40 Jahre beackerten Kämpe vielerorts stark versandet. Auf diesen durch Raubbau ausgesaugten Feldern würde nur noch Sisal gedeihen, denn das vielbeschimpfte Malvakraut wächst ja noch ganz prächtig darauf, nutzt aber niemandem".
Unter der Spalte „Der landwirtschaftliche Berater" erschien im
Mennoblatt, Januar 1970, Nr. 2 der Artikel „Wasserprobleme im
Chaco" von Dieter Lamprecht. Unter Punkt 1.3 wird das Thema vom Windschutz ausgeführt.
„…In allen drei Kolonien ist in den vergangenen Jahren eine starke Zunahme der gerodeten Buschflächen zu verzeichnen. Dies wird nicht ohne nachteilige Folgen für die Land- und Wasserwirtschaft bleiben, wenn nicht Maßnahmen für einen Windschutz ergriffen werden. Durch den ungehinderten Windangriff kommt es zu erheblicher Austrocknung der obersten Bodenschicht und Erosionsschäden… Die Rodungen dürfen also in dem bisherigen Tempo nur dann weitergeführt werden, wenn gleichzeitig Maßnahmen für einen Windschutz ergriffen werden (Anpflanzen und/oder Stehenlassen von Buschstreifen als Windschutz)".
Das Problem mit dem Windschutz schien zu der Zeit ein Diskussionsthema zu sein. Die Umweltfaktoren Wind, Wasser, Busch, Boden waren ins Gerede gekommen.
Am 7. April 1971 wurde auf der Sitzung des Fernheimer Kolonierates in Punkt 3 über Buschstreifen bei der Rodung Folgendes im Protokoll vermerkt: „Um die Pflanzungen und die Viehweiden mehr gegen die Sandstürme und eventuell auch gegen Feuergefahr zu schützen, einigt der Kolonierat sich, in Zukunft beim Buschroden auf jede 400 – 500 m einen Buschstreifen von 30 m Breite und zwar in Ost-West-Richtung als Windschutz stehen zu lassen. Der
Oberschulze hat diesbezüglich auch die Verbindung mit den beiden Nachbarkolonien aufgenommen, ob wir darin einheitlich vorgehen könnten und wollten". Die Rundschrift an die Dorfschulzen erging am 13. April 1971.
Wurde diese Verordnung von den Bürgern eingehalten? Ein Jahr später, am 4. April 1972 wurde auf der Sitzung des Kolonierates in Punkt 11 vermerkt: „Diese Verordnung wird beim Buschroden nicht eingehalten, was aber unbedingt erforderlich ist… Man glaubt, dass die Bulldozerbesitzer bzw. die -arbeiter dafür verantwortlich gemacht werden sollten und nur unter dieser Voraussetzung Busch roden. Der
Oberschulze wird diesbezüglich mit den Bulldozerunternehmern sprechen". In einer Rundschrift in der
Kolonie: „…die Dorfschulzen gebeten werden, bei der Durchführung dieser Verordnung behilflich zu sein". Eine Rundschrift erging am 6. April 1972: „…wo dieser Beschluss nicht Beachtung findet, behalten wir uns das Recht vor, bewilligte Rodekredite zurückzuziehen, und das aus dem Grunde, weil es um eine sehr wichtige Schutzmaßnahme, die im allgemeinen Interesse liegt, geht". Die Aktivitäten im großen
Chaco-Garten sind nicht so leicht zu kontrollieren.
b) Die Landnutzung mit mechanisierter Produktionstechnik (1972 bis heute)
In den siebziger Jahren gab es Möglichkeiten für langfristige
Kredite, die durch den Banco Nacional de Fomento vermittelt wurden. Der einzelne Landwirt konnte seine Vieh- und Milchwirtschaft ausbauen und der Ackerbau wurde mechanisiert. Traktor und Kraftwagen verdrängten die Pferde. Kleinbetriebe mit wenig Land für Ackerbau hatten bessere Überlebenschancen durch die Kombination von Milch- und Fleischproduktion. Die Mechanisierung der Futterproduktion setzte ein. Viele Betriebe stellten auf Melkmaschinen um. Der BID-Kredit begleitete die Förderung der
Milchproduktion. Rodungen wurden mit Krediten finanziert.
Im
Mennoblatt 1973, Nr. 16 schrieb Andreas Sawatzky im Artikel: „Alarm – Buschrodung: geplant oder planlos?"
„…Zu schade, dass wir nicht schon früher mit planvoller Buschrodung begonnen haben. Die Verwaltung müsste Verordnungen zum planvollen Roden erteilen und selbst mit planmäßigen Beispielen vorangehen. …Solche nach allen Seiten ausgedehnten, ununterbrochenen Rodungen erweisen sich ungemein nachteilig in den Nordsturmzeiten…Das planvolle Roden wird sich lohnen. Wir müssen für die Zukunft überlegen… Durch planloses Vorgehen im Buschroden geben wir den Weg zur Bodenvernichtung frei".
1973 wurde in
Paraguay das Forstgesetz Nr. 422 erlassen. Dieses Gesetz wollte eine Hilfe für planmäßige Rodungsprozesse sein und beantwortete die von J. Ekkert angesprochene Frage, wieviel Busch stehen bleiben müsse; ohne jedoch auf die klimatischen Erscheinungen Bezug zu nehmen, noch zu erklären, wie man die 25%-Reservefläche festgelegt habe.
1974 wurde im
Industriewerk ein neuer Dampfgenerator eingerichtet, der ein so starkes Lichtaggregat hatte, dass fast alle Dörfer mit Elektrizität versorgt werden konnten.
Im selben Jahr wurde von Andreas Friesen im
Mennoblatt 1974 Nr. 12 die Frage aufgeworfen: „Wie wird unsere
Kolonie nach 10 Jahren aussehen, wenn 33 Bulldozer so weitermachen?… Der biblische Auftrag `machet euch die Erde untertan’ schließt auch ein Bewahren der Natur ein… Die uns vom Schöpfer anvertraute Natur dürfen wir nicht nach schrankenloser Willkür bearbeiten… uns unserer Verantwortung bewusst sein…"
Im Februar 1975 wurde das Projekt „Beratung für Land- und Viehwirtschaft im zentralen
Chaco" vorgestellt. Ein Minimum an Technik müsse für die rentable Führung dieser Produktionsbereiche eingesetzt werden. Auf der Versuchsstation wurden 1976 erste Versuche mit Ackerbau auf Buschboden angefangen. Die Viehhaltung erlebte eine Intensivierung. 1977 wurden Versuche mit Strauchbekämpfung durchgeführt. Die Dörfer
Boquerón (1975) und Corrales (1979) wurden gegründet. 1982 wurde das Problem der Winderosion im Zusammenhang mit der
Bodenbearbeitung hervorgehoben.
Zum Thema
Naturschutz erschien im
Mennoblatt 1979 Nr. 24 ein längerer Aufsatz von Arnold Thielmann, der eine ganze Auflistung von Möglichkeiten zum
Naturschutz präsentierte. Unter anderem wurde eine Maßnahme empfohlen, die vermuten ließ, dass nur wenige zu der Zeit das Forstgesetz von 1973 kannten.
„Der Regierung müsste klar gemacht werden, dass sie Grenzen und Gesetze herausgeben sollte, die dem unkontrollierten Niederwalzen, Ausroden und Ausbrennen des Chacobusches Einhalt gebieten und in erträgliche Grenzen bringen soll… Leider sehen wir in dem fortwährenden Abknallen der Wildtiere, wie Regierungsgesetze befolgt werden… eine Kommission gegründet werden müsste, die von der Regierung unumschränkte Autorität bekommen sollte, um der Naturzerstörung Einhalt zu gebieten… kommt für Aufforstung, Anpflanzung von Schutzstreifen, Naturschutzgebiete auf… Regeln aufstellen, die beim Ausroden beachtet werden müssen…"
Im
Mennoblatt 1980, Nr. 2 schrieb Peter P. Klassen über einen Vortrag von Lehrer Oskar Kalisch zum Thema
Umweltschutz:
„…Aber wird die Rechnung Hektar mal Rinder aufgehen, wenn rücksichtslos so weitergerodet wird?… Die Verantwortung für das Roden des Chacobusches dürfte nicht mehr dem Einzelnen überlassen werden, auch wenn ihm der Boden gehört. Wieviel Busch pro gerodetem Hektar stehen bleiben müsste, um das Gleichgewicht der Natur nicht zu zerstören, das müsste von der Gemeinschaft bestimmt werden…
Umweltschutz kann nicht vom Einzelnen, sondern nur von der Gemeinschaft und ihrer Führung bewältigt werden. Im
Chaco tragen die Mennoniten bis heute alleine die Verantwortung für die Zukunft eines riesigen Gebietes".
In derselben Nummer meldete sich Ulrich Schmidt zum Thema
Naturschutz im
Chaco: „… das Buschroden im
Chaco ist Mode geworden… Die Kooperative hätte die beste Möglichkeit für
Naturschutz einzutreten… Viele tausende Hektar Wald, die schon gerodet wurden, sind noch nicht bezahlt. Die Angebote auf
Kredite sind vielversprechend. Die Buschbesitzer kommen in große Versuchung… Nur beim Eingreifen in die Natur wäre ein Kredit fehl am Platz".
Man muss heute schon ein Stückchen fahren, um noch einen unberührten Bittergraskamp mit seinen typischen Bäumen zu finden. Im Laufe von 50 Jahren ist auf weiten Flächen in den Siedlungsgebieten alles „dem Erdboden gleichgemacht" worden.
(6) Das Satellitenbild bestätigt diese Aussage.
1983 wurde die Ergebnis-Studie von „Desarrollo Regional Integrado del
Chaco Paraguayo" vorgelegt. Die Studie hatte das Ziel, durch die rationale Nutzung seiner Naturressourcen den
Chaco in die nationale Wirtschaft zu integrieren. Die Studie sollte eine Diagnose der Nutzungspotenziale und Nutzungsschwierigkeiten aufweisen. Die gesamte Studie stand unter der traditionellen Produktionsförderungspolitik. Die Studie legte fest, dass die Landnutzungspraktiken von Ostparaguay im
Chaco nicht anwendbar seien. In Bezug auf die
Mennonitenkolonien wurden die Winderosion, der Verlust der Bodenfruchtbarkeit und das Fehlen der Fruchtfolge im Ackerbau als Probleme angeführt. Die großflächige Rodung wurde nicht als Problem beschrieben, sondern nur erwähnt, dass noch keine
chaco-angepassten Vorschriften zur Landnutzung festgelegt seien, welche die Einflüsse der drastischen Veränderung-Wegnahme von Matorralbusch und die Einsaat von Weidepflanzen niedrig halten könnten. Die Studie endete mit Empfehlungen zur Durchführung von Aktionen. Interessant sind die Gedanken zu den Wassernutzungsrechten, Ley Forestal für den
Chaco, Rodungskontrollen mit Satellitenbildern, Aufforstungsprogrammen mit Eucalyptus-Sorten für ACEPAR, Windschutzprojekten, Regenerationsstudien der Quebrachales, Urundey, Palosanto und Paloblanco.
1983 und 1984 waren sehr niederschlagsreiche Jahre im zentralen
Chaco. Man beobachtete im östlichen Gebiet der Kolonien die ersten Folgen der Versalzung des Bodens und das Absterben der Pflanzen, wenn das Wasser nicht abfließen konnte.
1985 wurde man auf die Gräsersorte Panicum maximum cv. Gatton Panic aufmerksam, weil sie den besten Weideertrag auf der Versuchstation einbrachte. Diese Sorte beseitigte die einseitige und gefährliche Abhängigkeit vom Büffelgras in der Viehwirtschaft. Die Rinderhaltung wurde größtenteils in Betrieben mit weniger als 1.000 ha praktiziert. Viele Mennoniten hatten außerhalb der Koloniegrenzen zusätzlich Land als individuelles Privateigentum erworben.
In diesem Jahr wurde im Westen das Dorf Ribera gegründet. Der Anbau von Erdnuss und Baumwolle wurde ausgeweitet. Die geringe Anbaudiversifizierung, einseitige Fruchtfolgen, unzureichende Technik der Boden- und Wasserkonservierung gehörten zu den Hauptproblemen im Ackerbau.
1985 wurde in
Asunción eine der ersten Umweltstudien für
Paraguay vorgestellt, die vom paraguayischen Technischen Planungssekretariat (STP) in Zusammenarbeit mit der amerikanischen AID (Agencia para el Desarrollo Internacional) erstellt wurde. Die STP trug Sorge um das Gleichgewicht zwischen Nutzung und Erhaltung der landesweiten Naturressourcen. Mit der Studie wollte die STP das Bewusstsein für die Bedeutung der qualitativen Aspekte der Umwelt hervorheben und Empfehlungen zu diesem Ziel geben. Die Studie zitierte die Rodungen im Gebiet der
Mennonitenkolonien und Umgebung, das Verdrängen und Verschwinden der Wildtiere, das Verbrennen von Holz, die fragilen Chacoböden und stellte eine geringe Veränderung der gesamten Natur im
Chaco fest. Im
Chaco waren schon drei große Naturschutzgebiete auf dem Papier festgelegt: Tinfunqué (1966), Defensores del
Chaco (1975) und Tte. Enciso (1980). Die Studie deckte die zu hoch gesteckte Zielsetzung für das Forstgesetz auf und machte auf die Mängel der praktischen Durchführung der zuständigen Instanz aufmerksam.
1986/7 wurde in
Fernheim eine Kreditlinie vom Fondo Ganadero vermittelt, bei der auch Skizzen von Flächenplänen der Betriebe vorgelegt werden mussten. In den meisten Fällen ging es um ein bis vier zusätzliche Fenzen. Die meisten aufgezeichneten Pläne zeigten noch ausreichend Waldfläche, um die 25% Waldfläche einzuplanen. Wenig Wert wurde bei den Planzeichnungen auf Windschutzstreifen gelegt.
1986 wurde das Dekret 18.861 erlassen, welches Richtlinien für den
Umweltschutz festlegte. Das Dekret ist als erster Ansatz für Rodungsvorschriften zu verstehen, die sich auf den
Chaco und seine Umwelt-Problematiken übertragen lassen. Das Wort
Chaco kam aber nicht im Dekret vor.
1987 erreichte die Erdnussanbaufläche in
Fernheim 10.000 ha. Der Anbau verlief ungefähr nach folgendem Schema: Aussaat im Oktober/November, Ernte Januar bis März, in günstigen Jahren ca. 1.800 kg/ha. Nach der Ernte wurde der Boden zwei bis drei Monate offen und brach liegen gelassen, dann folgte die Unkrautbekämpfung mit der Scheibenegge. Danach drei bis fünf Arbeitsgänge je nach Unkrautdruck mit dem Kultivator. Im Frühjahr Tiefpflügen, bei Bedarf Nivellierung mit der Scheibenegge, Aussaat nach 15 mm Regen und Vorauflauf-Herbizidspritzung. Nach Auflauf der Erdnüsse Unkrautbekämpfung mit dem Kultivator bis zu fünf mal. Einige Landwirte ließen das Unkraut im Winter wachsen, dreiviertel der Bauern beseitigten das Unkraut durch mehrfaches Bearbeiten. Der Boden war in der windreichen und niederschlagsarmen Winterzeit offen und kahl. Die Schwarzbrache als Bewirtschaftungsweise förderte den starken Humusabbau bei hohen Temperaturen und Winderosionsproblemen.
1987 wurden im Osten die Ländereien von Laguna Porá an Viehzüchter verkauft. Die jährliche Neurodung und Umwandlung in Kunstweide betrug in
Fernheim in den letzten zehn Jahren durchschnittlich 6.700 ha/Jahr. Die Einnahmen aus der kapitalaufwendigen und stabileren Viehhaltung nahmen im Gegensatz zum risikohaften Ackerbau an Bedeutung zu.
In diesem Jahr wurde in
Asunción die „Dirección de Parques Nacionales y Vida Silvestre" gegründet. Der Nationale Forstdienst verlor somit seine Aufgaben im Bereich der Naturschutzgebiete.
Im selben Jahr wurde auch eine Planungsstudie zum Projekt der Landwirtschaftlichen Versuchsstation im zentralen
Chaco im Auftrag der Deutschen
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (
GTZ) durchgeführt. Dieses Versuchs-, Forschungs- und Ausbildungsprojekt unterstand dem Oberziel: Ressourcenschonende land- und forstwirtschaftliche Nutzung des
Chaco zu ermöglichen, indem standortangepasste Produktionsmethoden entwickelt wurden. Die Studie identifizierte die „unkontrollierte Nutzung natürlicher Ressourcen bei unbekannter Tragfähigkeit" als landwirtschaftliches Kernproblem für den
Chaco.
„Im Zentralen
Chaco ist die von Menschen verursachte ökologische Schädigung am weitesten fortgeschritten. Es findet eine planlose Ausdehnung der Wirtschaftsfläche statt, die zu großflächiger Beseitigung der natürlichen Vegetation und damit zu Winderosion und Verarmung der Böden führt. Diese ungebremste Expansion, die auch bei Betrieben im Umfeld der
Mennonitenkolonien abläuft, ist ökologisch höchst bedenklich und mit der Gefahr zunehmender Klimaschwankungen und Versteppung verbunden, die sich auch auf Gebiete außerhalb des
Chaco auswirken könnte".
Die Studie schätzte dass in der zentralen Chacozone und Umgebung ca. 50.000 ha Busch/Jahr durch Rodung und Abbrennen verschwanden. Der Holzbedarf für die Elektrizitätsgewinnung in
Loma Plata und
Filadelfia wurde auf lediglich 730 ha/Jahr angeführt. „Die ökologische Verarmung, die reduzierte Wasserinfiltration, die stärkere Bodenerhitzung und die ungebremste Windbewegung wirken sich negativ auf das Mikroklima aus und die Evapotranspiration wird verstärkt. Forstliche Maßnahmen und Vorschriften sind dringend geboten, um eine Entwicklung zu stoppen, die mit Versteppung, Dünen- und Wüstenbildung enden könnte". Die Studie bemerkte, dass bei den mennonitischen Siedlern ein gewisses Problembewusstsein vorhanden sei.
Das Forschungsinstitut, welches von der
GTZ am Cruce
Loma Plata aufgebaut wurde, hatte die Ökologie und den
Umweltschutz ganz stark in ihre zukünftigen Forschungsprogramme mit eingeplant.
(7)
Die lokalen Beratungsdienste haben in den darauf folgenden Jahren gezielter die bodenschonenden Ackerbaumethoden und Aufforstungsprojekte zur Erosionsproblematik aufgegriffen. Ergebnisse der Forschungsstation wurden an die Produzenten vermittelt. Im Osten wurde die Salzproblematik als ein Umweltproblem anerkannt.
Im April 1991 wurde nach Resolution 204 im Landwirtschaftsministerium die „Kommission für nachhaltige Entwicklung der Naturressourcen des Zentralen
Chaco" gegründet. Die Kommission bestand aus drei Personen vom MAG und drei von den Chacokolonien. Im August 1991 wurde das „Abkommen zur rationellen Hantierung der Naturressourcen" zwischen dem Landwirtschaftsministerium (MAG) und den Kolonien, unterzeichnet. MAG war um die Ausweitung der Umweltschäden, Winderosion, Rodungen, Versalzungen usw. besorgt. In der Auflistung von Tätigkeiten wurde von der Anwendung des Forstgesetzes gesprochen, wobei besonders die Einhaltung der Schonstreifen, Förderung von Aufforstungsprogrammen, Verhinderung des Einsatzes von Feuer als Strauchbekämpfungsmethode, Schutz der natürlichen Wasserreserven betont wurden. MAG sicherte die Ausweitung seines Wirkungskreises in den zentralen
Chaco hinein zu, denn bis dahin existierte der staatliche
Beratungsdienst im gesamten
Chaco praktisch nicht. Wenn man bedenkt, dass die Beziehungen zwischen MAG und Mennoniten-Kolonien bis dahin auf klarer gegenseitiger Abgrenzung beruhten (Planungsstudie
GTZ, 1987), bedeutet dieses Abkommen für beide Seiten einen interessanten Schritt in Richtung Integration in die nationale Entwicklungsförderung.
Der Anlass zur Gründung der Kommission war die Vorbedingung, die die deutsche Regierung
Paraguay gestellt hatte, die großen Naturreserven, die es im
Chaco noch gab, zu sichern. Falls
Paraguay und wir (die Mennoniten-Kolonien) keinen vernünftigen Plan zum
Umweltschutz vorlegten, werde Deutschland die
Kredite für die Stromleitung in den
Chaco nicht gewähren.
(8) Dem ökologischen Gleichgewicht der Natur wurde bei der Elektrifizierung des
Chaco eine große Bedeutung beigemessen. Die Finanzierung des Elektrifizierungsprojektes wurde in bestimmter Hinsicht von der Einhaltung oder Durchführung gewisser Schritte zur Naturerhaltung seitens der Chacosiedler abhängig gemacht. Die Beratungsdienste der Kolonien wurden beauftragt, die Planung und Durchführung der diesbezüglichen Aufgaben zu übernehmen. Nach außen bedeutete dies, in enger Zusammenarbeit mit dem paraguayischen Ministerium zu arbeiten.
(9) Es war die Situation eingetreten, „…die zu schnellem Handeln drängt…" von der J. Ekkert schrieb. Es schien so, weil keine Ergebnisse einer „zeitigen Planung" vorzuweisen waren.
Somit begann die Zeit, in der verlangt wurde dass die Chacobewohner ihr Umweltbewusstsein durch Aktionen und Ergebnisse konkreter und offizieller unter Beweis stellen sollten.
In den neunziger Jahren zielten die Beratungsinhalte in den
Mennonitenkolonien mit Nachdruck auf die naturschonenden Maßnahmen. Die Problematik der Winderosion im Westen sollte mit Aufforstungsstreifen gebremst werden, das sogenannte Ribera-Windschutzprojekt wurde angefangen. In der Methode der
Bodenbearbeitung für Ackerbauflächen wurden Versuche mit Zinkengeräten, mit Minimalbearbeitung und mit Direktsaat durchgeführt. Im Ackerbau wurden umweltfreundlichere Pflanzenschutzmittel eingesetzt, die auch wiederum den Baumwollanbau förderten. Der Erdnussanbau war nach 1992 von 6.000 ha auf 2.000 ha, mit sehr niedrigen Durchschnittserträgen gesunken. Das Erdnussprogramm wurde vor ein Entweder-Oder gestellt. Die Zeit der rentablen Öl-Erdnuss-Produktion war beendet und der Übergang zur Konfitüre-Erdnuss-Produktion fand statt. Ein stufenweiser Sortenwechsel führte von 1993 bis 1996 zu neuen Erfahrungen im Erdnussanbau und in der Vermarktung. Parallel wurden im Erdnussspeicher Verbesserungen zur Verarbeitung und Auslese der Konfitüre-Erdnüsse durchgeführt. Nach Beratungen mit argentinischen Fachkräften wurde die Produktionstechnik mit Blatt-Pilzbekämpfungen und verspäteten Aussaaten, Einhaltung von Fruchtfolgen leicht verändert. Die Anbaufläche stabilisierte sich zwischen 4.500 und 5.000 ha/Jahr. Die Bearbeitungsmethode änderte sich grundsätzlich in der Zahl der Arbeitsgänge, und die Unkrautkontrolle wurde verbessert. Andere Kulturen wie Baumwolle, Rizinus, Sesam und Sorghum behielten ihre strategische Bedeutung durch die Anwendung von Fruchtfolgen, die dem Erdnussanbau zugute kamen.
Die Viehzüchter trieben die Erweiterung der Weideflächen in Richtung Norden, Nordwesten und Westen der Koloniegebiete voran. Die Rinderherden wurden durch Kreuzungen verbessert und die Qualitätsverbesserung in der Fleischproduktion wurde gezielt angestrebt. Ein größerer Landblock wurde im Nordwesten an Viehzüchter verkauft. Die Viehwirtschaft war zum Hauptproduktionszweig der
Genossenschaft geworden.
1991 wurde in
Fernheim ein größeres Stück Land im Titel Block von Laguna Porá als Naturschutzgebiet erklärt. Es war ein Vorschlag vom Kolonieamt und er wurde auf einer Bürgerversammlung angenommen. Eine Begebenheit von beispielhaftem Mangel an Umweltbewusstsein und Umweltaggression veranlasste Heinz Th.Loewen im
Mennoblatt 1991, Nr. 17 die mit der Einrichtung eines Naturschutzgebietes verfolgten Absichten zu hinterfragen. „Wehrlose Mennoniten" können nicht ohne zu schießen an einer Herde Wildschweine vorbeifahren, nach Lust und Laune wird auf Fuchs, Geier und Habicht geschossen, Zivilisationsmüll wird auf Fischlagerplatz zurückgelassen. Es fehlt nicht an dem Willen, Land zu reservieren.
1992 wird in
Paraguay die neue Verfassung in Kraft gesetzt, wo im Artikel 176 im VI. Kapitel die Wirtschaftspolitik des Staates festgelegt wird. „Der Staat wird die wirtschaftliche Entwicklung durch die rationale Nutzung der zur Verfügung stehenden Ressourcen fördern, um ein geordnetes und nachhaltiges Wirtschaftswachstum voranzutreiben".
Zwischen den Jahren 1992 und 1997 wurden die Studien zum Projekt „Sistema Ambiental del
Chaco" durchgeführt. Das Projekt publizierte seine Studienergebnisse 1998 und 1999. Hier wurde das Satellitenbild mit dem großen, weißen Flecken von 1993 publiziert und offiziell in
Paraguay bekannt. Unter vielen anderen Daten wurden hier die zu schmalen und unzureichenden Schonstreifen in den Kolonien kritisiert und das Nichteinhalten der gesetzlichen Rodungsvorschriften mit 25% Reserve aus Mangel an Verständnis, weil es sich nicht kontrollieren lasse oder weil man es einfach nicht wolle. Die Strafen sollten Aufforstungsmaßnahmen sein. Das System „Kettenroden" wurde kritisiert ebenso wie die Tatsache, dass man zu wenig Bäume stehen lasse.
Im Jahr 1996 wurde das Thema der Rodungspläne im
Oberschulzenrat diskutiert. Man wollte die Rodepläne nicht in
Asunción bearbeiten lassen, sondern beim lokalen Forstbüro. Die Beratungsdienste der Kolonien wurden beauftragt, für die Bürger die Formalitäten zu erledigen. Die Kontrollen der Rodungsarbeiten sollten aber vom Servicio Forestal Nacional durchgeführt werden.
Im Mai 1997 brachte ein Memorandum das Thema der Rodungspläne ins Gespräch. David F. Sawatzky, Koordinator für umweltverträgliche Nutzung der Naturressourcen im zentralen
Chaco, erwähnte einleitend die positiven Ergebnisse der Kommission, wo besonders die Bewusstmachung der Notwendigkeit des Umweltschutzes hervorgehoben wurde, die Anpflanzung von Windschutzstreifen und die Vorstellung von umweltschonenderen Rodungsmethoden ohne das Brennen des Unterholzes einzusetzen. Geregelt werden musste jedoch das Thema der planmässigen Rodungsgenehmigungen, so wie sie das Gesetz Nr. 422 vorschreibt. Es folgten Vorschläge zur weiteren Ausstattung des Forstbüros im zentralen
Chaco, Eintragung der Agraringenieure der Beratungsdienste in die Liste der Fachleute zur Erstellung der Landnutzungspläne im Nationalen Forstdienst (SFN), Ablauf des Genehmigungsverfahrens in Absprache zwischen MAG und den Kolonien, möglichst im lokalen Forstbüro unter Aufsicht des SFN. Man wollte mit dieser Verhandlung die bürokratischen und in
Asunción zentralisierten Prozesse vereinfachen. Die Landbesitzer sollten die gesetzlichen Vorschriften einhalten und entsprechend beraten werden. Um Problemen vorzubeugen, sollte keine Rodung ohne einen genehmigten Plan durchgeführt werden. Laut Gesetz darf niemand ohne die Registrierung des Landstückes und die Vorlage eines Landnutzungsplanes auf seinem Land roden lassen.
(10)
Die Kolonien verhandelten mit Dienststellen des Landwirtschaftsministeriums, um die Bürokratie bei der Durchführung der Bestimmungen zu reduzieren. Die Grundsatzbestimmungen sollten bleiben. Sie seien für die langfristige Erhaltung der Produktionsmöglichkeiten im
Chaco auch notwendig. „…Mittlerweile haben wir uns schon an den
Chaco gewöhnt, lieben ihn und fühlen uns hier wohl".
(11) Die Grundsatzbestimmungen blieben auch für die bürokratischen Aspekte bestehen. Durch Inkraftsetzung des Gesetzes Nr. 294/93 und das reglementierende Dekret N° 14.281/96 wurde das administrative Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung hinzugefügt. Die Formalisierung zu diesem Gesetz verlängerte das Genehmigungsverfahren der Rodungsprojekte.
Um die Jahreswende 1997/98 gab es eine Konfliktsituation mit dem Forstgesetz wegen dem Palosanto-Holz-Aufkauf in
Loma Plata und der Irregularität der Lieferanten, die keine „Guías" – Begleitscheine zum Holz hatten. Zur Ausstellung dieser Scheine brauchte der Lieferant einen genehmigten Landnutzungsplan. Diese Situation brachte das Thema der Rodungspläne wieder auf den Tisch.
(12)
Im Juni 1998 wurde ein neues Abkommen der technischen Zusammenarbeit zwischen MAG und der Vereinigung der
Mennonitenkolonien in
Paraguay zur nachhaltigen Entwicklung der Naturressourcen und der Umwelt im zentralen
Chaco unterzeichnet.
(13) Drehachse in diesem Abkommen war die noble Absicht beider Beteiligter, gemeinsame Aktionen zur Anleitung einer nachhaltigen und sozialwirtschaftlichen Entwicklung durchzuführen. Dieses Abkommen war als Verstärkung zum ersten Abkommen zu verstehen. Die Verhandlungen hatten die Absicht, eine Entbürokratisierung und Vereinfachung der Bearbeitung der Rodungsanträge zum Gesetz 422/73 zu erreichen. Dies konnte jedoch nicht erreicht werden. Vielmehr wurde das Spektrum der gesetzlichen Bereiche erweitert, indem auch drei Verpflichtungen der Gesetze 294/93; 352/94 und 536/95 eingegliedert wurden. Man bekam den Eindruck, dass MAG die
Chaco-Mennoniten zu einem Vorbild bei der Einhaltung von Gesetzen machen wollte. Mit der Unterschrift des Abkommens hatten die
Chaco–
Mennonitenkolonien eine Art Verpflichtung zur Einhaltung der erwähnten Gesetze ausgedrückt, was ja für Landesverhältnisse als großartig bewertet werden konnte. MAG verpflichtete sich zur Partnerschaft im Sinne einer technischen Zusammenarbeit. MAG verpflichtete sich auch, den Mennoniten des
Chaco einen wichtigen Stellenwert einzuräumen.
(14) Das Abkommen sollte drei Jahre gültig sein und ist nicht erneuert worden, weil kein Bedarf bestand.
Im November 1998 fand eine Besprechungssitzung statt, wo ein Kursus für die Erstellung der Landnutzungspläne gefordert wurde. Der vorgelegte und vereinfachte Rodungsplan-Entwurf wurde nicht akzeptiert.
Um die Jahreswende 1998/99 gab es wieder eine Konfliktsituation mit dem Gesetz wegen einer irregulären Rodung in
Fernheim. Die Situation verlangte zur Lösung die Erstellung des Landnutzungsplans nach der Vorschrift des Forstgesetzes. Die Beratungsdienste waren mitten in den Vorbereitungen zum Ausbau einer Abteilung zur Erstellung der Landnutzungspläne. Die Bürger wurden gebeten, nicht ohne entsprechende Dokumente zu roden oder Pfosten zu transportieren.
(15)
Die Gesetze, die in das Abkommen eingegliedert worden waren, wurden 1999 ins Deutsche übersetzt und Interessenten zur Verfügung gestellt.
Seit Mitte Jahr 2001 ist die Kooperative
Fernheim Eigentümer eines funktionierenden Schlachthofes. Die Viehwirtschaft wird durch diese Verarbeitungseinrichtung weiter gefördert, ohne die andern Produktionszweige aus dem Auge zu lassen.
(16) Ende 2002 kaufte die Kooperative den östlichen Block der Estancia Remonia, deren Landstücke an vorher gekaufte Ländereien anschließen.
Produzenten haben in diesen Jahren verstärkt umweltfreundlichere Produktionstechniken auch beim Roden und Nacharbeiten der Weiden eingesetzt. Die Richtlinien und Empfehlungen der „Licencia Ambiental" werden zum Teil berücksichtigt.
In den Jahren 1999 bis 2003 sind in den Kolonien ca. 350.000 ha Land in Landnutzungsplänen bearbeitet und bis soweit ca. 189.000 ha (54% Rodungsfläche im Durchschnitt) zum Roden freigegeben worden. Allein in
Fernheim sind ca. 130.000 ha Land in Landnutzungsplänen bearbeitet und 53.000 ha zum Roden freigegeben worden. Das sind 10.600 ha/Jahr Rodungsfläche mit legaler Genehmigung. Durch diese Landnutzungspläne sind 87.500 ha in der gesetzlich verlangten 25%-Reserve festgelegt. Die Schonstreifen nehmen durchschnittlich zwischen 12 – 16% der Gesamtfläche eines Landstückes ein.
Die Daten zeigen, dass die Rodungsfläche pro Jahr durch die administrativen und legalisierten Verfahren keineswegs niedriger ist als vor der Einsetzung dieser Prozesse. Die Produzenten stellen sich sicher unter den Schutz der offiziellen Genehmigungen und investieren weiter in neue Weideflächen. Durch die Formalisierung der Landnutzungspläne und die Genehmigungen der Rodungsanträge ist die Zeit beendet, von der P. Klassen schrieb: „Im
Chaco tragen die Mennoniten bis heute alleine die Verantwortung für die Zukunft eines riesigen Gebietes". Ob man heute in den mennonitischen Kolonien Verständnis dafür hat, dass die zuständigen Forst- und Umweltbehörden sich unter Einhaltung gewisser „Spielregeln in Form von gesetzlichen Bedingungen" mitverantwortlich an der Erweiterung und Gestaltung des „großen Flecken" machen?
Bei der Herstellung dieser Landnutzungspläne wird den potenziellen Wasserstellen eine wirtschaftlich-strategische Bedeutung beigemessen und möglichst mit der vom Gesetz geforderten 25%-Reserve abgestimmt, um eine größere Zuflussfläche für das Wassersammeln in den sogenannten „Tajamares" zu sichern.
Nach Angaben der Federación Paraguaya de Madereros sind in den Jahren 2000 bis 2003 aus dem gesamten
Chaco 329 Landnutzungsprojekte eingereicht worden, davon waren 215 (65%) aus den drei Chacokolonien. Die Projekte umfassen eine Landfläche von 1,2 Mill ha. Das sind insgesamt 400.000 ha Rodungsfläche, die in dieser Zeit genehmigt wurden. Davon gehören 189.000 ha (47%) zu den Projekten der drei Chacokolonien. Diese Daten zeigen, dass die Mennoniten-Kolonien nicht mehr die einzigen Gestalter des hellen Fleckens auf der Karte sind. Ihr Nutzungsmodell wird von anderen Landeigentümern im
Chaco übernommen.
Nach Daten aus dem
Beratungsdienst Fernheim, 2003, haben die drei Chacokolonien ca. 22.000 ha Naturschutzgebiete. Durch die Erstellung der Landnutzungspläne und Festlegung der 25% der Reserve in der Betriebsfläche sind zusätzlich noch 87.500 ha dazugekommen. Das ergibt eine Fläche von insgesamt 109.500 ha. Die Gesamtfläche der 3 Kolonien liegt bei rund 1,4 Mill. ha.
Über die Rodungen und Rodungsflächen ohne legale Genehmigungen sind keine Daten und Flächen bekannt, nur Namen. Es ist jedoch bekannt, dass heute mennonitische Bulldozerunternehmer und Produzenten noch Rodungen ohne legale Genehmigungen auf eigenes Risiko durchführen.
B. Allgemeine Informationen zu den Gesetzesinhalten
Der Staat mit seinen Behörden bringt in Gesetzen seinen Willen gegenüber den Landesbewohnern zum Ausdruck. Die Gesetze sollen als „Spielregeln" für die verschiedenen Aktivitäten der Landesbewohner angesehen werden und haben im Falle der Forst- und Umweltgesetze vorbeugenden Charakter. Die Gesetze enthalten viele Forderungen, die den Absichten der mennonitischen Gemeinschaften im
Chaco im Grunde genommen sehr nahe kommen und noch darüber hinaus reichen.
a) Auf der Grundlage des „alten" Forstgesetzes N° 422 von 1973, erlassene Dekrete und Resolutionen:
In
Paraguay wurde 1973 das erste Forstgesetz erlassen, nachdem Forstexperten der FAO 1956 (Leopoldo Perfumo u. Claudio Pavetti), 1957 (F. Cermak) und 1966 (Lucas A. Tortorelli) Daten über die abnehmenden Waldflächen und die Eigenschaften der Hölzer publizierten. Besonders die Studie von Tortorelli hatte gezielt auf die Notwendigkeit einer geregelten Ausbeutung der Wälder und Nutzung der Hölzer hingewiesen. Er hatte auch einige Daten über die Vegetationsformen und Baumarten im
Chaco zusammengefasst. Er wies ganz allgemein auf die ungeplanten Rodungsprozesse hin, bei denen weder die Bodeneigenart noch die Holzmenge, die im Wald ist, berücksichtigt wurde. Folglich entstanden Probleme mit Wassererosion, die manche Siedlungen zum Umzug in neue Waldgebiete zwangen. Er schätzte, dass im Jahr 1980 nur noch 20% Waldfläche in
Paraguay vorhanden sein würde, wenn die Nutzung und Ausbeutung weiterhin planlos ohne Zählungen und Messungen durchgeführt würde. Er verwies auch auf die Notwendigkeit der Aufforstung mit Eucalyptus- und, Pinus-Arten, weil die Holznachfrage weltweit ansteige. Auffallend ist, dass er nicht die Paraíso-Art erwähnte, die im
Chaco zu jener Zeit versuchsweise und in Dorfreihen angepflanzt wurde.
Das Forstgesetz wurde als Reaktion auf die bis dahin bekannten und ungeplanten Rodungsprozesse besonders in Ostparaguay erlassen. Im
Chaco war es zu der Zeit auch nicht viel anders, denn die ungeplanten Rodungen waren schon ein Diskussionsthema. Durch das Forstgesetz wurde die Ausübung der Rechte über Wälder und forstwirtschaftliche Gebiete den Einschränkungen und Begrenzungen unterworfen, die in den Verordnungen festgelegt wurden. Die Hauptziele dieses Gesetzes wurden in neun Punkten beschrieben. Die rationale Nutzung der forstwirtschaftlichen Ressourcen des Landes,
die Bekämpfung der Bodenerosion, der Schutz der Wasserstromgebiete und Quellen, die Förderung von Aufforstung, der
Schutz der Ackerfelder, Schutz und Verschönerung der Verbindungswege und Tourismusgebiete seien die wichtigsten. Die Bekämpfung der Bodenerosion und der Schutz der Ackerfelder passte schon zu den Problemen, mit denen man in den
Mennonitenkolonien eine gewisse Not hatte.
Im 21. Artikel wurde der Wirkungsrahmen des Forstgesetzes festgelegt: „Dieser Gesetzesordnung sind alle im Landesterritorium vorhandenen Wälder und forstwirtschaftlichen Ländereien unterstellt". Auch die Chacolandschaft gehört zu diesem Landesterritorium. Nach dem 24. Artikel erlaubt dieses Gesetz „die Nutzung der Wälder erst nach vorheriger Genehmigung seitens des Nationalen Forstdienstes. Zu diesem Zweck muss ein entsprechender Antrag mit einem Arbeitsplan eingereicht werden. Der Antrag muss innerhalb einer Frist von 60 Tagen beantwortet werden".
Im 26. Artikel wird der Transport und die Vermarktung der Hölzer und anderer forstwirtschaftlicher Erzeugnisse geregelt. Diese Aktivitäten dürfen nicht ohne die vom Nationalen Forstdienst ausgestellten Begleitscheine (die sogenannten „guías") vorgenommen werden, auf denen die Anzahl, die Art, das Gewicht oder die Menge, die Herkunft und der Bestimmungsort der transportierten Erzeugnisse angegeben sein müssen.
Unter den Nutzungsordnungen ist im Artikel 42 festgelegt, dass „auf allen ländlichen Grundstücken von mehr als 20 Hektar 25% der natürlichen Waldfläche erhalten bleiben. Falls dieser Mindestprozentsatz nicht vorhanden ist, muss der Eigentümer eine Fläche aufforsten, die 5% der Grundstücksfläche entspricht". Diese Verordnung wird im Dekret 18.831 vom Dez. 1986 im 11. Artikel mit Nachdruck wiederholt. In der Resolution 001 vom Jahr 1994 wird diesbezüglich klärend und weiter ausführend im 1. Artikel „festgelegt, dass die 25% Naturwald aus einer zusammenhängenden und kompakten Waldmasse bestehen müssen. Diese Forstmasse kann für Produktionszwecke bewirtschaftet werden". Diese Klärungen zur gegebenen Nutzungsordnung sind offensichtlich auf Nachfragen von Landeigentümern und aufgrund von Einhaltungsschwierigkeiten in der Praxis notwendig gewesen. Darunter befanden sich ganz bestimmt auch Stimmen aus den mennonitischen Kolonien.
Das Dekret 18.831 von 1986 legt Richtlinien für den
Umweltschutz fest. Konzepte wie Schutzregeln für Naturressourcen, Böden, Wassereinzugsgebiete und Wasserläufe werden als Zielsetzung in den ersten zwei Artikeln angesprochen.
Der 3. Artikel verlangt, dass „für den Schutz der Flüsse, Bäche, Quellen und Seen zu beiden Seiten derselben ein Waldschutzstreifen von mindestens 100 m stehengelassen werden muss". In der Resolution 001 wird im 3. Artikel diesbezüglich noch ergänzt, dass dieser Waldschutzstreifen nicht als Teil der 25% Naturwald miteingerechnet werden darf. Diese Verordnung wird heute vom Umweltsekretariat oftmals auch für trockene, mit Sand höher aufgeschwemmte, flussähnlich verlaufende Sandkämpe und Paleocauces (ehemalige Flussläufe) gefordert, besonders dann, wenn solche Gebiete den 25% Naturwald zugeordnet werden.
Der 6. Artikel im Dekret 18.831 „verbietet das Abholzen von mehr als 100 ha in einem Stück und verlangt Waldstreifen von mindestens 100 m Breite zwischen den Parzellen". In der Resolution 001 wird im 2. Artikel ergänzt, dass diese „100 m breiten Waldstreifen nicht als Teil der 25% Naturwald mitgerechnet werden dürfen".
Die
Resolution N° 729 aus dem Jahr 2000 war eine der ersten speziell für den
Chaco erlassene Forstverordnung. Sie erklärt die Forderung der 100 m breiten Schonstreifen in Richtung Osten-Westen als notwendig bei Rodungsflächen von über 100 ha. Zusätzlich sollen 100 m Schutzstreifen rings um das Landstück stehen gelassen werden. Bei kleineren Rodungsflächen sollen die Schutzstreifen 50 m sein. Die 25% Reserve können aus technischen Gründen aufgeteilt werden.
Das Dekret 18.831 verlangt von jedem Land-Eigentümer, der Land-, Vieh- oder Forstwirtschaft betreibt, die Anwendung von Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Erosion, die Vermeidung der Überweidung, die Anwendung von Maßnahmen zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit. Es ähnelt in gewissem Sinne dem biblischen Auftrag von 1.Mose 2,15: „Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn
bebaue und
bewahre" (Zürcher-Übersetzung). Dieses Dekret wurde erlassen, nachdem schon einige Studien über die wirtschaftlichen Errungenschaften des
Chaco durchgeführt worden waren und man erkannt hatte, dass die üblichen Landnutzungsbestimmungen unpassend für den
Chaco waren. Eine Studie hatte sogar die Erlassung einer Ley Forestal für den
Chaco vorgeschlagen. Dieses Dekret ist als eine Antwort auf die Umweltproblematiken im
Chaco anzusehen.
Im Jahr 1993 wurde das Palo-Santo-Dekret Nr. 18.105 erlassen. Dadurch soll das Abholzen und die Nutzung von Palo Santo (Bulnesia sarmientoi) begrenzt werden. Der Anlass für dieses Dekret war die massive Ausbeutung für Handelszwecke und die steigende Nachfrage im Export, der einen Raubbau an dieser Art verursacht, welcher in kurzer Zeit zu deren Aussterben führen kann, wenn keine wirksamen Schutzvorkehrungen getroffen werden.
b) Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung N° 294 von 1993
Dieses Gesetz verpflichtet zur Bewertung der Auswirkungen verschiedener Aktivitäten auf die Umwelt. Zu diesen Aktivitäten zählen: menschliche Ansiedlungen, Nutzung in landwirtschaftlichen
Viehzucht-, Forst oder Farmbetrieben, Industrieanlagen und Betriebe jeder Art; Abfallentsorgung,
Wegebau im Allgemeinen, Herstellung von Holzkohle und anderen Energieerzeugern, Bauvorhaben, Rodungen und Ausbaggerungen und jegliche andere Aktivitäten, die aufgrund ihres Ausmaßes oder ihrer Intensität Auswirkungen auf die Umwelt haben könnten.
Im 12. Artikel wird das Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung, die sogenannte „Erklärung über die Auswirkung auf die Umwelt" (Declaración de Impacto Ambiental oder Licencia Ambiental) als unumgängliche Vorbedingung für den Erhalt von Genehmigungen anderer amtlicher Dienststellen festgelegt. Wenn es sich um ein Rodungsprojekt handelt, muss dieses erst den Prozess im Umweltsekretariat abschließen, und mit der „Licencia Ambiental" wird das Projekt dem Forstdienst zur Prüfung eingereicht.
Der Vorgang der Umweltverträglichkeitsprüfung sieht vor, dass die Stadtverwaltung des betreffenden Bezirkes (Munizipalität) eine Standortbescheinigung für das betreffende Projekt ausstellt. Zusätzlich wird von der betreffenden Departamentsverwaltung eine Erklärung verlangt, ob Interesse an dem Unternehmen oder Vorhaben des Projektes besteht. Im vorgegebenem Umweltfragebogen wird das Projekt beschrieben und mit den erwähnten Bescheinigungen im Umweltsekretariat zur Prüfung vorgelegt. Das Umweltsekretariat hat die Befugnis, zusätzliche Informationen vom Projektinhaber zu verlangen, wenn der Umweltfragebogen ungenügende Auskunft über Umweltveränderungen im Umfeld gibt. Wenn z.B. ein Rodungsprojekt vorgelegt wird und der Landnutzer nur einen Teil des Landes besitzt, müssen zusätzliche Daten über die Buschverteilung auf dem Landtitel vorgelegt werden, um zu prüfen, ob die 25% Naturwald auf dem Titel auch nach der Durchführung des Projektes erhalten bleiben.
c) Gesetz Nr. 352 Naturschutzgebiete Juni 1994
Dieses Gesetz erklärt in Artikel 2, „dass der Nationale
Naturschutz von sozialem Interesse und gemeinnützig ist und nach dem vorliegenden Gesetz und dessen Verordnungen geregelt wird. Alle Einwohner, private Organisationen und staatlichen Institutionen haben die Pflicht, die Naturschutzgebiete zu bewahren".
Naturschutzgebiete werden nach Artikel 4 als
„ein klar abgegrenzter Teil des Landesgebietes verstanden, der sich in seinem ursprünglichen bzw. fast unveränderten Urzustand befindet und so bewirtschaftet wird, dass die Erhaltung, der Schutz und die Verbesserung der Umwelt und der betreffenden Naturressourcen gewährleistet ist. Sie können staatliches, departamentales, städtisches oder privates Eigentum sein. In diesen Gebieten müssen sich alle Formen der Nutzung und Aktivitäten nach den Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes und seiner Verordnungen richten, ganz unabhängig davon, in wessen Besitz sie sich befinden".
Als ein Dauerziel des Nationalen Naturschutzsystems wird nach Artikel 16
„die Erhaltung der Umwelt in bestimmten Teilen des Landes mit typischen Landschaften verschiedener biogeografischer und ökologischer Regionen festgelegt, um die biologische Vielfalt zu bewahren und das Gleichgewicht und die Kontinuität der evolutiven und ökologischen Prozesse zu gewährleisten, den genetischen Fluss und das genetische Material zu erhalten und abgebaute Ökosysteme zu sanieren. Zu den Hauptzielen gehört auch die Bewirtschaftung dieser Gebiete und ihrer jeweiligen Pufferzonen nach den Kriterien einer nachhaltigen sozioökonomischen Entwicklung, die Erhaltung und die Bewirtschaftung von Wassereinzugsgebieten und Sumpfgebieten, die Bekämpfung der Erosion, der Schutz und die Bewirtschaftung von Forstressourcen und der natürlichen Flora und Fauna, der Schutz des Kulturerbes, seiner materiellen Einrichtungen, seiner Zufahrtswege und seiner Umgebung, wie auch der Aktivitäten, die den ökologischen Tourismus an geeigneten Stellen ermöglichen".
Das Gesetz unterscheidet den formellen Prozess zur Erklärung von staatlichen und privaten Naturschutzgebieten. „Vorbedingung ist bei den privaten Naturschutzgebieten ein entsprechender technischer Nachweis der besonderen Merkmale und Ressourcen in dem betreffenden Gebiet und ihre Bedeutung für die jetzige und zukünftige Erhaltung des Ökosystems, der Ökoprozesse und Naturschätze". Durch die Festlegung der Bewirtschaftungskategorie des Naturschutzgebietes werden die Aktivitäten festgelegt, die in diesem Gebiet zugelassen werden (Artikel 6, 7 u. 9)
Naturschutzgebiete im Privatbesitz, die mit einem Dekret „als solche erklärt worden sind, brauchen keine Grundsteuer und auch keine Ersatz- und Zusatzsteuer zahlen, die für das betreffende Landstück entrichtet werden".
Nach den administrativen Regeln dieses Gesetzes sind zumindest in
Fernheim noch keine Naturschutzgebiete „formalisiert". In den meisten Fällen in
Paraguay kommt dieser Prozess erst bei „Bedrohung" durch ilegale Landbesetzer in Gang. Das Gesetz zeigt aber auch, dass
Naturschutz mehr bedeutet, als Land vor der üblichen Nutzung zu schützen. Die Festlegung eines Naturschutzgebietes sieht vor, dass durch einen Planungsprozess eine Zielsetzung für ein bestimmtes Landstück festgelegt wird. In diesem Themenbereich sieht die Situation so aus, wie sie in dem oben zitierten Aritkel von Heinz Th. Loewen umschrieben wird. Man bekommt fast den Eindruck, dass man Naturschutzgebiete nur zum „alles Wild abknallen" haben will. Es scheint noch nicht die notwendige Reife für die Erschließung der Naturschutzgebiete nach den Regeln dieses Gesetzes vorhanden zu sein.
d) Gesetz zur Förderung der Aufforstung und Wiederaufforstung Nr. 536 vom Januar 1995
Der Unterschied zwischen Aufforstung und Wiederaufforstung wird im 2. Artikel erklärt: „Aufforstung ist die Anpflanzung von Wäldern mit einheimischen und ausländischen Baumarten auf Gelände, wo es keinen oder nicht genug Wald gibt. Wiederaufforstung ist die Rückgewinnung früherer, ausgebeuteter Waldgebiete durch die Anpflanzung, den gesteuerten Wiederaufwuchs und die Ansaat von Baumarten". Im Dekret 9.425 vom Juni 1995 wird Wiederaufforstung im Artikel 2d unter anderem auch als „
gezielte Regenerierung" erklärt. Durch Maßnahmen mit gezielter Regenerierung kann im
Chaco viel realistischer an Wiederaufforstung gedacht und dieser geplant werden. Mit gezielter Regenerierung kann ein Bauer die lästige Verstrauchung der Weiden gezielt für Schutzmaßnahmen einsetzen. In diesem Bereich hat die
Chaco-Umwelt ein starkes Nutzungs-Potenzial.
Schlussgedanken:
a) Zum Satellitenbild:
Bei genauerem Hinsehen und unter farbigen Verhältnissen kann man bei dem Bild im zentralen Teil des Fleckens nur sehr wenige Waldflächen um die Siedlungszentren sehen. In gewisser Entfernung von diesen erkennt man aber schon, dass auch andere Rodungsmodelle mit breiteren Schonstreifen und größeren Reserven praktiziert wurden. Manche von diesen vorbildhaften Landstücken gehören nicht den mennonitischen Siedlern, sie haben aber ein positives Bild nach der Rodung hinterlassen. In dem Teil vom Bild, der in den siebziger und achtzigerJahren gerodet wurde, sieht man als Reserven oftmals ganz kleine Buschinseln, die in vielen Fällen als Paloblanconiederungen identifiziert werden. Diese sind immer besonders vor den Rodungen verschont geblieben, einmal wegen ihrer Schönheit und andererseits wegen der potenziellen Wasserstellen. Die Schonstreifen wurden in diesen Jahren „sehr schlank" angesetzt. Sicherheit vor Feuer können solche Schonstreifen nicht geboten haben und tun dies auch heute nicht.
Wenn Produzenten heute das Satellitenbild sehen, sei es vor dem Kauf eines Landstücks, oder für die Planung der Rodungsverteilung wird ihnen klar, dass heute keine Prozesse auf dem Landstück mehr verborgen oder unbekannt bleiben. Die Bilder sind eine Informationsquelle über Wald, Weide und
Bodenbearbeitung, die heute jedem zur Verfügung steht, um Planungsdaten, für Rodungen zu erhalten oder um Kontrollen der Rodungsprozesse, auch von Seiten der zuständigen Behörde durchzuführen. Man sieht die Schonstreifen, wenn sie zu schmal geraten sind, und man sieht genau ob die 25% wie geplant stehen bleiben.
Die Satellitenbilder bedürfen keiner Rechtfertigung, höchstens die Erklärung dass sie Wald erst bei 30 oder 15 m Breite erkennen lassen.
Die Satellitenbilder des zentralen
Chaco beantworten in wenigen Worten, die ins Gewissen formulierte Frage des Schöpfers: „Was hast du aus dem allem gemacht?" Der Auftrag des „Untertan-Machen" nach 1. Mose 1,28 wurde ausgeführt.
b) Zur Winderosionsproblematik auf Ackerböden:
Das Problem der Winderosion scheint fast 50 Jahre alt zu sein. In den Jahren mit weniger Niederschlägen ist es stärker vor Augen als in regenreichen Jahren. Dennoch wird wenig aus eigener Initiative dagegen gemacht. Dieses Problem betrifft zur Zeit ca. 1% der Fläche in
Fernheim. Früher wird der Prozentsatz Fläche höher gewesen sein, weil die
Kolonie insgesamt weniger Land hatte. Der vom Wind angehäufte Sand findet einen guten Markt im Bausektor, besonders bei den Dörfern in der zentralen Gegend um
Filadelfia herum. Ist Fläche wirklich so teuer im „alten Teil" der
Kolonie, dass man nicht paar Reihen Neem pflanzen oder 10 – 15 m Strauch wachsen lassen kann? Die sichtbare Winderosion besonders die Wege entlang gibt den Kolonien nach wie vor ein negatives Image und beweist, dass dieses Umweltproblem nicht unter Kontrolle ist. Es hat auch den Anschein, als wenn es den Bauern selbst nicht stört, weil heute meistens zur windreichen Zeit keine Kulturpflanzen auf den Feldern stehen. Die Hungerkultur Erdnuss bringt auf dem Restsand des Feldes dann immer noch eine gute Produktion, wenn es nur regnet. Die sachgemäße
Bodenbearbeitung auf Problemfeldern kann viel Winderosion vorbeugen, flächendeckende Bodenbedeckung ist sehr wichtig, Fruchtfolgen können einen strategischen Beitrag liefern. Wie kommt man hier der Gesetzesforderung des Dekrets 18.861 von 1986 nach? Bebauen ist 70 Jahre praktiziert worden, für das Bewahren werden noch andere Mechanismen als dieses Gesetz eingesetzt werden müssen. Bis heute ist noch keine Umweltverträglichkeitsprüfung für den laufenden Ackerbau auf Kampboden vom Umweltsekretariat verlangt worden. Noch ist kein Strafzettel für Winderosion verhängt worden. Es ist noch Zeit, um sich etwas einfallen zu lassen.
Sollte neues und angeblich letztes Ackerland in
Kultur genommen werden, wenn in 50 Jahren dem Winderosionsproblem mit dem Kampboden nicht vorgebeugt noch dieses unter Kontrolle gebracht werden konnte? „Ausgekehrt und entleert wird die Erde, ausgeraubt und ausgeplündert…" (Jesaja 24, 3a)
c) Zur Pflege der gerodeten Flächen:
Was nach der Rodung mit den Flächen zu geschehen hat, ist durch die Zielsetzung des Dekrets 18.861, darunter besonders die Vermeidung der Überweidung und Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit festgelegt. Die Bodenbedeckung hat auch hier flächendeckend einen höchst strategischen Wert, um das Produktionspotenzial zu erhalten. Wenn schon gerodet werden musste, sollte die Fläche auch auf unbestimmte Zeiten in Produktion bleiben können.
In diesem Bereich wird heute das Thema der Bäume und Sträucher in den Weiden viel diskutiert. Auch die Einseitigkeit des Gatton Panic-Grases in der Weidewirtschaft wird immer mehr hinterfragt.
d) Zur Anpassung an die Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld:
Die jüngere Generation steht heute vor einem veränderten wirtschaftlichen Umfeld. Aus dieser Generation wollen und können aber immer weniger Personen Bauern werden. Nur noch die Fähigsten und/oder Bemittelsten werden in diesem veränderten Umfeld Bauern werden. Ein Teil von ihnen erhält eine fachspezifische Ausbildung zum Bauer-Sein, in der
Landwirtschaftsschule in
Loma Plata. In den Dörfern von
Fernheim stehen Wirtschaftshöfe leer. Viel diskutiert wurde im Jahr 2001, ob die Fernheimer Wirtschaftsnorm von 250 ha, tragfähig für eine
Familie ist. Kann das Land, das urbar gemacht und gerodet wurde, überhaupt im Verhältnis zur Produktion bezahlt werden? Wie vollzieht sich der Übergang von einer Generation zur nächsten, wenn die nächste Generation das Land von der vorigen Generation nicht kaufen kann? Ist es wirtschaftlich und umweltverträglich, bei leeren Wirtschaften in den Dörfern weiter entfernt Land zum Neu-Einrichten und Roden anzubieten?
Roden ist Mode „geblieben". Können wir uns diese Mode wirklich leisten? Geht die Rechnung „Rinder mal Hektar" auch auf dem Land der vorigen Generation noch auf? Wer kann sich die fälligen Sabbatjahre leisten? Ist es sinnvoll, nach dem Prinzip zu handeln: Wollen Roden, solange es noch geht? Die Frage ist vielmehr, kann das, was gerodet wird, 200 oder 300 Jahre wirtschaftlich produktionsfähig bleiben? Viele denken dann, solange es regnet, produziert das Land. Regen ist im
Chaco eine Antwort und eine Lösung auf viele Fragen und Probleme. Also liegt der Segen in Gottes Hand.
e) Zur Einstellung gegenüber den Gesetzen, die die Landnutzung beeinflussen
Die Diskussionsprozesse, die von 1991 bis Anfang 1999 zwischen den staatlichen und mennonitischen Vertretern geführt wurden, zeigen, dass Mennoniten nicht nur geradewegs ein „Ja" zu Gesetzesbestimmungen finden, die gerade ihre tugendhafte Arbeitsamkeit und ihr Nutzungsflächen-Kapital betreffen. Sie reagieren empfindlich auf „Vorsagen" und „Vorschriften" bei eigenem (Land)Kapitaleinsatz und verabscheuen bürokratische administrative Abläufe. War die Strategie der Verhandlungen zu den Abkommen ein Zeitgewinnen-Wollen, um sich an die Inhalte der gesetzlichen Forderungen zu gewöhnen? Wollte man wirklich Sonderregelungen für die Landnutzung im
Chaco-mennonitischen Imperium haben? War es bei den offensichtlichen „Umweltsünden" berechtigt, besondere Begünstigungen im Vergleich zu anderen Landbesitzern in
Paraguay zu verlangen? Störte man sich wirklich nur an den bürokratischen administrativen und zentralisierten Abläufen? Die öffentliche Seite hat nicht nachgegeben. Die Gesetze sind für alle und für ganz
Paraguay gültig. Deshalb war das „Abkommen" nach Ablauf der Frist nicht mehr notwendig. Die Mennoniten befinden sich im Anpassungsprozess. Sie üben sich in der Einhaltung der Gesetze Nr. 422 und 294. Mit den Gesetzen 352 und 536 werden die Übungen vermutlich später anfangen, je nach Notwendigkeit oder nach Konfliktsituationen.
Seit das neue Landnutzungsverfahren in Anpassung an die nationalen Gesetze mehr ins Gerede gekommen ist, haben manche Produzenten wieder mehr Interesse für das schon gerodete und teure Land im zentralen Teil der
Kolonie gezeigt. (Land in weiteren Entfernungen ist heute zum Teil auch schon teuer und dadurch nur bedingt attraktiv.) Auf den schon gerodeten Flächen braucht man wenigstens nicht die 25%-Reserve und die breiten Schonstreifen einhalten, denken sie. Doch wer dieses Land kauft, der „übernimmt" das Defizit zum Gesetz von 1973 und die Aufgabe der 5% Aufforstung, wenn schon zuviel ausgerodet wurde. Das ist da „implizit", stillschweigend, ungeschrieben, miteinbegriffen. Die 5% Aufforstung sollte heute als ein sehr guter Kompromiss hinsichtlich der Verpflichtung zum Schutz der Natur angesehen werden, denn dann hält man immer noch 20% mehr für Weide.
Glücklicherweise sind durch die Gespräche mit der öffentlichen Seite heute schon die Aufteilung der 25%-Reserve erlaubt und das natürliche Verstrauchen-lassen wird als Wiederaufforstung zugelassen. Dadurch gibt es für diese Landeigentümer die Möglichkeit, Problemstellen in ihren Weiden durch natürliche Regeneration zum „Blanqueo" ihrer Schuld gegenüber den Forst- und Umweltgesetzen zu nutzen. Zu den Problemstellen in den Weiden werden heute die stark strauchenden Standorte gezählt, die eine teure Maschinenbearbeitung brauchen, um eine Grasproduktion zu bekommen; die sandhaltigen Flächen, auf denen das Gatton Panic nicht gut wächst. Die fehlenden Schonstreifen auf den von früher gerodeten und zu großen Flächen sollten gezielt zum Nachwachsen von Maschinenbearbeitung freigehalten werden. Alle Wegränder entlang sollte der Busch wieder durch Regeneration aufwachsen dürfen.
In den heute gültigen Gesetzen ist noch viel Spielraum für Produktionsmöglichkeiten gegeben, die noch nicht erschöpft sind. Diese sehen nicht alle so aus, wie sie heute praktiziert und üblich sind. Sie sind auch nicht alle so radikal und tiefgreifend angesetzt wie die Beispiele der bisherigen mennonitischen Arbeitsweise.
Der „
Chaco" empfindet die Mennoniten vermutlich schon einigermaßen anspruchsvoll und sehr fordernd, besonders dort wo sie nicht ein Mindestmass der im Gesetz festgelegten Spielregeln einhalten. Das nationale Forst- und Umweltgesetz ist der einzige legal anerkannte Schutzrahmen für den Lebensraum „
Chaco". Chacobewohner könnten im Blick auf die Heimat für die nächste Generation zumindest diesen Rahmen, für ihre heutigen wirtschaftlichen Tätigkeiten respektieren. Das Bild aus Jesaja 24 sollte nicht für die Landnutzung der Mennoniten-Kolonien zutreffen: 3a: „Ausgekehrt und entleert wird die Erde, ausgeraubt und ausgeplündert…"; 5b: „…denn sie haben die Gebote übertreten, die Satzungen verletzt,…".
Die biblischen und die nationalen Gesetze bieten einen Rahmen, der für den Chacobewohner eine gute Hilfe im Ausführen des biblischen Auftrages des Bebauens und Bewahrens sein kann.
Bibiographie:
Primäre Quellen:- 50 Jahre Fernheim – Ein Beitrag in der Entwicklung Paraguays. 1980. Hrsg.Kolonie Fernheim
- Peter P. Klassen. Immer kreisen die Geier. Ein Buch vom Chaco Boreal in Paraguay. 1983.
- Heinrich Dürksen. Dass du nicht vergessest der Geschichten. 1990
- Mennoblatt – Archiv, Filadelfia.
- Desarrollo Regional Integrado del Chaco Paraguayo. Paraguay-OEA, Asunción, Abril 1983.
- Perfil Ambiental del Paraguay. STP-AID, Asunción, 1985.
- Proyecto Sistema Ambiental del Chaco, Tomo I, MAG-BGR, Asunción 1998.
- Daten der Forstmappen – Bibliothek Beratungsdienst, Fernheim.
- Menno informiert, Artikel von April 1991.
- Menno aktuell, Artikel von Juni 1997.
- Informationsblatt Neuland, Artikel von Mai 1991.
- Fernheimer Informationsblatt, Juli und August 1997.
- Fernheimer Informationsblatt, Januar 1999.
- R.Goerzen, Artikel: Die produktionstechnische Entwicklung Fernheims und die Versuchstation. Juni 2000. Forstwirtschaftliche Gesetze, Umweltgesetze, Dekrete. Übersetzung, 1999.
Sekundäre Quellen:- Friesen, Martin W. Neue Heimat in der Chaco Wildnis. 1987.
- Krier, Hubert. Tapferes Paraguay. 5., überarb. u. erw. Aufl.-Tübingen, Narr, 1986.
- Ratzlaff, Gerhard. Die Ruta Transchaco
Bildmaterial:- Fotos Aéreas, 1968. Beratungsdienst Fernheim. Landbüro.
- Satellitenbilder. Beratungsdienst Fernheim. Landbüro.
- Proyecto Sistema Ambiental del Chaco, Tomo I, MAG-BGR, Asunción 1998.
- Lexikon zur Bibel, Hrsg Rienecker, Fritz. 9. Auflage, 1983. Brockhaus Verlag – Wuppertal.
- Zürcher Bibel, 1972.
Fussnoten:
| |
| P.Klassen, 1983. |
| W.Quiring, 1934. |
| R. Käthler, Informationsblatt, Juli 1997. |
| Wilhelmy und Rohmeder, 1963. |
| P. Klassen, 1983. |
| D. Sawatzky, 1991. |
| D. Sawatzky, 1991. |
| Gerhard Dyck, 1991. |
| D.Sawatzky, 1997. |
| R. Käthler, Informationsblatt 1997 |
| |
| |
| |
| H. F.Wiens, Informationsblatt, Nr.1,1999 |
| R. Käthler, Informationsblatt Nr.7,2001 |
Errungenschaften und Herausforderungen im multikulturellen Zusammenleben
Gundolf Niebuhr
Resümee
Bei ihrer Einwanderung in den paraguayischen
Chaco sahen die Russlandmennoniten sich sowohl einer feindlichen Natur als auch einer ganz unbekannten
Kultur gegenübergestellt. Die indianische Bevölkerung bestand aus nomadisierenden Gruppen von Jägern und Sammlern. Die feste religiöse und missionarische Überzeugung der Einwanderer zusammen mit ihrem Pioniergeist leitete eine lange und kontinuierliche Erfahrung des Miteinanders ein. Heute kann man, rückschauend auf gut sieben Jahrzehnte, einige Merkmale dieses Miteinanders hervorheben, die von allgemeinem Interesse sein könnten. In einem neuen Kontext der Globalisierung einerseits und der Neubelebung von kulturellen Minoritäten andrerseits ist es gewiss wichtig, über Kriterien für ein harmonisches Miteinander nachzudenken.
I. Der Chaco, unerforschtes Gebiet
Es ist ein kurioser Tatbestand der Geschichte, dass der
Chaco, sowohl der argentinische als auch der paraguayische, erst spät ins Blickfeld der Geschichte rückt, praktisch erst in der zweiten Hälfte des 19. Jh. In den achtziger Jahren fand man in
Filadelfia und in Dorf Blumental drei Münzen aus der Zeit des Kaisers Maximilian, gegen Ende des 15. Jh. Sie lagen etwa 40 cm tief in der Erde. Die Funde waren natürlich eine Sensation. Die beste Hypothese, die man aufstellen konnte, war die, dass diese Münzen mit den ersten spanischen Expeditionen mitkamen, die den
Chaco ab 1535, auf der Suche nach dem legendären Inkareich durchquerten. Die eine oder andere Gruppe dieser Abenteurer mag genau durch die Zone gezogen sein, in der später die Kolonien angelegt wurden.
Die nachfolgende Geschichte bestätigt jedoch, dass der
Chaco für jene ersten Eroberer weiter nichts war als ein großes Hindernis, welches zwischen dem Fluss und dem begehrten Gold des Inkareiches lag. Jedenfalls geriet der
Chaco weitgehend in Vergessenheit, nachdem die Schätze in Peru geplündert waren. Die kolonialen Regierungen zeigten für diesen Landstrich kein Interesse. Es war Territorium der „wilden Indianer". Außer sporadischen Strafexpeditionen gegen die kriegerischen Payaguas bestand kein Grund, westlich des Flusses den Fuß an Land zu setzen.
Erst um 1870, nach Ende des Dreibundkrieges sollte sich diese Sachlage langsam ändern. Die verarmte Nation musste sehen, Gelder in die Staatskasse zu bekommen. Große Landstriche wurden dazu verkauft, sowohl an die argentinische Firma Carlos Casado als auch an die in New York angesiedelte
Corporación Paraguaya. Missionarisch gesehen, dehnte die anglikanische Kirche ihre Arbeit im argentinischen
Chaco aus, um auch die Toba und Südlengua im paraguayischen
Chaco zu erreichen. 1889 wurde die erste permanente Station „Maklhavay" nahe beim heutigen Pozo Colorado gegründet. Gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jh. machte der bekannte Missionar W. B. Grubb seine ausgedehnten Reisen durch den südlichen
Chaco. Sein ethnographisches Werk „An unknown people in an unknown Land" wurde ein Klassiker der frühen Völkerkunde. Um ihre hundertjährige Präsenz im
Chaco zu feiern, haben die Anglikaner 1989 dieses Werk in Spanisch herausgebracht. Kurz, zu Beginn des 20. Jh. hatte der Kolonisationsprozess kaum begonnen. Die wenigen Holzfäller, Estancieros und Missionare sahen sich mit einem „unbekannten Land" konfrontiert, dessen Bevölkerung noch erst sehr spärlich bekannt war.
II. Mennonitische Kolonisation
Obwohl noch weitgehend unbekanntes Land, wurde der
Chaco zu Beginn des 20. Jh. wichtig, eben weil es genug
Land gab. 1920 sandten kanadische Mennoniten eine
Expedition aus zur Suche nach geeignetem Land für die Kolonisation. Die unterschiedlichen religiösen und kulturellen Beweggründe dazu sind anderswo festgehalten.
(3)Diese
Expedition kam zu dem Entschluss dass der zentrale
Chaco für die Landwirtschaft geeignete Böden aufwies und somit potenzielles Siedlungsland sei. Ein sehr optimistischer Bericht der
Expedition an die Auftraggeber in Kanada war dann maßgeblich bei der Entscheidung eines Teiles der dortigen Mennoniten, ihre Bauernhöfe drüben zu verkaufen und nach
Paraguay überzusiedeln. Im Jahr 1927 kam so die
Kolonie Menno zustande.
Drei Jahre später kam eine weitere Gruppe, die durch den Stalinterror in der Sowjetunion vertrieben worden war. Sie legten ihre
Kolonie,
Fernheim, westlich der
Kolonie Menno an. Die Lebensbedingungen waren noch sehr prekär, die Möglichkeit einer Kolonisation auf Dauer noch gar nicht bewiesen. Das
MCC in den USA sah sich jedoch gezwungen, dieses Siedlungsexperiment zu wagen, weil es im Moment keine andere Alternative gab. Die ursprüngliche Ausdehnung von
Menno und
Fernheim umfasste etwa 1200 qkm zwischen 59°20′- 60°10′ westlicher Länge und 22°10′- 22°30′ südlicher Breite. Hier siedelten ca. 3.700 Personen. Diese Zone war zu etwa 85% mit dem typischen Dornbusch des
Chaco bedeckt, 15% der Fläche machten die offenen Graskämpe mit ihrem sandigen Boden aus. Auf diesen wurden die Dörfer angelegt. Die Landwirtschaft der ersten Jahrzehnte beschränkte sich auch auf diese Fläche.
III. Indianische Völker im Chaco

Bei der Ankunft der Siedler war die erwähnte geographische Zone Teil der großen Jagdgründe der Nord-Lengua (
Enlhet), die, wie andere Gruppen, zur Sprachfamilie der Maskoy zählten. Niemand hat in den ersten Jahren eine Zählung unternommen. Verschiedenen Schätzungen zufolge könnten es zwischen 600-800 Personen gewesen sein, die sich, aufgeteilt in kleinen Clangruppen, auf diesem Gebiet bewegten, wie es für Jäger und Sammler üblich war. Der
Chacokrieg zwischen 1932 und 35 reduzierte diese Zahl beachtlich, vor allem durch eingeschleppte Grippe- und Pockenepidemien. Nach Kriegsende begann erneut ein langsames demographisches Wachstum.
Derselbe Krieg war auch der Anlass für die Verschiebung vieler Guaraníindianer aus der subandinen Zone Boliviens in den
Chaco. Da sie Guaraní sprachen, wurden sie pro-paraguayischer Neigungen verdächtigt und von den Bolivianern angefeindet. So wanderten verschiedene Gruppen denn langsam in den zentralen
Chaco und wurden in den und um die
Mennonitenkolonien sesshaft.
Die Nachricht von den weißen Siedlern erreichte auch
Nivaclé-Gruppen entlang des Pilcomayo. Sie lebten teils vom Fischfang, der aber nur zu einer gewissen Jahreszeit ergiebig war. Viele von ihnen fassten den Entschluss, in der an Nahrungsmitteln knappen Jahreszeit die Kolonien aufzusuchen, um als Saisonarbeiter etwas zu verdienen. Rechtzeitig für den Fischlauf waren sie dann wieder zurück am Fluss. Nach etwa 15 Jahren solch periodischer
Wanderungen, entschlossen sich viele dazu, definitiv im Gebiet der Kolonien zu bleiben, denn der Arbeitsmarkt schien eine bessere Existenz zu garantieren.
(4)
Der ganze nördliche
Chaco war das Gebiet der
Ayoreos und Chamacocos, Teil der Zamuco-Sprachfamilie. Die Kontakte mit diesen Gruppen kamen erst später zustande und waren anfänglich sehr gespannt. Von sich aus suchten sie nicht den Kontakt, aber es gab seit 1945 ein rücksichtsloses Eindringen von seiten amerikanischer Ölfirmen ins Kernstück ihrer Jagdgründe. Durch die Präsenz schwerer Maschinen sowie von Bohrtürmen, fühlten sie sich bedroht. 1946 gab es den ersten Angriff gegen einen Lkw der Bohrfirma und im Jahr darauf den ersten Angriff auf mennonitische Siedler. Im folgenden Jahrzehnt wiederholten sich solche Angriffe sporadisch. Sie richteten sich auch gegen Gruppen der Lenguaindianer, die am Nordrand der
Kolonie Fernheim lebten.
In den sechziger Jahren verlor die Tanninindustrie am Paraguayfluss zunehmend an Bedeutung. Der Transchacoweg machte den Flussverkehr für die Kolonien überflüssig, und so verloren viele dort angesiedelte Indianer ihre Arbeit. Gruppen der Toba, Sanapaná und Angaité, die am Beginn des Jahrhunderts aus dem östlichen
Chaco an den Fluss gezogen waren, begannen wieder einen Marsch landeinwärts. Obwohl sie eigenes Siedlungsland suchten, mussten viele von ihnen als Peones (Hilfsarbeiter) auf den Estancias ihren Lebensunterhalt verdienen.

Die Asphaltierung des Transchacoweges brachte eine wirtschaftliche Konsolidierung der drei Chacokolonien mit sich. Der Weg erleichterte nun auch die Erschließung großer Teile des
Chaco für die
Viehzucht. Somit haben wir während der letzten zwei Jahrzehnte ein interessantes demographisches Wachstum. Menschen aus Ostparaguay, aus Brasilien, Ausländer aus Deutschland, Schweiz oder Frankreich sind im
Chaco ansässig geworden.
Filadelfia, das Zentrum der
Kolonie Fernheim, hat zur Zeit ca. 2.700 deutschsprachige Einwohner, 2.500 Indianer und 1.300 Lateinparaguayer und Brasilianer.
Zusammenfassend, haben wir eine ziemlich kontinuierliche Zuwanderung in den zentralen
Chaco zu verzeichnen, die über Jahrzehnte die Zusammensetzung veränderte und die Anzahl der Bevölkerung wachsen ließ. Die kulturelle Vielfalt ist erstaunlich. Harald Prince, Anthropologe der Universität Kansas bemerkte bei einem Besuch vor einigen Jahren, dass man unser Bevölkerungsbild nur als bizarr bezeichnen könnte.
IV. Das Klima des Zusammenlebens
Dass es bei einer solchen kulturellen Mischung offene Fragen, gelegentlich auch Spannungen gibt, ist nicht zu vermeiden. Die vielen Touristen, welche die Kolonien besuchen, machen ihre Beobachtungen und kommentieren manchmal kritisch, manchmal lobend. Fast alle bemerken das Potenzial für Konflikte, welches, vor allem in Situationen der Wirtschaftskrise, steigen kann.
Die ganze Situation zu analysieren ist hier unmöglich.
(5)Im Folgenden möchte ich auf das Zusammenleben von Mennoniten und Indianern eingehen, um einige Kriterien für das Miteinander hervorzuheben.
Die mennonitischen Einwanderer brachten eine feste missionarische Überzeugung mit in den
Chaco. Sie brachten diese von Russland mit. Im Kontext der religiösen Neubelebung im späten 19. Jh. war das missionarische Bewusstsein gewachsen. Die katastrophalen Ereignisse nach der Revolution, die fast einem Ethnozid glichen und zu Flucht und Auflösung ihrer Kolonien in Russland führten, wurden von manchen Personen als eine Strafe Gottes angesehen, weil man in Russland selbstzufrieden gelebt hatte, ohne zu missionieren. Deshalb habe Gott sie mit so gewaltsamen Mitteln in den fernen
Chaco kommen lassen, damit sie hier ihrem Auftrag nachkommen könnten. Die Indianer andererseits, ihre neuen Nachbarn, waren noch nie mit dem Evangelium erreicht worden. Das Missionswerk hätte schon 1932 begonnen, wurde aber wegen des Krieges bis 1935 verschoben.
Der ganze Missionsprozess hatte natürlich eine komplizierte Dynamik. Hier sollen nur zwei Etappen beschrieben werden, die sich im Rückblick ausmachen lassen, und eine dritte, die sich gegenwärtig anbahnt und möglicherweise die Herausforderung der nächsten Jahre bilden wird. Selbstverständlich gibt es keine klaren Grenzen zwischen den Etappen – es sind Generalisierungen der historischen Betrachtungsweise.
Die ersten 30 Jahre waren geprägt von einer paternalistischen Missionierung, die zu der Zeit allgemein üblich war. Man gründete Missionsstationen und versuchte, die Indianer sesshaft zu machen, indem man gewisse Dienste anbot wie Gesundheit, Alphabetisierung und Beratung im Gartenbau und in der Landwirtschaft. Meist wurden die Indianer auf der Mission beschäftigt. Sie arbeiteten im Angestelltenverhältnis, selbst wenn die Arbeit auf ihrem eigenen Land durchgeführt wurde. Ein Laden mit Lebensmitteln versorgte die Mitglieder der Station, so dass die Jagdzüge überflüssig wurden. Der Missionar auf einer solchen Station war nicht nur
Prediger des Evangeliums, sondern auch Betriebsleiter, Erzieher, oft sogar Krankenpfleger.
Nach 15 Jahren der Missionsarbeit bildete sich die erste indianische
Gemeinde, deren Wachstum dann schnell weiterging. Anthropologen haben diese Phase im Rückblick als Akkulturation bezeichnet, wo die Jäger und Sammler ihren „Frieden" mit der neuen Lebenssituation schlossen. Sie akzptierten die Tatsache, dass die Weißen mit ihrer Religion offenbar dominant sein würden.
(6)
Die so bekehrten Indianer nahmen die ihnen gepredigte Botschaft in mancher Hinsicht sehr buchstäblich. „Bekehrung – Umkehr" verstanden sie als totale Verwandlung des Lebens. Logischerweise wollten sie ab jetzt so leben wie die Mennoniten, die ihnen das neue Leben gepredigt hatten. Dazu brauchten sie zuerst einmal eigenes Land, landwirtschaftliches Gerät, Beratung, Schulen und manches mehr. Diese Bedürfnisse entsprachen in Wirklichkeit ganz gut den Erwartungen der Mennoniten, denn man war ausdrücklich bestrebt, die Indianer mit Hilfe eines Entwicklungsprozesses in die nationale Gesellschaft zu integrieren. So sah es das ursprüngliche Missionsstatut vor, so hielt man es für wünschenswert und möglich. Die Arbeit des gesamten Missionswerkes wurde daraufhin umstrukturiert, um ganzheitliche Hilfe für die Entwicklung anzubieten. Die für diesen Prozess zuständige Behörde nannte sich zuerst ISB (
Indianer-Siedlungs-Behörde) dann
IBB (Indianer Beratungs Behörde) und heute
ASCIM (Asociación de Cooperación Indígena Mennonita). Zusätzlich wirken heute eine Reihe von Regierungs- und Nicht-Regierungsorganisationen an diesem Prozess mit. Informelle Hilfen, welche viele Arbeitgeber ihren Angestellten zukommen lassen, machen einen beachtlichen Teil dieser Entwicklungshilfe aus.
Dieses massive Unternehmen hat heute zu einer beeindruckenden Infrastruktur geführt. Es hat ohne Zweifel viel dazu beigetragen, das Zusammenleben friedlich zu strukturieren. Und trotzdem gibt es heute auf beiden Seiten Enttäuschungen und Ressentiments. Die Strategie der Entwicklung war vom anthropolgischen Standpunkt aus gesehen, nicht immer optimal. Das friedliche Zusammenleben hat nicht zu einer Beseitigung des Ethnozentrismus geführt. Mehr noch, das numerische Wachstum hat es neuerdings unmöglich gemacht, alle indianischen Gemeinschaften in den genannten Entwicklungsprozess einzubinden. Manche warten auch heute noch auf eigenes Land, um eine Existenzbasis aufzubauen. Offene Fragen in Bezug auf die jetzige Form der Zusammenarbeit gibt es sowohl bei Indianern als auch bei Mennoniten. Unter den Indianern, nicht nur in
Paraguay, ist ein erwachendes Interesse an ihrem Kulturerbe zu verzeichnen. Viele Gruppen fragen heute kritisch, welche Auswirkungen die ihnen angebotenen Entwicklungsprogramme auf ihre
Kultur haben. Sie verlangen mehr Beteiligung an der Konzeption und Durchführung solcher Programme. Sie möchten autonomer über die Richtung ihres kulturellen und wirtschaftlichen Wandels entscheiden. Das heutige politische Klima weltweit begünstigt die Konsolidierung von kulturellen Identitäten, obwohl bislang viele Entwicklungsansätze immer noch davon ausgehen, dass kulturelle Minderheiten in die nationale Gesellschaft integriert werden müssen. Allzu oft ist eine solche Integration für die Indianervölker aber eine Absorption gewesen, bei der sie ihre Eigenständigkeit aufgeben mussten. Alte Sitten erfahren heute jedoch wieder mehr Beachtung. Es sind z.B. auch im
Chaco gezielte Anstrengungen da, die Muttersprache zu stärken. Mit einer bewusst gesprochenen und geschriebenen Muttersprache werden eine Vielzahl kultureller Werte ihrerseits gestärkt, die schon in Vergessenheit zu geraten schienen. Diese Tendenz, an sich recht begrüßenswert, schafft eine ganz neue und herausfordernde Situation für die Chacobewohner, denn sie manifestiert auch die Unzulänglichkeit aller Entwicklungsprojekte, die zum „melting pot" hin tendierten, d. h. zur Einschmelzung kultureller Eigenart zugunsten einer mehr europäischen Gesellschaft. Da sozio-kulturelle Prozesse oft unterschwellig laufen, sind sie nicht so leicht identifizierbar. Vielen Bewohnern im
Chaco mag es daher noch nicht voll bewusst sein, dass sich eine neue soziale Konstellation bildet, die höhere Ansprüche an unser kulturelles Selbstbewusstsein sowie an die Toleranz gegenüber anderen Ethnien einfordert. Kurz gesagt, die Situation des multikulturellen Lebens lässt sich mit den herkömmlichen Entwicklungsstrategien weder ignorieren noch ausbügeln. Zu oft wird eine solche Feststellung von Seiten der dominanten Gesellschaft als ideologische Beeinflussung von außen her abgetan. Die gibt es sicher auch, aber mir scheint, dass wir es hier mit einer kulturellen Dynamik zu tun haben, die zutiefst in der menschlichen Natur wurzelt. Diese Einsicht möchte uns davor warnen, bei unseren Entwicklungsprojekten allzu naiv auf Wandel, Integration und Fortschritt zu drängen.
V. Dynamik kultureller Prozesse
In der Kulturanthropologie sind verschiedene Theorien entstanden, um die sozio-psychologische Struktur einer
Kultur zu verstehen und die Veränderungen in diesem komplizierten Gebilde zu analysieren. Besonders der Prozess der Akkulturation ist oft analysiert worden, weil gerade im amerikanischen Raum die indianischen Kulturen durch die Invasion der Europäer das Feld räumen mussten, da sie als technisch minderwertig oder unentwickelt galten. Die anthropologische Literatur zu diesem Thema ist sehr umfangreich, so dass man den „Wald vor lauter Bäumen" kaum sieht.
Die missionarische und soziale Arbeit der Mennoniten unter den Indianern wurde 1965 von dem Anthropologen Jacob Löwen bewertet. Er verbrachte sechs Monate auf dem Feld, studierte die Kulturen der
Nivaclé und
Enlhet und bot für die weitere Arbeitsweise technische Beratung an. Es gab eine prinzipielle Bereitschaft, sich differenziertere Kenntnisse anzueignen. Ab 1973 hat die
ASCIM einen Anthropologen auf vollzeitiger Basis angestellt, Wilmar Stahl, dessen Tätigkeit das gesamte Entwicklungsprogramm sensibler gemacht hat für Formen der Kommunikation, die im transkulturellen Rahmen beachtet werden wollen. Diese und ähnliche Bemühungen lassen vermuten, dass Ansätze zu einem kritischen kulturellen Selbstbewußtsein da sind, sowohl unter Mennoniten als auch bei den Indianern. Die Fähigkeit zur Kommunikation hat zweifellos auch zugenommen.
Man muss jedoch fragen, wie die größeren Kenntnisse die Struktur der Entwicklungsprojekte beeinflusst haben. Oft ist es so, dass solche Kenntnisse lediglich umgesetzt werden, um herkömmliche, auf „Integration" gerichtete Projekte „effektiver" zu machen. In manchen Fällen muss man beobachten, dass kulturelle Minderheiten dadurch noch stärker den Interessen anderer Menschengruppen ausgesetzt sind, die sie verändern wollen. Das ist sicher nicht in allen Fällen so, aber der springende Punkt, auf welchen hier verwiesen werden soll, ist der, dass die Ausrichtung bei den europäischen Einwanderern welche die Entwicklung bringen wollten, nicht die tiefgehenden Veränderungen erlebte die man hätte erwarten dürfen. Die Erwartung der mennonitischen Kolonisten (dasselbe gilt für die nationale Gesellschaft) bleibt ausdrücklich oder implizit die, dass die
Indianerkulturen ein vorübergehendes Phänomen darstellen – etwas das verschwinden wird und verschwinden muss, selbst da wo man zugibt dass sich auch positive Elemente darin finden. Man geht normalerweise davon aus, dass die
Indianerkulturen ungeeignet sind, um sich in die nationale Gesellschaft sowie in die Marktwirtschaft und in die christliche Kirche zu integrieren. Oft sind sie ausdrücklich als Hindernis gesehen worden, das man hierzu überwinden muss.
Eine berechtigte Kritik zu dieser Auffassung kommt aus dem offenbar zu beobachtenden Prozess des Kulturwandels selbst. Falls solche tiefgreifenden kulturellen Veränderungen eine natürliche Notwendigkeit wären um sich neuen Bedingungen anzupassen, wären sie möglicherweise schon vollzogen. Stattdessen beobachten wir eine ziemliche Stabilität der indianischen Kulturen und heutzutage sogar eine Neubelebung. Das dürfte es der weißen Gesellschaft nahelegen, dass Indianer mit
ihrer Kultur sehr wohl neuen Umständen begegnen können, welche das Zusammenleben heute mit sich bringt.

Die folgenden Grafiken
(7) sind gelegentlich benutzt worden um zu zeigen, wie verschiedene kulturelle Elemente in einer Gesellschaft oder einer Einzelperson verwurzelt sind.
Die Weltanschauung, die Werte, die religiösen Empfindungen bilden die tiefsten Schichten der menschlichen Psyche. Natürlich kann man von Wandel und Anpassung in jeder
Kultur sprechen. Auch die Mennoniten haben sich im Laufe der 75 Jahre in
Paraguay verändert und angepasst. Sprachlich gesehen, gibt es inzwischen viele spanische oder auch Guaraníwörter in unserem Vokabular. Manche Sitten und Werte sind aus der paraguayischen
Kultur übernommen worden. Entscheidend für den Fortbestand einer
Kultur ist, dass dieser Wandel entsprechend den eigenen Wertvorstellungen sowie aus eigenem Antrieb und eigener Entscheidung erfolgt. Dasselbe Recht steht den Indianerethnien zu. Sie haben in den letzten 100 Jahren hier im
Chaco große Flexibilität bewiesen in ihrer Anpassung an neue geographische, demographische und wirtschaftliche Gegebenheiten. Aber sie taten dies im Einklang mit ihrer Weltanschauung.
(8) Es gibt genügend Hinweise, die vermuten lassen, dass die verborgenen Dimensionen ihrer
Kultur – Werte, Weltanschauung, religiöse Vorstellungen – weitgehend unverändert geblieben sind. Und es besteht kein Grund zu der Annahme, dass sich dies in nächster Zukunft ändern wird. Außerdem wächst heute weltweit die Einsicht, dass kulturelle Vielfalt womöglich ebenso wie biologische Vielfalt wünschenswert ist, abgesehen davon, dass es zu den menschlichen Grundrechten gehört, das eigene kulturelle Erbe zu pflegen.
Projekte zur Entwicklung und zum Zusammenleben sind heute nicht nur daraufhin zu befragen, ob ihre Vorgehensweise kulturell aggressiv ist, sondern positiv gesehen, ob sie darauf zielen kulturelle Minderheiten zu stützen und möglicherweise ihr natürliches Wachstum zu fördern.
Wirtschaftlich gesprochen und auf dem Hintergrund von MERCOSUR (vielleicht ALCA) und Globalisierung gesehen, sind wir aufgefordert, die Legitimität von alternativen Wirtschaftsweisen zu respektieren. Jeder Versuch, indianische Gemeinschaften in eine Ökonomie der Produktion, Akkumulation und Spezialisierung zu katapultieren, hat sich als kulturell aggressiv erwiesen. Auch wirtschaftlich sind die Resultate meist nicht befriedigend.
Chacoindianer brauchen heute:
- Eigenes Land, das ihnen erlaubt, wenn auch in etwas reduzierter Form, etwas von den herkömmlichen Aktivitäten wie Gartenbau, Jagd oder Fischfang und Sammlung von Waldfrüchten zu realisieren. Da das Land für die weißen Einwanderer heute als Produktionspotenzial, Kapitalinvestition oder Spekulationsobjekt gilt, ist es wichtig zu bedenken, dass es für Indianer in erster Linie als Lebensraum gilt. Land zu verweigern bedeutet für sie, dem Mitmenschen das Leben vorzuenthalten. Deshalb waren sie bei der Einwanderung der Mennoniten auch zu einer großzügigen Koexistenz auf demselben Land bereit. Die Regierung verpflichtet sich zwar in der Verfassung, genügend Land sicherzustellen, aber in der Praxis sind es meist NGOs, die sich mit Hilfe internationaler Gelder darum bemühen.
- Diverse ökonomische Optionen, die sehr wohl periodische Lohnarbeit auf Estancias und Betrieben einschließen, aber auch Arbeit auf eigener Scholle, wie oben bereits erwähnt.
- Der oben beschriebene Zentralisierungsprozess, sollte nach Möglichkeit rückgängig gemacht werden, indem man dem Ballungseffekt in und um die Mennonitenkolonien entgegenwirkt, d.h. Siedlungsflächen gleichmäßiger im ganzen Chaco verteilen.
- Chacoindianer werden voraussichtlich auch weiter „kleine Produzenten" bleiben – um die heutige Terminologie zu verwenden – die aber deswegen ihre berechtigte Nische in den wachsenden Märkten brauchen, um ihre Produkte (Handarbeiten, Honig, oder evtl. biologische Erzeugnisse und Holzprodukte) absetzen zu können.
- Vor allem aber brauchen sie Anerkennung als legitime alternative Kulturen in einer globalisierten Welt, die in jeder Hinsicht das Überleben des „weniger Kompetenten" bedroht. Diversität gutheißen und die Kommunikation fördern, scheint die große Herausforderung im multikulturellen Zusammenleben zu sein,(9) sowohl im Chaco als auch in anderen ähnlichen Situationen.
Fussnoten:
| Die spanische Originalversion dieses Aufsatzes erschien im Suplemento Antropológico, Diciembre. 2001, einer Fachzeitschrift der Universidad Católica, in Asunción. |
| Theologe, gegenwärtig tätig im historischen Archiv und Museum der Kolonie Fernheim. |
| |
| Beachtliche sozio-psychologische Spannungen waren die Begleiterscheinung dieser Übergangsphase. Während der Trockenheit im Sept. 1962 gab es einen teils gewaltsamen Aufstand gegen die neuen „Patrones", und ca. 500 Personen unter dem Cacique Manuel zogen von Filadelfia Richtung Westen, wo die Regierung ihnen Gerüchten zufolge ein großes Landstück geben würde. Siehe die Berichte im Mennoblatt vom Sept. und Okt. 1962. |
| In ihrer Magisterarbeit für die Humboldt Universität, Berlin, „Cómo agua y aceite" haben Dörte Dittmer und Ulrike Fullriede die Lage in Filadelfia beschrieben. |
| Regehr, Walter: Die lebensräumliche Situation der Indianer im paraguayischen Chaco, Basel 1979, S. 259 ff. |
| Hiebert, Paul: Anthropological Insights for Missionaries, Grand Rapids 1985, SS. 31;46. |
| Siehe Wilmar Stahl in einer nicht publizierten Studie von 1982, über die Wirtschaftsformen verschiedener Gruppen der Lengua Sur im Bajo Chaco. |
| Wilmar Stahl, Vortrag auf einer Konferenz in Winnipeg, Kanada 1997, unterstreicht die Notwendigkeit von Beziehungsarbeit, die zum Ziel hat, die Toleranz und die Kommunikation zwischen den Ethnien zu fördern. |
Probleme und Chancen des interethnischen Zusammenlebens im Chaco
Jakob Warkentin
Einleitung
Indianer, Brasiliendeutsche und Lateinparaguayer sind Menschen wie du und ich. Sie haben Bedürfnisse, die befriedigt werden wollen. Sie haben Wünsche, Hoffnungen und Sehnsüchte, die nach Erfüllung rufen. Sie müssen im Leben verschiedene Rollen übernehmen: sie sind, Vater, Mutter, Arbeiter, Lohnempfänger, Jäger, Sänger, Lehrer,
Prediger, Gemeindeglied, Staatsbürger usw. Sie haben Hunger und Durst, sind gesund oder krank, schwitzen und frieren, arbeiten und feiern. Kurzum, sie sind Menschen wie du und ich. Sie sind gut und böse, sie leben vor Gott von der Vergebung wie du und ich, und sie werden von Gott ebenso geliebt wie du und ich. Sie haben ihre Geschichte, wir haben unsere Geschichte, und nun haben wir eine gemeinsame Geschichte, ob wir es wollen oder nicht.
Es ist daher gut, wenn wir uns einmal bewusst machen, wie unser Zusammenleben zustande kam, wie es sich gegenwärtig gestaltet und wie es eventuell weiter gehen könnte. Ich werde im Folgenden einige unserer Begegnungsebenen kurz charakterisieren, sie uns ins Bewusstsein rufen, damit wir dann in einem gemeinsamen Gespräch darüber und über die Möglichkeiten, wie sich unser Zusammenleben weiter gestalten könnte, sprechen können. Das Leben der anderen Ethnien im
Chaco hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte ebenso verändert wie auch das unsere. Dabei tauchen im Zusammenleben Probleme und Spannungen auf, die objektive und subjektive Gründe haben. Diese Spannungfelder ausfindig und namhaft zu machen, kann uns weiterhelfen, wenn wir bestrebt sind, unsere gemeinsame Zukunft bewusst zu gestalten.
1. Wir brauchten Arbeiter, und es kamen Menschen.
Seit der Zeit unserer Ansiedlung waren wir in
Neuland auf die Arbeitskraft der Indianer angewiesen. Da gab es zahlreiche Familien, in denen der Vater oder die erwachsenen Söhne fehlten. Frauen mit kleinen Kindern waren gezwungen, ihr Land mit Spaten und Axt von Bäumen und Sträuchern frei zu machen. Das ging meistens über ihre Kräfte. Da waren sie froh, wenn sich ein Indianer anbot, für geringes Entgelt den
Kamp zu roden und ihn so zum Pflügen vorzubereiten. Auch Zaunpfosten mussten aus dem Busch geholt, Stämme gesägt und mit dem Pferdefuhrwerk zur Sägerei gebracht werden. Später, nachdem das Land gepflügt und bepflanzt worden war, halfen Indianer – Väter, Mütter und Kinder – beim Unkrautjäten und bei der Ernte. Schließlich kam das Traktorfahren und das Viehhüten und -besorgen hinzu. Oft wurde nur die Arbeitskraft des Mannes gebraucht, die Indianerfamilie war jedoch meistens dabei, zumindest wenn es zum Essen ging. Das waren sie so gewohnt, denn der Mann brachte das, was er durch seiner Hände Arbeit erworben hatte – ursprünglich waren es vor allem Honig und Fleisch _ seiner
Frau, die das Essen zubereitete.
So kamen wir miteinander in Kontakt: die Mennoniten wandten sich an die Indianer, weil sie Arbeitskräfte brauchten, und die Indianer kamen zu den Mennoniten, weil sie Arbeit und Brot suchten. Die Ansprüche auf beiden Seiten waren zu Anfang sehr gering. Geld war oft nicht vorhanden, daher erhielten die Indianer Lebensmittel und Kleidungsstücke. Doch die Zeiten änderten sich, die Mennoniten wurden wohlhabender und die Bedüfnisse der Indianer stiegen. Dabei ging es nicht nur um die Bedürfnisse des Mannes, sondern auch um die der
Frau und der Kinder. Wohnung und Essen genügten nicht mehr. Schulbildung, Land und Berufe waren gefragt. Das stellte uns als Mennoniten vor ganz neue Aufgaben.
2. Wir missionierten Heiden, und es kamen Jäger und Sammler.
Lange vor unserer Ankunft hatten die Fernheimer eine Missionsarbeit unter den Indianern begonnen, der sich die Neuländer später anschlossen. Es ging dabei in erster Linie darum, den Indianern, die die
Bibel nicht kannten, die Frohe Botschaft des Neuen Testamentes zu predigen. Hierbei ergab sich für die Missionsarbeit eine besondere Situation dadurch, dass der Missionar nicht zu den Indianern gehen musste, sondern dass die Indianer zum Missionar kamen. Das erleichterte und erschwerte die Arbeit zugleich. Auf der einen Seite war es einfacher, die Indianer mit dem Evangelium zu erreichen, wenn sie sich in der Nähe des Missionars aufhielten; auf der anderen Seite entstand dadurch eine unbeabsichtigte Abhängigkeit der Indianer vom Missionar. Wenn viele Indianer auf einem Platz wohnten, gab die Chacolandschaft nicht mehr genügend Nahrung für alle her. Jäger und Sammler mussten nun Ackerbauern und Viehzüchter werden, wenn sie auf Dauer überleben wollten. Hinzu kam, dass durch Gesundheitsdienste und bessere Ernährung die Familien der Indianer zahlenmäßig zunahmen. Um den Bedürfnissen, die sich aus dem Nebeneinanderleben der Indianer und Mennoniten ergeben hatten, gerecht zu werden, musste nun eine Organisation gegründet werden, die bei der Landbeschaffung und bei der Sesshaftmachung sowie der Krankenbetreueung und Schulbildung eigene und Fremdmittel beschaffte und die Arbeit koordinierte. Die
ASCIM mit ihrem Mitarbeiterstab und ihrem differenzierten Arbeitsprogramm entstand.
Wir halten fest: Aus der anfänglichen Missionsarbeit erwuchs schließlich eine umfangreiche Wirtschafts- und Sozialarbeit, die sich daraus ergab, dass Jäger und Sammler sesshaft gemacht wurden. Aus einer anfänglichen kirchlichen Betreuungsarbeit der Mennoniten entstand schließlich eine soziale und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Indianern und Mennoniten, die beiden Ethnien zum Vorteil gereichte, aber auch neue Verpflichtungen mit sich brachte.
3. Wir bauten Schulen, und es kamen Menschen, die eine eigene Kultur haben.
Bei dem anfänglichen Zusammenleben zwischen Indianern und Mennoniten herrschte die Auffassung vor, dass die Mennoniten den Indianern kulturell weit überlegen waren. Die Indianer konnten ja nicht einmal schreiben und lesen. Auch ihr Gesang und ihre
Musik klangen in den Ohren der Mennoniten recht primitiv. Da die Indianer bald einige Brocken
Plattdeutsch sprachen, weil sie durch die neue Lebensweise weitgehend von den Mennoniten abhängig geworden waren, waren diese ihrerseits _ abgesehen von den Missionaren – nicht gezwungen, sich mit ihrer Sprache und
Kultur zu befassen. Schulen für die Indianer wurden daher von den Mennoniten weitgehend nach eigenen Vorstellungen eingerichtet, ohne dabei zu bedenken, dass bei den Indianern auf diese Weise notwendigerweise eine kulturelle Entfremdung einsetzen musste.
Erst Jahrzehnte später wurde durch den Einfluss von Anthropologen und Ethnologen den Mennoniten immer mehr bewusst, welchen kulturellen Wandel die Indianer durch die Missionierung und durch die Sesshaftwerdung zu durchlaufen hatten. Nun wurde mehr Gewicht auf die Zusammenarbeit und die Beachtung der indianischen
Kultur gelegt. Vieles aber, was bereits zerstört und vergessen worden war, konnte jedoch nicht mehr zurückgeholt werden. Hinzu kam, dass durch die religiös eingeschränkte Sicht der Mennoniten manche kulturellen und sozialen Leistungen der Indianer nicht gesehen oder bewusst abgewertet wurden. In den letzten Jahren gibt es aber Ansätze, das kulturelle Erbe der Indianer wiederzubeleben bzw. ihrer Geschichte und
Kultur mehr Beachtung zu schenken.
4. Wir tauften bekehrte Heiden, und es kamen Brüder und Schwestern.
Die ersten Missionare waren in erster Linie um das Seelenheil der Indianer besorgt. Sie wollten sie von ihrem Geisterglauben befreien und sie zu Jüngern Jesu Christi machen. Dabei wurde unreflektiert vorausgesetzt, dass die Indianer sich nicht nur glaubensmäßig, sondern auch sozial und kulturell den Mennoniten immer mehr anpassten, denn diese waren ja bewusst oder unbewusst das lebende Beispiel.
Als die ersten Indianer getauft worden waren, wurden die Mennoniten mit der Tatsache konfrontiert, dass sie nun braune Brüder und Schwestern gewonnen hatten. Darüber waren sie zunächst froh, denn sie freuten sich, wenn Menschen durch den biblischen Glauben vom Tod zum Leben durchgedrungen waren. Welche Auswirkungen das aber für das Zusammenleben der Mennoniten und Indianer mit sich brachte, darüber hatte man anfangs noch nicht gründlich nachgedacht.
Diese Tatsache stellt uns gegenwärtig aber immer wieder vor neue Aufgaben. Wir haben auf der einen Seite die deutsch-mennonitischen Gemeinden, auf der anderen Seite die indianisch-mennonitischen Gemeinden. Sie leben weitgehend nebeneinander. Durch einige Mitarbeiter und durch gelegentliche Missionsfeste stehen wir miteinander in Verbindung. Genügt das aber für ein brüderliches und schwesterliches Miteinander? Hier sind noch viele Überlegungen notwendig und viele Erfahrungen zu machen.
5. Gerufen und ungerufen kamen Lateinparaguayer und Deutschbrasilianer.
Die
Mennonitenkolonien im
Chaco sind im Laufe der Jahre wichtige Wirtschaftszentren geworden. Eine differenzierte Wirtschafts- und Sozialstruktur erfordert jedoch immer mehr beruflich qualifiziertes Personal. So wurden mit der Zeit immer mehr Lateinparaguayer und Deutschbrasilianer im Dienstleistungsektor der
Mennonitenkolonien eingesetzt. Auf diese Weise kamen Ärzte, Lehrer, Büroangestellte, Facharbeiter, Traktoristen, Peone, Verkäufer, Krankenschwestern usw. in unsere Kolonien. Manche wurden von den Mennoniten gerufen, andere kamen aus eigenem Antrieb, da sie Arbeit und Brot suchten.
Dieser Bevölkerungszuwachs hat, besonders in den letzten Jahren dazu geführt, dass neue Wirtschafts- und Sozialmodelle gebraucht werden, um dieser Herausforderung gerecht zu werden. Die Frage des Wohnrechts, der Krankenversorgung, der Schulbildung und des politischen Mitspracherechts sind nur einige der Fragen, die sich immer dringlicher stellen und auf die eine für alle Seiten möglichst zufriedenstellende Antwort gefunden werden muss.
Eine ganz wichtige Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist die Frage der Arbeitsbeschaffung. Wer keine Arbeit hat, kann leicht zum Bettler oder Kriminellen werden. An dieser Stelle zeigt sich sehr deutlich, dass die Mennoniten allein dieses Problem nicht lösen können. Denn bei dem Lösungsversuch gerät man ungewollt in einen Teufelskreis, der hierin besteht: Je mehr Lateinparaguayer und Deutschbrasilianer in den
Mennonitenkolonien eine zufriedenstellende Arbeit bekommen, desto mehr werden bei der wirtschaftlich schwierigen Lage im Lande von außerhalb angelockt.
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass viele der aufkommenden Probleme, die sich aus dem interethnischen Zusammenleben im
Chaco ergeben, nicht durch religiöse, wirtschaftliche oder soziale Programme allein lösbar sind. Sie verlangen nach einer politischen Lösung, die nicht von den
Mennonitenkolonien allein, sondern nur in Zusammenarbeit mit der Gobernación und der Landesregierung erarbeitet und realisiert werden kann. Das aber
macht die Sache recht kompliziert.
6. Wir waren Verfolgte und wurden Privilegierte.
Von unserer Geschichte und von unserer religiösen Erziehung her wissen wir, was es heißt, verfolgt zu werden. Wir schlagen da schnell einen Bogen, der von den verfolgten Aposteln über die
Täufer bis hin zu den Mennoniten in Russland reicht. Verfolgte sollen und werden wir als Christen in dieser Welt sein, so wird es uns von der Kanzel verkündigt. Wir können uns gut vorstellen, was es heißt, recht- und schutzlos zu sein. Da brauchen wir nur auf die Geschichte unserer Eltern in der ehemaligen Sowjetunion hinweisen.
Wenn wir die Geschichte aber genauer unter die Lupe nehmen, sind die Verfolgungen der Mennoniten keineswegs nur um ihres Glaubens willen geschehen. Da spielten wirtschaftliche, soziale, ethnische und politische Gründe ebenfalls eine wichtige Rolle. Das wird bei uns aber nicht so betont wie gerade die Verfolgung aus religiösen Gründen. Mit der Rolle eines Verfolgten können wir uns daher leicht identifizieren.
Wie steht es aber mit der Rolle der Privilegierten? Hierfür finden wir schwerlich eine biblische Begründung, wohl aber praktische Gründe. Historisch gesehen führte das Verfolgtendasein zur Begründung des Privilegiertendaseins. Mennoniten, die um ihres Glaubens willen verfolgt wurden, gelangten nur durch ein Duldungsedikt, das ihnen von wohlgesinnten Herrschern gewährt wurde, zu einem dauerhaften Wohnsitz, der eine Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg war.
Privilegien führen aber immer zu einem Sonderstatus, der sowohl im eigenen Bewusstsein als auch im Bewusstsein der sie umgebenden Bevölkerung wahrgenommen wird. Der Sonderstatus ermöglicht wirtschaftlichen Wohlstand, soziale
Gerechtigkeit und kulturellen Fortschritt innerhalb der Gemeinschaft. Er schafft ein Solidaritätsbewusstsein, das sich aber in erster Linie immer auf die eigene Gemeinschaft erstreckt. Gleichzeitig führt er zu Maßstäben, die einerseits für die eigene Gemeinschaft gelten, andererseits aber auf die sie umgebende Bevölkerung angewandt werden.
Natürlich darf nicht verschwiegen werden, dass der Fortschritt innerhalb der Gemeinschaft auch Auswirkungen auf die sie umgebenden Ethnien hat. Sie partizipieren auf die eine oder andere Weise an deren Weiterentwicklung, sind jedoch nur insoweit als Objekt oder Subjekt daran beteiligt, als es die mennonitische Gemeinschaft erlaubt. Bei gemeinsamen Projekten, die zum Wohl der die Mennoniten umgebenden Ethnien gedacht sind, sind die Mennoniten aufgrund ihres Bildungstandes, ihrer Beziehungen und ihrer Finanzen federführend.
Die Rolle der Verfolgten hat den Mennoniten viel Leid gebracht, hat aber ihre Identität gestärkt. Die Rolle der Privilegierten hat ihnen oftmals Wohlstand und Wohlergehen ermöglicht, brachte sie jedoch in religiöser Hinsicht oft in prekäre Situationen, die sie zu Konzessionen und Kompromissen zwangen und ihnen öfters ein schlechtes Gewissen verschafften. Das führte zu Überempfindlichkeiten, die immer dann zum Ausdruck kamen, wenn das Thema „Privilegien" wieder mal auf der Tagesordnung stand.
7. Wir waren Fremdlinge und wurden im neuen Land heimisch.
Als Fremdlinge kamen wir in den
Chaco, in dem die Indianer schon seit Jahrhunderten beheimatet waren. Anfänglich schien uns die Chacolandschaft feindlich gesonnen zu sein. Es gab Trockenheit und Sandstürme, Ameisen und Heuschrecken fraßen das Gepflanzte auf, das Gras war bitter und die Sträucher stachelig. Die Indianer aber waren friedlich und uns freundlich gesinnt. Mit viel Schweiß und Arbeit gelang es den Mennoniten mit Hilfe der indianischen Arbeitskraft, aus der unwirtlichen und fremden Landschaft eine Heimat zu schaffen, in der sie sich wohlfühlen und in der sie bleiben wollen.
Wir halten fest: Historisch gesehen steht fest, dass wir zu den Indianern kamen, bevor die Indianer zu uns kamen. Die Einheimischen waren und sind die Indianer und Lateinparaguayer, während wir und die Deutschbrasilianer die Fremden sind, die sich hier nun immer mehr heimisch machen. Waren es ursprünglich nur einige Mennonitendörfer, die nach und nach ihr Land einzäunten und bearbeiteten, so sind es jetzt riesige Landflächen, die von Mennoniten eingezäunt, gerodet und als Viehweide benutzt werden. Für die Indianer und Lateinparaguayer wird dadurch die Naturlandschaft, die ihnen früher kostenlos für Wohnung, Jagd und Sammeltätigkeit zur Verfügung stand, immer begrenzter. Hinzu kommt, dass durch die intensive wirtschaftliche Nutzung der bisher bestenfalls extensiv genutzten Landflächen diese kostenmäßig immer teurer für den Eigenerwerb werden. Je mehr Land die Mennoniten kaufen, desto mehr schreitet die Landspekulation fort, worunter vor allem die armen Lateinparaguayer und die Indianer zu leiden haben.
Verantwortungsbewusste Mennoniten haben sich daher schon seit vielen Jahren für die Landbeschaffung für die Indianer und für die Wirtschaftshilfe von lateinparaguayischen Kleinbauern in der Nähe der
Mennonitenkolonien eingesetzt. Das geschah aus missionarischen oder aus karitativen Gründen. Mittlerweile wird es uns aber immer mehr bewusst, dass wir diese Hilfe nicht nur um der anderen Ethnien willen, sondern auch im eigenen Interesse betreiben. Denn wir haben erkannt, dass es uns auf die Dauer im
Chaco nur dann gut gehen kann, wenn auch die anderen Ethnien in unserem Bereich mindestens das Existenzminimum haben. Da wir durch unsere Existenz im
Chaco sowie durch unsere wirtschaftliche Expansion, gewollt oder ungewollt, massiv in ihren Lebensbereich eingegriffen haben, ist es nur folgerichtig, wenn wir unseren Beitrag dazu leisten, dass sie in der neuen Situation ebenfalls ihr wirtschaftliches und kulturelles Fortkommen haben. D. h. unsere kulturelle und ökonomische Hilfe ist neben der missionarischen Tätigkeit eine unbedingte Notwendigkeit, allein schon im eigenen Interesse.
8. Wir waren Koloniebürger und wurden Staatsbürger.
Als die Mennoniten im paraguayischen
Chaco ansiedelten, hatten sie sich zum Ziel gesetzt, Kolonien mit weitgehender Selbstverwaltung zu gründen. Das war, historisch gesehen, konsequent und wirtschaftlich betrachtet sinnvoll. So lebten sie als Bürger der Kolonien
Menno,
Fernheim und
Neuland und verwendeten nicht viele Gedanken darauf, dass sich diese Kolonien in
Paraguay befanden. Sie waren staatspolitisch gesehen entweder staatenlos, kanadische oder deutsche Staatsbürger und nahmen kaum wahr, dass ihre in
Paraguay geborenen Kinder automatisch paraguayische Staatsbürger waren. Kein Wunder, dass sie sich an der
Politik im Lande nicht beteiligen wollten. In
Asunción hatten sie einen gemeinsamen Vertreter, der sich je nach Bedarf in ihrem Interesse an die jeweiligen Minister oder direkt an den Staatspräsidenten wenden konnte.
Politik war im Bewusstsein der meisten Koloniebürger ohnehin ein schmutziges Geschäft. Daher war die Frage der Wahlbeteiligung für sie kein akutes Problem, höchstens für die
Studenten, die in
Asunción studieren sollten oder wollten. Diese mussten die Frage für sich selbst lösen, und da sie in der Regel keinerlei politische Vorbildung besaßen, ist anzunehmen, dass sie sich in der Regel der herrschenden Partei anschlossen, denn auf diese Weise waren die wenigsten Schwierigkeiten auf politischer und studentischer Ebene zu erwarten.
Die „politische Unschuld" oder der „Dornröschenschlaf" der Mennoniten im paraguayischen
Chaco war jedoch mit dem politischen Umsturz im Jahre 1989 jäh zu Ende. Der oberste politische Ansprechpartner in
Asunción wurde aus dem Lande gewiesen, eine neue Verfassung in Auftrag gegeben und die Bedeutung der politischen Parteien in einen neuen Kontext gestellt. Nun setzte bei den Mennoniten plötzlich eine Neubesinnung ein, und als im Jahre 1993 nach langer Zeit der erste zivile Präsident sein Amt antrat, da hatten die Mennoniten durch ihre eigene Wahlbeteiligung einen eigenen Gobernador und einen eigenen Abgeordneten im Landesparlament.
Durch die nun verstärkt einsetzende Demokratisierung im Lande fiel den Indianern plötzlich eine neue Rolle zu. Durch ihre Dokumentenbeschaffung, bei der die Mennoniten behilflich waren, verfügten sie nun über ein wichtiges Wählerstimmenpotenzial, das sich die jeweiligen Kandidaten auf die eine oder andere Weise zu sichern suchten. Die Indianer selbst gerieten dadurch in Konflikte, da sie zwar die konkrete Hilfsbereitschaft der Kandidaten beurteilen konnten, aber nicht in der Lage waren, die politischen Machenschaften, die damit verbunden waren, zu durchschauen.
Mittlerweile sind Mennoniten und Indianer in gleicher Weise daran gewöhnt, dass sie über Wählerstimmen verfügen. Durch die politische Entwicklung in den letzten Jahren sind viele von ihnen nicht nur desillusioniert, sondern auch enttäuscht worden, so dass es verständlich ist, wenn manche von ihnen eine resignative Haltung der
Politik gegenüber eingenommen haben.
Für das interethnische Zusammenleben im
Chaco ist es aber nach wie vor wichtig, dass wir alle unser politisches Bewusstsein schärfen, kritisch die Reden und Handlungen der Politiker beurteilen, um dann dem Kandidaten unserer Wahl die Stimme zu geben. Es kommt nicht so sehr darauf an, welche Partei im Departament
Boquerón die Wahl gewinnt, wohl aber darauf, dass der Gobernador und die Junta eine Regierung darstellen, die das Wohl der Bürger im Auge hat, Recht und Gesetz achtet, keine Rassendiskrimierung betreibt und die Steuern und Gelder gewissenhaft verwaltet. Eine politische Grundbildung für alle Bewohner im Departament
Boquerón wäre eine gute Voraussetzung, um sich bewusst und gezielt an der Wahl zu beteiligen und für die Gewählten eine Hilfe bei der Wahrnehmung ihrer politischen Verantwortung.
9. Wir waren Arbeitnehmer und wurden Arbeitgeber.
Männer und Frauen, die während der Kolchoszeit in Russland Arbeitnehmer gewesen waren, kamen hier in
Paraguay, gewollt oder ungewollt, in die Rolle der Arbeitgeber. Sie, deren Eltern möglicherweise vor der Revolutionszeit noch Arbeitgeber gewesen waren, kannten ein solches Arbeitsverhältnis nur noch von den Erzählungen her. Sie selbst aber waren stets Arbeitnehmer gewesen. Nun fand ohne Vorbereitung ein Rollenwechsel statt. Sie waren faktisch Arbeitgeber der Indianer geworden. Zwar arbeiteten sie selber viel, wahrscheinlich mehr als ihre Arbeitnehmer, aber sie hatten nun zu entscheiden, ob ein Indianer Arbeit bekam, was er tun sollte und wie er es tun sollte. Die Kinder dieser Pioniergeneration wuchsen schon in dieses Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverhältnis hinein und hatte später weniger Schwierigkeiten, einen Indianer oder später einen Lateinparaguayer oder Deutschbrasilianer als Arbeitnehmer einzustellen und ihn entsprechend zu behandeln.
Patrón zu sein hat aber mehr auf sich als nur Arbeiter einzustellen und die Arbeit einzuteilen. Ein Patrón hat für seine Arbeiter auch ein hohes Maß an Verantwortung. So ist er in erster Linie mitverantwortlich für die Wohnsituation des Arbeiters und seiner
Familie. Hinzu kommt selbstverständlich die Versorgung der
Familie mit den Grundnahrungsmitteln. Später kamen noch die Sorge für die Krankenbetreuung und die Schulausbildung der Kinder hinzu. Inzwischen haben wir Organisationen geschaffen, die Teile dieser Verantwortung anstelle des Patróns übernommen haben. Es bleiben aber immer noch Lücken im Versorgungssystem. Diese werden infolge des Bevölkerungszuwachses unter den Indianern immer größer, so dass der einzelne oder die Koloniegemeinschaft zusätzlich Verantwortung zu übernehmen haben. Das betrifft beispielsweise die Mithilfe beim Schulbau, in der Krankenbehandlung und beim Schülertransport. Im Einzelfall ist es nicht einfach, eine Lösung zu finden, die alle Beteiligten zufriedenstellt.
10. Wir waren in der Minderheit und wurden im Rahmen der Mennonitenkolonien Mehrheit.
Geschichtlich betrachtet haben die Mennoniten sich größtenteils als Minderheit verstanden. Das hat ihnen manche Nachteile, aber auch manche Vorteile eingebracht. Unter den Religionsgemeinschaften während der Reformationszeit waren sie die verfolgte Minderheit. In Preußen und Russland sowie in
Paraguay, Bolivien und Mexiko waren sie eine geachtete Minderheit, die ihr Eigenleben führen konnte, ohne sich um politische Belange zu kümmern. Sie regelten ihr religiöses, soziales und wirtschaftliches Leben selber und hatten damit größtenteils Erfolg.
Hier im
Chaco ergab sich nun aber eine besondere Situation. Die
Mennonitenkolonien befanden sich in einem sehr dünn besiedelten Gebiet. Erst im Laufe der Zeit kamen immer mehr Indianer hinzu. Auf jeden Fall waren die Mennoniten im Raum ihres Siedlungsgebietes mit einem Mal die Mehrheit und hatten damit ungewollt eine Reihe von politischen Verpflichtungen zu übernehmen. Die Mennoniten waren nun für die Wege, für das Gesundheitswesen, für das Schulwesen sowie für die Ordnung und Arbeitsbeschaffung in ihrer Region verantwortlich, ganz gleich, ob sie es wollten oder nicht. Denn innerhalb der
Kolonie hatten sie eine eigene politische Ordnung geschaffen, die aber auch für die anderen Ethnien galt und auch entsprechend genutzt wurde. Das ging bald über die eigenen Kräfte. Daher waren die Mennoniten gezwungen, staatliche Organisationen um Mithilfe zu bitten. Das betraf in erster Linie die Aufrechterhaltung der Ordnung. Auf diese Weise kam zunächst die Militärpolizei, dann die Nationalpolizei in unsere Kolonien. Später kamen Antelco und Ande hinzu. Und seit mehreren Jahren haben wir jetzt sogar die Gobernación vom Departamento
Boquerón in unseren Kolonien. Eine Municipalidad in den
Mennonitenkolonien wurde anfänglich von den Mennoniten abgelehnt, wird aber inzwischen von uns immer mehr befürwortet, da wir es uns auf die Dauer nicht leisten können, Gelder in Form von Steuern und Abgaben an staatliche Behörden abzugeben, ohne sicherzustellen, dass ein Teil dieser Gelder zurückkommt und uns in die Lage versetzt, unsere gewachsenen Verpflichtungen zu erfüllen.
11. Wir werden wieder Minderheit.
Aufgrund der demographischen Veränderungen in unserem Departament, besonders im Raum der
Mennonitenkolonien, ergibt sich in letzter Zeit eine neue Situation. Die Mennoniten sind wieder dabei eine Minderheit in ihrem eigenen Einzugsbereich zu werden, denn allein die Zahl der Indianer im Umkreis der
Mennonitenkolonien ist inzwischen auf ca. 26.000 Personen angewachsen. Hinzu kommen noch die Lateinparaguayer und die Deutschbrasilianer. Für die politischen Verhältnisse in unserem Raum kann das zu Veränderungen führen, die für uns völlig fremd sind. Wenn die politische Beteiligung der Mennoniten in Zukunft nicht zunimmt, ist zu erwarten, dass in absehbarer Zeit die verantwortlichen Posten in der Gobernación und möglicherweise auch in der zu gründenden Municipalidad nicht mehr mit deutsch-mennonitischen Personen besetzt werden können. Grundsätzlich ist das auch nicht so schlimm, solange sicher gestellt ist, dass die uns vertrauten ethischen Grundsätze in der Realpolitik beachtet werden. Dazu gehört vor allem die gerechte Behandlung der Bürger und die verantwortliche Verwaltung der Gelder.
An diesem Beispiel wird uns klar, dass wir in Zukunft stärker als bisher nicht nur unsere Ethnie, sondern auch die anderen Ethnien in unserem Gebiet zu beachten haben. So ist das Recht auf einen eigenen Wohnsitz, das politische Mitspracherecht der anderen Ethnien, die Mitbeteiligung an der wirtschaftlichen Entwicklung in dieser Region in nächster Zeit auf die Tagesordnung zu bringen und es muss nach gemeinsamen Lösungen gesucht werden. Demokratische Zustände werden zum großen Teil nach dem Zahlenverhältnis der beteiligten Bürger geregelt. Daher ist es notwendig, dass hier möglichst viele Personen bildungsmäßig und berufsmäßig qualifiziert werden. Diese Aufgabe übersteigt aber die Möglichkeiten der
Mennonitenkolonien. Daher ist sie nur durch gemeinsame Anstrengungen zu lösen.
Ausblick: Intention und Funktion
Zum Schluss möchte ich noch zwei Begriffe einführen, die uns möglicherweise dabei helfen könnten, unsere Zukunftsentwicklung sachlicher und klarer zu verstehen. Es handelt sich dabei um die Begriffe „Intention" und „Funktion". Mit dem Begriff Intention bezeichnen wir die Absichten, die wir mit unseren Reden und unserem Handeln, kurz mit unserem Sein verwirklichen wollen. Unter Funktion verstehen wir die tatsächlichen Auswirkungen, die wir durch unser Sein verursachen. Intention und Funktion stehen oft im Widerstreit zueinander.
An zwei Beispielen will ich das erklären. Das eine stammt aus dem Familienbereich, das andere aus dem Bereich der
Politik. Eltern haben bei der Erziehung in der Regel das Beste für ihre Kinder im Auge. Und doch geht es dabei manchmal schief, so dass die Eltern nach einem gravierenden Fehlschlag zur niederschmetternden Erkenntnis gelangen: „Und dabei habe ich es doch so gut gemeint." Die sogenannte gute Meinung hat uns im Zusammenleben mit anderen Menschen schon oft einen bösen Streich gespielt. Offenbar haben die Eltern trotz guter Absichten im Erziehungsprozess vieles verkehrt gemacht. Natürlich will ich hier nicht ausschließen, dass Kinder sich auch dann negativ entwickeln können, wenn Eltern im Erziehungsprozess vieles richtig gemacht haben. Aber das steht hier nicht zur Debatte.
Wie sieht das nun auf politischer Ebene aus? Als die ersten Mennoniten aus Kanada in den
Chaco kamen, herrschte bei ihnen die Absicht vor, in einer abgeschiedenen Gegend das Leben nach ihren eigenen Grundsätzen führen zu können. Auch die späteren Siedler von
Fernheim und
Neuland kamen in den
Chaco, um hier ihr Leben in Frieden und Ruhe nach dem Vorbild der mennonitischen Siedlungen in Russland aufzubauen. Das war ihre Absicht.
Inzwischen wissen wir, dass die
Mennonitenkolonien wiederholt als politischer Spielball benutzt worden sind, ganz gleich, ob sie es wollten oder nicht. Für die paraguayische Regierung waren die Mennonitensiedlungen von Anfang an ein wichtiges Faustpfand in der Auseinandersetzung mit Bolivien über die politische Oberhoheit im
Chaco. Stroessner förderte die Mennoniten auf wirtschaftlichem Gebiet, nicht zuletzt auch durch den Bau der
Ruta Transchaco. Die
Mennonitenkolonien waren für ihn aber stets ein wichtiger Faktor für die Entwicklung der Chacoregion. Sie trugen dazu bei, dass internationale Gelder für Projekte im
Chaco zur Verfügung gestellt wurden und verbesserten die strategische Infrastruktur in diesem Raum erheblich, die eine wichtige Voraussetzung für die politische und militärische Beherrschung dieses großen und weitgehend unbesiedelten Raumes war.
Diese Beispiele zeigen, dass wir in Zukunft unsere eigenen Absichten mit den daraus sich ergebenden Auswirkungen besser in Einklang bringen sollten. Um das tun zu können, müssen wir in Zukunft informierter sein, über mehr Sachkenntnisse verfügen und kritischer und begründeter unsere Urteile fällen. Hinzu kommt, dass wir unser ethnozentrisches Denken verabschieden und uns den Herausforderungen einer offenen Gesellschaft unverkrampft und mutig stellen müssen. Denn der
Chaco gehört weder nur den Indianern noch den Lateinparaguyern, sondern auch den Mennoniten und den Deutschbrasilianern, d. h. uns allen, die hier wohnen, arbeiten und leben. Unsere gemeinsame Zukunft kann daher auch nur unter Beteiligung aller hier vertretenen Ethnien sinnvoll und erfolgreich geplant und gestaltet werden.
Fussnoten:
| Vortrag auf dem Gemeinschaftsseminar in Neuland am 25.8.2001 |
| |
Kulturelle Beiträge
Ein Kreuz in der Chacowildnis
Uwe Friesen, Ebenfeld
Das Pionierkreuz – Symbol für den "Verein für Geschichte und Kultur der Mennoniten in Paraguay"
Im Museum der
Kolonie Menno in
Loma Plata befindet sich ein Kreuz aus Holz, das dem Besucher beim Rundgang auffallen muss. Es ist ein Kreuz, das eine lange Geschichte und zudem symbolisch eine wichtige Bedeutung für die mennonitischen Siedler im
Chaco hat, besonders für die kanadischen Mennoniten, die 1927/28 in den paraguayischen
Chaco einwanderten.
Wie kam das Kreuz ins Museum von
Loma Plata? Eine lange Geschichte geht dem voran.
Besagtes Kreuz wurde während der
Expedition, die im Mai 1921 den
Chaco auf Siedlungsmöglichkeiten untersuchte, auf einem der offenen Graskämpe östlich vom heutigen
Filadelfia an einen großen Urundey geheftet. Es sollte ein Zeichen dafür sein, dass die für die Eingeborenen seltsame Gruppe einen wichtigen Meilenstein zur Urbarmachung des
Chaco gesetzt hatte. Eine Gruppe, die sich aus Personen verschiedener Hautfarben, Kulturen und Konfessionen zusammensetzte, und deshalb auch als charakteristisch für die wirtschaftliche und kulturelle Erschließung des
Chaco gilt.
In dem Buch „Neue Heimat in der Chacowildnis" 2. Auflage, erschienen im September 1997, beschreibt Martin W. Friesen, wie es zu diesem Kreuz kam und welche Bedeutung demselben zugemessen wurde.
Es war im Mai 1921. Seit Beginn des Monats waren die Landsuchenden in der unerforschten Chacowildnis unter Anleitung von Herrn Fred Engen unterwegs, um mögliches Siedlungsland zu finden, wo man ungestört und nach eigener Überzeugung siedeln und leben könnte, um den Glauben, die deutsche Sprache und die Traditionen der Väter und Großväter weiter ungestört zu erhalten und zu pflegen.
Der 19. Mai 1921 war der letzte Tag, an dem die Karawane westwärts zog. Immer noch war offenes Grasland _
Bittergras, das aber als solches nicht erkannt wurde _ zu finden, durchzogen von Einzelbäumen und Sträuchern. Am späten Nachmittag dieses 19. Mai meinte dann der Expeditionsführer Fred Engen, dass man genug gesehen habe und umkehren wolle. Nicht alle waren dafür, aber da Engen darauf bestehen blieb, machte man kehrt.
Etwa 8 km weiter zurück wurde das Nachtlager aufgeschlagen, und an dem Abend gab es für die Gruppe einen saftigen „Asado", der sehr gut mundete. Man hatte dazu bei den Indianern, die in dieser Zone wohnten, ein Schaf gegen ein Hemd eingetauscht. Vom Wetter wurde berichtet, dass der Himmel bewölkt war und ein leichter kühler Südwind über die öde Gegend wehte.
Zu den Ereignissen am Freitag, dem 20. Mai, lassen wir M.W. Friesen berichten:
„An diesem Tag ritten Engen, Hettmann und die vier Mennoniten um 8.00 Uhr wieder los, um noch einiges mehr in der Umgebung zu beschauen. Die Karrettenfahrer blieben mit Ochsen und Karren an der Stelle, wo alle diejenigen, die von der Hauptkarawane aus noch weiter nach Westen vorgestoßen waren, die Nacht verbracht hatten. Die sechs Männer schritten dann einen längeren Indianerpfad entlang, ihre Reitpferde an den Zügeln führend. Sie stießen dann auch auf ein Indianerlager. Die Indianer hatten hier auch einen
Brunnen ihrer Art. Drei von den Indios gingen dann mit ihnen, die Gegend zu besehen. Sie kamen wieder auf eine breite Grassavanne. Auch hier zeigten die Indianer ihnen einen
Brunnen, oder besser gesagt, eine Wasserstelle. Die Expeditionsmänner entnahmen der Zeichensprache der Indios, dass diese Wasserstelle niemals austrockne. Da sie eine gewisse Frische des Wassers festzustellen meinten, sagten sie sich, hier könne es sich um Quellwasser handeln".
Der zentrale
Chaco war zu jener Zeit noch unbekannt und unerforscht, so dass ein Vorhandensein von Quellen nicht ausgeschlossen zu sein schien. Dieses blieb unklar, bis die mennonitischen Siedler 1927/28 in dieses unerforschte, unbekannte Gebiet vordrangen und bald feststellten, dass von Quellen in dieser Gegend keine Rede sein könne. Engen kannte damals noch mehr Stellen, wo er Quellwasser vermutete. Die Siedler erlebten es dann aber 1927, wie diese „Quellen" unter ihren Händen austrockneten.
Doch zurück zu der Delegation.
Diese befand sich jetzt in dem Gebiet, in dem 1930 die Russ1änder
Fernheim gründen sollten, nicht weit von
Trébol. Um 12 Uhr legten diese sechs Männer, die zu Pferd noch weiter gen Westen geritten waren, eine Mittagspause ein. Herr José Casado hatte ein Symbol aus Holz anfertigen lassen, eigens für den Zweck, es am westlichsten Punkt, den die
Expedition erreichen würde, an einen Baum zu heften. Diese Männer hatten es bei sich, und sie einigten sich, es gerade hier, wo sie jetzt waren, an einen hohen, gegabelten Urundeybaum zu heften. Es war ein Kreuz mit einer Mondsichel darüber. Dieses Symbol wurde später dort von Fernheimern entdeckt und heruntergenommen. Heute ist es in
Loma Plata, im Museum, zu sehen. Die Gravierungen, die es trägt, sind heute kaum zu erkennen: „McR – CASADO – FE – CH – ME – XX – V- XXI". Die Zeichen sind wie folgt zu verstehen: „McR=McRoberts, FE=Fred Engen, CH=Carlos Hettmann, ME=Mennonitische
Expedition, XX – V _ XXI = 20. Mai 1921.
Aber ehe sie sich dann wieder für den Ritt zurück zur Karawane aufmachten, gedachten sie noch in schwungvollen und in wohl auch bewegten Reden der bedeutungsvollen Mission, die mit dem Vordringen in diese unerforschte, große Wildnis, die in einem unheimlichen Schweigen dalag, verbunden war. Herr Engen pries den Mut, den die mennonitischen Delegierten gezeigt hatten, so tief in dieses weltferne Gebiet vorzustoßen. Er gab zu verstehen, dass die Teilnehmer dieser
Expedition wahrscheinlich die ersten Weißen seien, die ihren Fuß auf dieses Gebiet gesetzt hätten. Wenn Engen mit der Geschichte Südamerikas bzw. Paraguays gut vertraut gewesen wäre, dann hätte er noch hinzufügen müssen, dass die Spanier im 16. Jahrhundert vielleicht hier auch schon vorbeigekommen sein könnten, als sie vom Paraguayfluss aus durch den
Gran Chaco Boreal nach Westen, auf dem Wege zum Goldland Perú gezogen waren.
Engen unterstrich die Bedeutung des Symbols, das sie hier, hoch an einem Baum, in geheimnisumwitterter Wildnis, zurückließen. Er sprach von dem Kreuz, dem Symbol des Christentums, und, dass sie die ersten seien, die es hier jetzt aufgestellt hätten. Damit sollte gesagt werden, dass das Zeichen für den Einzug des Christentums in diese weltvergessene Busch- und Grasöde jetzt gesetzt sei. Die Mondsichel, führte er weiter aus, bedeute, als zunehmender Mond (wiewohl sie umgekehrt über das obere Ende des Holzkreuzes gestülpt war), den Anfang des Einzugs der Zivilisation in dieses unwirtliche Naturgebiet. Dieses schlichte Symbol sollte ein Zeugnis dafür sein, dass sie – diese
Expedition – als untersuchungsbeauftragte Gruppe bis hierher gekommen war. Die Männer glaubten, mit der Erkundung dieses Gebietes eine wunderbare Entdeckung gemacht zu haben. Es schien ihnen ein Gebiet zu sein, in dem es möglich sein würde, im Zeichen des Friedens auch die Entwicklung eines materiellen Wohlstandes zu erreichen.
So wurde jene Mittagsrast dort unter einem großen Baum, an den man dieses vielsagende Symbol befestigt hatte, zu einem historischen Ereignis, einem Ereignis von weitgehender und weittragender Bedeutung. Und das nicht nur für die kanadischen Mennoniten, sondern weit darüber hinaus für viele verfolgte und fliehende Glaubensbrüder und _schwestern aus verschiedenen Teilen der Welt.
Weiter nimmt Friesen bezug auf die sonderbare Zusammensetzung der Delegation, welche diesen symbolischen Akt durchführte und das Kreuz an den Urundey heftete und besondere Beachtung verdient:
„Angefertigt war es nämlich in Puerto Casado von Menschen katholischen Glaubens, mitgenommen und angeheftet wurde es von Mitgliedern der protestantischen Konfession und von Mennoniten. Grundsätzlich gehören die Mennoniten ja zum protestantischen Lager. Sie wurden aber vor einigen Jahrhunderten von den anderen Protestanten nicht weniger verfolgt als von den Katholiken. Sie wurden also von beiden nicht anerkannt. Beide sahen die Mennoniten als eine schädliche Sekte an. Jetzt aber bestand keine besondere Spannung mehr zwischen ihnen und den anderen. Man kann an diesem Ereignis feststellen, welche Gemeinsamkeit in der kulturellen Erschließung des
Chaco an den Tag trat.
Nach jener bewegten Besinnung unter dem Urundeybaum in weltverlassener Busch- und Savannenöde, machten die sechs Männer sich wieder auf und ritten zurück zu den zwei Karretten und deren Besatzung. Zusammen begaben sie sich dann zu dem übrigen Teil der Expeditionskarawane, wo auch die zwei Mennoniten schon auf ihre Kollegen warteten.
Nun waren sie wieder alle zusammen auf Km 300, einem Ort, der später unter der Bezeichnung
Km 216 bekannt wurde. Er lag in der Nähe des späteren Mennodorfes Chortitz. An diesem Abend gab es eine besondere Mahlzeit. Man hatte sich von den Indios wieder Schafe eingehandelt, und nun wurde ein „Guiso", ein landestypisches paraguayisches Gericht, zubereitet. Es wird auf verschiedene Arten bereitet. Hier war es Reisbrei mit Schaffleisch. Im Tagebuch unserer Männer findet man, dass es sehr gut geschmeckt hat."
56 Jahre später: Die
Kolonie Menno, von mennonitischen Einwanderern kanadischer Herkunft gegründet, feiert sein 50-jähriges Bestehen. Auf dem offiziellen Festakt, wo Glückwünsche von den Gästen an die Siedlung überbracht wurden, gab die Verwaltung der Nachbarkolonie
Fernheim dieses geschichtsträchtige Kreuz an
Menno „zurück". Peter P. Klassen schreibt dazu in einem Brief am 25. April 2003: „Der Bauer in Kleefeld, auf dessen Acker der Urundey mit dem Kreuz stand, fällte den Baum und heftete das Kreuz an seinen Hausgiebel. – Nikolai Siemens, Schriftleiter des Mennoblattes, war damals Lehrer in Kleefeld. Er sah das Kreuz, erkannte den Wert und nahm es mit. Lange blieb es dann im Haus der
Familie Siemens, bis
Fernheim ein kleines Museum eröffnete. Dort wurde das Kreuz dann aufbewahrt. Die Fernheimer Kolonieverwaltung beschloss dann (auf meinen Vorschlag),
Menno das Kreuz anlässlich des Jubiläums zu überreichen. Wir ließen damals auch das Kästchen dafür herstellen."
Welche Stationen dieses Kreuz gemacht hat, beschreibt auch
Frau Frieda Siemens Käthler im
Mennoblatt Nr. 13 vom 1. Juli 1988 Seite 5. Da dieses Dokument Einzelheiten über den Zug des Pionierkreuzes bringt, soll es hier für sich sprechen:
„Da sah ichs wieder im
Mennoblatt Nr. 10. _ Sehr interessant fand ich die Geschichte der Entstehung des Kreuzes. _ Wie bekannt dieses wertvolle Holz für mich ist! Es gehört zu meiner Kindheit; denn es begleitete uns durch Jahrzehnte. Erst stand es in unserm engen Eßzimmer in Friedensruh, das auch als Setzstube und Druckerei dienen mußte, und es wurde von einer Ecke in die andere geschoben, wenn Raum fehlte. Später stand das Kreuz in
Filadelfia in dem ersten Druckereizimmer am Westende unseres Wohnhauses und nachher in der Druckerei unter dem Schuppen im südlichen Teil unseres Hofes.
Hätte mein Vater mit seiner Liebe und seinem Sinn für Geschichte dieses wertvolle Andenken nicht gerettet, es wäre längst verbrannt oder vermodert. Hier ist seine Geschichte:
Unser Vater, Nikolai Siemens, war 1931 und 1932 Lehrer im Dorf Kleefeld. Eines Tages besuchte er den Bauern Abram Sawatzky am Ende des Dorfes. Auf dem Bauernhof wurden gerade Urundey-Bäume, die sich hier in Mengen befanden, gefällt. An einem dieser Bäume hing das Kreuz. _ Vater, der den Wert erkannte, nahm es zu sich und brachte es mit nach Friedensruh, wo wir wohnten.
Als wir dann im Jahre 1934 _ Vater war Schriftleiter des Mennoblattes _ nach
Filadelfia zogen, kam das Kreuz mit. Hier fand es auf engem Raum immer Platz, und es gehörte einfach zu unserem Haushalt.-
Schon lange hatte Papa für ein Museum plädiert. Für das 25jährige
Jubiläum Fernheims war es dann endlich so weit, daß ein bescheidenes kleines Museum eingerichtet wurde. Nun gab mein Vater das uns liebgewordene Kreuz her. _ Nach 22 weiteren Jahren schenkte
Fernheim es der
Kolonie Menno, wohin es eigentlich gehörte."
Jetzt hat das Kreuz der Pioniere seine Runde abgeschlossen und steht im Museum in
Loma Plata. Es erinnert daran, dass einmal Landsucher da waren, die hier das „verheißene Land" fanden, wo man als mennonitische Volksgruppe siedeln könne, und dessen Ruf viele folgten. Dem Zeugnis dieser
Expedition ist es also zu verdanken, dass im Nachhinein Tausende deutschstämmige Mennoniten aus Nordamerika, Europa und Asien, angetrieben durch verschiedene Motive, einwanderten, siedelten und eine neue Heimat fanden.
Daut Tjrietz enne Wildnis
Rodney Harder, 6. Kurs, Colegio Secundario Loma Plata Maun schreef daut Joha 1921
Aus maun em
Chaco sach dee eschte Mennonite.
Se were de eschte witte Mensche en disem Laund.
Daut waut eant hia bejeajend, kunne see nich bejriepe.
Brüne Mensche – dee jreene Hall, aules wea onbekaunt.
Aus Teatjen, daut see were bott hia jekome,
Honge see een Tjriez aum Urunde´y.
Doa bowe ha wie eene Enschreft jefunge.
Jeschrewe steiht doa: XX-V-XXI.
Dit wea daut Dotem woa de eschte Mennonite em
Chaco jedrunge.
Dit Tjriez hant lota dee Fernheima vom Boom jenohme,
gaunz sorjfältig habe see daut oppbewoaht.
Bot daut 50 johasche
Jubiläum von’e
Menno–
Kolonie jekome,
dann word daut Tjriez ewa dee Wastjrenz tridjekoat.
Dit Jeschentj wea ons wetvolla aus aullahaund hochbeenschet Jeschrie.
Vondoag wann wie länjst de Hauptgaus foahre,
seh wi bim Museum een Tjriez aunjeschloage.
Vel to weinig es daut, waut wie ons bewusst woare,
Daut wie unja dit Tjriez habe vele Pioniere too bekloage.
Oppausse sull wie, daut wie dit Eben-Ezer nich vedoawe.
Jaguasch en aundere Tiere
Uwe Friesen, Ebenfeld
Daut wea em Winta aun’e ´97. Wie wulle aus Familje uck mol eenen Ausflug moake. Rüt üt dee Kot! Bloos so, om eenmol dee Maltjtjrese en Schrugge to vejete en ons to entspaune, daut heet, aun gaunz waut aundred dentje, en wann aun waut onneedjet.
So moak wie ons oppem Wach no Sastre, eenem tjlienen oolen Stautje aum Paraguayfluss. Dee Reis jintj derch Paulemtjamp en eensume Pikadasch em Bosch. Lange Enja weare doa mo twee schmaule Jleise, wiels sich doahan mau selten een Struckneaja vebistad, en daut noch meistens mau to Ried oda met een Peadsfoahtig. Oba wie fuahre jnietsch en kaume no atlich Stunde Foaht dee rund 260 km ewa dee Rund en aum Fluss aun.
Fe eenen Chaqueño, dee mau mea Stoff en Noadstorm jewant es, op jiedem Faul en siene Omjeajend tjeenen Fluss finjt, es aul mau daut aum grooten Stroom senne ewawältjend. So uck fea ons.
Wie schloage onse beid Zelte opp, woa wie mett onse veja Tjinja unjakrüpe kunne. Dann muak wie ons oppem Wach, daut tjliene, meist gaunz velotne Stautje, waut welns eenmol een Stautje wea, üttoforsche. Doabie foll mank dee vele Esels en Mulasch, dee doa oppe Gaus romstunde ooda daut weinje Graus aufgnaubade, nuscht dolla opp aus wie. Wiels wie soone Blausjesechta weare, foll wie ewa aulles opp, on doano seha tjijte dee Lied uck, dee noch den Moot jehaut haude, hia wohne too bliewe, nohdem de ole Taninfebritj ver atelje Joahre eare Deare ve emma dicht jemoakt haud. Nü vesochte disse weltvelotne Mensche ea Lewe jratstendeels met Fesche en Jeajre to meistre. See scheene daut han to tjrieje. So worde ons uck von dee „Arnt" oole Fesch en Jirtelschwien aunjebode. Wie lehnde heeflich auf, wiels wie ons derch den Aunbletj von dee Tiere nicht den Appetit aunreaje kunne….
Den Oowend en de Nacht vebrocht wie unja Vollmond aum wundaboaren Paraguayfluss. Nich mol dee Esels en dee vele Hunj kunne ons vom Schlop stere. Aum neachsten Dach, no eene meddelmäßje Flussfoaht opp en olet Boot, daut jieda Tiet unjaducke wull _ so scheen ons daut wenichstens _ moak wie ons oppe Reis no hüs. Nicht to lot, wiels wie wada so fief Stund unjaweajes senne wurde, länjs dee Jleise derche Stap.
Aus wie so de twe Striepe noduckade en schockelde en doavon noch en bet schleeprich worde, ropt miene Olle gaunz platzlich: „Heeja, doa veare enne Jleise beweacht sich waut." Soo wea daut. Daut musste Schwien senne; en dee Jedanke aun eenen scheenen Brode leet mie daut Wota em Mul toopranne. Etj hild aun en sed: „Fru, du woascht foahre, gaunz langsaum, en etj woa mi hinje op dem Enjenbrat hanstalle tom scheete."
Jesacht, jedone. Langsaum nodad wie ons dem dunklen Hüpe doa enne Jleis. Gaunz opjerecht en voll konzentret tjijt etj no veare en hopt, daut wie dicht jenoach kome wurde, om met dee Schrootflint han to retje…
Heeja, nü scheet mol, sonst jeiht ons dee brode noch veloare! Etj doaf oba nich bosja foahre, wiels hee gaunz entschiede too mie sed, eha hee no hinje jintj: „Frü, dü foahscht gaunz langsaum noda. En mau tjeene Faxe doabie!" Etj haud vestone…
Langsaumtjes nodad etj mi nü de dunkle Plack dort ver ons. Daut Tetjen, schwind noda too foahre, wea daut Jedonna von dee Schrootflint. Wan Schwien opschratje, ranne dee leicht derchenaunda, en doabie kunn wie vleicht sogoa meeja aus eene Sej tjrieje…
Etj zield gaunz konzentreat opp daut dunkle Plaktje doa ver ons enne Jleis. Wiels dee Sonn so von veare dacht, kunn etj nich goot seene, en uck daut langsaume Jeschockel vom Auto hindad mie doaraun, secha min Ziel schmock doa no veare to rechte. En dann met eenmol, aus wie aul zimlich dicht bie weare, moak mien Hoat eenen grooten Sprung. Daut es je en Jaguar, en dee licht doa en wacht doarop, daut etj am eent jew. Met eenmol stead mi tjeene Sonn meha. Bloos nü deep derchodme en aufdretje. Dan stund dee Kaut uck noch opp, en wea mi voll ütjeleewat…
Dee Grausstrampels, meetalang, vedajte mine Secht toom deel, aus etj platzlich sach, daut jan Jeschnees doa ver ons sitj beweajd. Ne oba! Etj schrock üt mine Ewalajunge opp, aus etj sach, daut doa veare tjeene schwoate Schwien loosrebausselde. Mei Goms, daut es je en Bunta – en, en Jaguar. Sogoa biem Dentje stottad etj, soo opjereacht wea etj met eenem Schlag. Schwind scheete, daut docht etj, en drejt uck kratjt so schwind opem Gaspedal – ohne daut etj docht. Von Faxe moake oda nich haud etj gaunz vejeti. Etj nodad mie dem bunten Best, daut langsaum oppjestone wea en nü gauns jemietlich nom Bosch to jintj. Seeha vefeat haud´a sich nich, aus´a ons enword. Opa jesteat haud wie am aul. En de Schoss? Woarom donnat daut nich mol bowa mie? Heeja, nü scheet mol, docht etj, sonst jeiht din Lewensdroom, eenen grooten Kota too scheete, vea emma veloare! Etj nodad en nodad mie, en nuscht passead. Tjeen Jedonna. Tjeene Stemm von Hinje. Nuscht.
Woarom bloos nicht, dentj etj, en hool mol aun, om too tjitje, waut loos es. En mine Oppreajnis haud etj so haustich jebramst, daut dee Stoff langsaum ewa daut Auto trock en mi de Secht no veare en no dee Siede vespoad. Schwind tetjt etj dee Dea op en sach no, woarom min Ola nicht losjelajcht haud.
Langsaum trock dann de Stoffwoltj ewa dee Koa en de Pikada en doamet word uck Kloarheit jeschauft ewa de gaunze Onkloarheit. Vedutzt kaum mine Olle üt dee Koa rüt en roopt: „Obraum, waut es, woarom gaufs den Bunten nich eent! Dee wea je so dicht bi!"
Jo, waut sull aul senne, docht etj, en saul etj saje daut eha dämlichet Jefoah mi von min Jeajajletj aufjebrocht haut, en daut dann, aus etj zield en aufdretje wull, gaunz platzlich ver mie de bleiwa Himmel ewa trock en etj moajt, daut etj lang oppem Ridje enn’e Jleis lach en no dee Sonn zield…? Ne, nich nü, en so boascht etj vedrisslich: „Jo, woarom ejentlich nich? Oba wo sull etj aul scheete, wann etj weajen din schoseljet Jefoah em Stoff lidj!" Etj faucht ea aun aus en dolla bunta Kota. En dem Momment, aus etj bi eha aunkaum en dann sach, daut se gaunz veleaje word, wiel see mi min Jeajajletj vedorwe haud, kaum daut bunte Tiea wada oppem Wach nopp. Schwind scheete!, docht etj, zield kort en drejt auf. Aulles bleef stell. Bloos dee Jaguar haut sitj ditmol soo veschrocke aus´a ons sach, daut hee met eenem Sprung em Bosch en wach wea. En nü stallt etj faust, daut etj bi dee gaunze opreajnis uck gaunz doavon vejeti haud, en mine ole Twalw eenen Schoss unja to brinje.
Aus dit aules auftrock, en dee Fred tweschen ons aul wada en ütsecht wea, roopt ons Älsta op eenmol von hinje enne Koa: „Woarom foah wie nich meha, sent wie aul tus?" Daut wea wi je noch nich, on soo sad wie ons stell em Auto nen en foahre de ewaje Stratj stell en fredlich no Hüs.
Dee Schwiensjacht
Eene woahre Jeschicht, met dee Nomes veändat, jeschrewe von Mathiola Peetasch, 7C, Colegio Loma Plata Fraunz Waull en Jakob kaume eenes Doages no earem Chef, Dooft Brün, en sede, see muchte mol oppe Jacht gohne. See haude noch niemols Schwien jeschote enn uck nich mol von dicht bi jesehne.
Fraunz wea een gooda Jeaja, en doaweajens wulle dee Junges habe, daut Fraunz met eant toop oppe Jacht riede sull. Fraunz deed daut uck jearen. See sodelde sitj jieda een Pead en dann reede se enne Stap nen. Daut wea Sinnoowend en kolda Siedwind. Se kaume loot en meed trij en haude doch tjeene Schwien jeschote.
Foatz aum neachsten Dach, daut wea Sinndach, jintj Fraunz wada no Dooft Brünne, woa dee Junges ahm dann wada froage: „West dü wada met ons toop oppe Jacht riede?" Fraunz wull vondoag nich, he haud tjeene Lost, oba dee Junges jeewe nich so schwind opp. Beant boot Fraunz aun, uck sien Pead to sodle, he bruckt mau blooß metriede. Dann deed Fraunz daut doch.
En nü aum Sindach haude see meeha Jletj. See reede eascht derch eenen Bosch en kaume dann op eenen tlienen opnen Kaump. See haude noch twee Jeajahunj met. De duckte op eenmol eare Schnütze rauf en wach were se. Dann sed Fraunz: „Junges, nü woa ji boolt Schwien sehne, nu well wie onse Pead hia lote, onse Flinte nehme en sehne, daut wie oppe Beem nop kome.
Daut died uck nich lang, dann kaume dee Hunj aunjerand en dee Head Schwien hinjaraun. Beand, Isaak en Jakob were dann aul gaunz schwind oppe Beem. Fraunz wea en oola Jeaja, en nuscht pord ahm. He moak langsaum sine Flint reed, en aus dee Schwien tjeeme, funk hee tjeenen paussenden Boom tom nopklautre. So musst hee op een leajet Struck nopstaupe. Von doa schoot Fraunz een Schwien doot, en dann, aus hee schwind omlode wull, wea de Petron en de Flint faust jeblewe. Fraunz sed gaunz lüd to de Junges, de von oppe Beem en Jeblooa moake: „Nu sied mol ruaich!" Dann schetjt Fraunz de Hunj wach, en de Schwien jinje uck.
Schwind socht he sitj eenen Stock en stuckst de Petron utem Loop rüt. Aus daut jejlejt haud, bald he selfst so aus dee Hunj, en de Schwien kaume wada tridj. Fraunz schoot noch eenmol en poa Schwien doot. Uck Beand haud ditmol noch eent jeschote.
Dann lode se de Schwien oppe Schrugge nop en reede no Hus.
Das weinende Gürteltier
Robert Ketcham
Die alten
Ayoreos sagten: Der Jaguar war früher ein Mensch. Stark und stolz ging der Jaguar durch den Chacobusch und ließ alle Tiere wissen, dass ihn niemand besiegen könnte. Er schrie immer wieder, dass er der Größte und Mächtigste sei im ganzen Land, und alle Tiere glaubten ihm.
Die alten
Ayoreos sagten: Das Gürteltier war früher ein kleiner Mensch. Eines Tages begegneten sich der Jaguar und das Gürteltier auf einem kleinen
Kamp. Der Jaguar machte dem Gürteltier verständlich, dass es ihm immer zu gehorchen habe. Das Gürteltier war damit einverstanden, dachte aber bei sich, das mächtige Tier möchte ich doch noch etwas ärgern, und sprach: „Lieber Herr Jaguar, ich respektiere dich als das stärkste aller Tiere in unserem Gebiet, aber weißt du, seit heute früh habe ich solche Schmerzen im Bauch, kannst du mir nicht helfen? Ach, meine Schmerzen, mein Bauch!"
Das Gürteltier legte sich auf den Rücken, der Jaguar untersuchte es, drückte dabei seine Nase fest auf den Bauch des Gürteltiers und seine Schnurrhaare kitzelten das Gürteltier. Es krümmte sich vor Lachen und klemmte seinen Panzer dabei fest in die Nase des Jaguars. Es ließ nicht los.
Der Jaguar schrie vor Schmerzen, lief im Kreis herum und bat das Gürteltier, doch seine Nase nicht zu zerdrücken. Schließlich gab der Jaguar den Kampf auf, setzte sich und weinte und bettelte um seine Freiheit.
Endlich ließ das Gürteltier sich bereden und machte sich von der blutenden Nase des Jaguars frei.
Dann kamen viele Tiere auf den
Kamp und freuten sich, dass das kleine Gürteltier den großen Jaguar zum Weinen gebracht hatte. Die Tiere sagten dem Jaguar: „Du bist nicht der Mächtigste, du bist auch nicht unbesiegbar".
Fussnoten:
| Sage der Ayoreoindianer, nacherzählt von Missionar Robert Ketcham. |
Als der Zug zu den Guaná kam
von Hans Krieg
Am Rande des graugrünen Buschwaldes hockt ein brauner Fleck. Es ist ein Guaná-Indianer. Er heißt Ichmagkeinfett.
Ichmagkeinfett ist eifrig damit beschäftigt zu denken. Denken ist schwere, schwere Arbeit für arme Buschindianer. Aber denken, auch denken ist zuweilen nötig. War es früher auch nötig? Wer weiß das! Jedenfalls ist es heutzutage nötig. Denn seit man die kleine
Schmalspurbahn gebaut hat, vom Paraguayfluss ganz einfach in den
Chaco hinein, seither weiß man oft nicht so ohne weiteres, was man tun soll.
Indianer sind nicht dumm und nicht gescheit. Sie sind schlau. Aber was nützt alle Schlauheit, wenn da plötzlich etwas ist in der Welt, was vorher nicht da war? Wenn da plötzlich eine
Eisenbahn ist?
Die Schienen und die Bahn, das ist eigentlich das wenigste. Die Schienen gehen gerade durch den Wald und die Savannen und führen auf Dämmen durch die Sümpfe. Man gewöhnt sich daran, wie die Pampastrauße und die Mähnenwölfe und die Füchse und Wildkatzen sich daran gewöhnen. Und die pfeifenden, rasselnden kleinen Züge, die zweimal in der Woche hier vorbeikommen, die sind auch nicht schlimm. Aber da steckt noch irgend etwas dahinter, das man nicht benennen kann, eine vage, süße Lockung und zugleich etwas namenlos Entsetzliches wie Lebensgefahr oder Waldbrand oder Geisterbosheit.
Weiße und halbweiße Cristianos sind ins Land gekommen. Sie hauen Bäume um und zermahlen vorne am Fluss in großen rauchenden Häusern das Holz und machen einen Brei aus der Kraft des Holzes und schicken ihn fort in Säcken, den Fluss hinunter. Aber auch das ist wieder nicht das Wesentliche, nein, sondern das Westliche ist eben, daß die Cristianos da sind und so tun, als seien sie immer dagewesen. Aber früher gab es hier nur Sanapaná und Angaité und Guaná, die nach Norden mit den Tschamakoko und nach Westen und Süden manchmal auch mit den Lengua und Toba Krieg führten. Auch untereinander hatten sie manchmal Mißhelligkeiten wegen der Wasserstellen und Jagdgründe. Aber das war alles einfach und klar, und es war gar nichts Unverständliches dabei.
Die Cristianos haben Messer und Gewehre und Revolver. Sie haben komplizierte Kleider aus dünnen Geweben. Sie haben viel Tabak, viele Rinder, Pferde, Ziegen, und ihre Hunde sind größer als die Indianerhunde. Manche Cristianos sind große Herren, die schreien, und die andern arbeiten dann für sie. Arbeiten …. das ist auch so etwas Neues. Sie sammeln nicht Algarroboschoten und Chañarfrüchte, suchen nicht Straußeneier und Gürteltiere; sie jagen wohl manchmal Hirsche und Wildschweine, aber nicht, um ihr Fleisch zu essen und ihre Häute als Lendenschürzen und Matten zu benutzen. Sie singen nicht, wie die Indianer singen. Sie trinken nicht aus Kürbisschalen Algarrobobier und Chañarbier aus hohlen Bäumen, sondern Zuckerrohrschnaps aus Flaschen. Einmal sind sie lustig und geben den armen Indianern Schnaps und alte Kleider. Dann wieder sind sie böse, und man weiß nicht weshalb.
Ichmagkeinfett ist hungrig und vom Denken müde. Heute oder morgen muß der Zug vorbeikommen. Dann will er hinübergehen zum Stationsrancho und warten. Manchmal gibt ihm jemand Schnaps für Felle oder Bogen und Pfeile oder schenkt ihm einen alten Hut oder eine alte Hose. Manchmal lachen sie ihn nur aus oder fluchen ihn an; aber es zieht ihn hierher von Zeit zu Zeit, hierher, wo diese reichen, glücklichen Cristianos sind, die so viele schöne Dinge haben, die ein armer Indianer nicht hat. Wenn man sie töten könnte und alles wegnehmen! Aber sein Vater hat das tun wollen, der Große Papagei, und da haben sie ihn totgeschossen samt seinem Bruder und dem Bruder seiner Mutter.
Ichmagkeinfett ist nicht schlauer noch tüchtiger oder schöner als andere Guaná. Aber er ist einer, dem keine fehlt von den Eigenschaften eines schlechten und rechten Indios: er findet den verschossenen Pfeil im Gebüsch, sieht die Schlange im Loch, hört das feinste Rascheln des schlüpfenden Spießhirsches. Nie verliert er die Richtung im Wald, und das Feuer wittert er weithin. Und wenn es gilt, eine Botschaft zu bringen zu einer andern der wandernden Sippen, dann rennt er stundenlang durch Busch und Prärie und stachligen Caraguatal und findet sicher die Spuren seiner Freunde. Und wenn die Samen des Algarrobo reif sind und man Bier daraus
macht, dann ist er ein guter, lauter und ausdauernder Vorsänger beim Saufgelage der Männer. „Ho, hoh, ho", singt er dann, daß es weithin dröhnt, und schwingt den Rasselkürbis im Takt seines wippenden Tanzes.
Und heute hockt er hier am Waldrand, zum drittenmal schon seit der letzte Regen fiel, und wartet, wartet auf den Zug. Neben sich hat er drei graue, kleinfleckige Buschkatzenfelle ausgebreitet und das schöne kettenfleckige Fell eines Ozelotkaters. Er hat sie neben sich hingelegt und hübsch glattgestrichen, daß die Menschen an der Bahnlinie nicht wieder die Nase rümpfen über die schäbigen Felle und sie ihm wegnehmen ohne Entgelt. So ungefähr zehn Schritt hinter sich, gut versteckt in einem langstachligen Vinalbusch, liegt sein einfacher Holzbogen mit der Sehne aus gedrehter roher Hirschhaut und daneben ein Bündel Jagdpfeile aus Rohr mit langen Hartholzspitzen. Vielleicht gibt ihm heute einer ein Messer für die Felle oder eine halbe Flasche Schnaps. Ach, wie herrlich es ist es, ein Messer zu haben, und wie unbeschreiblich schön ist das Glück des Zuckerrohrschnapses!
Ein Pfiff tönte weit im Westen. Das war der Zug. Es klang ganz anders als der Lockpfiff der schwarzen Urubitingabussarde am Sumpfrand, eher wie der ferne Ruf des Mähnenwolfes, der eine Wölfin sucht und den die Sehnsucht treibt, zu rufen: Uaah…uaah….
Der Indianer wurde unruhig. Er fuhr noch einmal mit der Hand über die glänzenden Katzenfelle, ehe er sie zusammenrollte und aufstand. Dann ging er mit seinen leichten, lockeren Schritten hinüber, wo die kleine Blockhütte stand, an welcher der Zug zu halten pflegte. Amadeo, der Mischling, der Wildschweinjäger, wohnte dort und tat den kümmerlichen Dienst des Streckenwärters. Auch er hatte den fernen Pfiff gehört und schichtete jetzt eifrig die großen Holzscheite neben dem Geleise auf. Dieses Holz bekam der Zug zu fressen. Ohne Holz konnte der Zug ja nicht fahren und nicht pfeifen. Amadeo hätte Zeit genug gehabt, die Scheite in aller Ruhe schon gestern bereitzulegen. Aber er tut alles erst hastig, im letzten Augenblick.
Ichmagkeinfett war ganz gut bekannt mit Amadeo. Aber er beneidete ihn und haßte ihn sogar ein wenig; beneidete ihn, wie er alle Mischlinge beneidete, die sich als Weiße, als Cristianos betrachteten, haßte ihn, weil er – ebenfalls wie alle Mischlinge – gegen die Indianer mit despotischer Anmaßung auftrat.
Aber der Haß hatte noch einen andern Grund, der schwer zu erklären war. Amadeo war vor zwei Jahren allein hierher gekommen, als die Bahn gebaut wurde. Und weil Amadeo keine
Frau hatte, wollte er vom „Weißen Haarschopf", dem Unterhäuptling der Guaná und Führer der Sippe, mit aller Gewalt ein Mädchen einhandeln. Er hatte dem „Weißen Haarschopf" ein altes Maultier und ziemlich viel Schnaps dafür geboten, aber der Handel war damals nicht zustande gekommen. Amadeo hatte dann einmal eine
Frau der Sippe mit Gewalt genommen. Es war ihm auch gelungen, sie ein paar Monate bei sich zu halten. Die Indianer waren damals sehr erbittert auf ihn gewesen, hatten es aber nicht gewagt, etwas gegen ihn zu tun. Die Sache hatte sich bald dadurch erledigt, daß die „Lockende Drossel" ihm ausgerissen war.
Es wäre damals schön gewesen, ihm einen Denkzettel zu geben, aber was sollte man machen gegen einen solch mächtigen Mann, der vielleicht die Milicos, die Soldaten, herbeiholte, indem er einfach in die Wand neben der Haustür hineinrief, einen Mann der vielleicht ein guter Freund des großen Don José war, dem alle Häuser vorne am Fluß gehörten und alles Land und vielleicht die ganze Welt? Was, ihr Guten, wollte man machen?
Amadeo war schlechter Laune. Er wir immer schlechter Laune, wenn er arbeiten mußte.
„Komm her", brüllte er den Indio an, „und hilf, statt dumm zu glotzen!" – Der Indianer half ihm stumm, das Holz zu schichten.
Dann kam plötzlich der Zug, fauchte, ratterte und stand. Laute Menschen wimmelten heraus, fünf, zehn, viele.
Ichmagkeinfett war glücklich. Er hatte ein Wasserglas voll billigen jungen Zuckerrohrschnapses zu trinken bekommen, von Amadeo, und ein Beamter des Tanninwerkes, der mit dem Zug von einer Holzschlagstelle aus dem Innern kam, hatte ihm seine Felle abgehandelt um einen königlichen Preis: Eine Machete, ein Buschmesser, steckte jetzt in der Hüftbinde des glücklichen Indianers. Was tat es, daß die Machete schartig war und keine Spitze mehr hatte? Sie war ja noch zu vielem gut, und wer sie hatte, der gewann Ansehen unter seinesgleichen.
Unter dem Busch, in dem sein Bogen und seine Pfeile steckten, schlief der Indianer eine Nacht und einen Tag und noch eine Nacht. Denn der Schnaps hatte ihn bald lahm und hundemüde gemacht. Dann weckte ihn der Hunger. Mit leisem Geschwindschritt ging er eilig durch den Wald und suchte seine Sippe. Eine kleine Schlange, die er unterwegs mit dem Bogen totschlug, aß er im Gehen. Er konnte es kaum erwarten, den Seinen dieses herrliche Buschmesser zu zeigen. Beneiden würden sie ihn, ha, und auch eins haben wollen.
Ein Jahr ist um, kein kurzes rasches Jahr. Draußen in der Welt ist vieles geschrieben, geschrieben und gedruckt worden in diesem Jahr. Aber wenig ist wirklich geschehen. Fast nichts. Der Karren der Zeit ist ein wenig weitergelaufen. Ein paar verdammt feine neue Maschinen hat man erfunden, ein paar hundert Rekorde aufgestellt.
Die kleine
Eisenbahn läuft immer noch zweimal pro Woche in den
Chaco hinein und zweimal zurück. An der kleinen Station tut immer noch Amadeo, der Mischling, seinen kümmerlichen Dienst.
Aber er ist nicht mehr allein. Er hat eine Indianerin bei sich in der Hütte, und es wird nicht mehr lange dauern, dann wird sie ein Kind von ihm haben. Er ist ein großer Herr geworden und hat Helfer genug zum Fällen der Bäume und zum Herrichten des Holzes für die Lokomotive. Denn am Waldrand drüben, wo Ichmagkeinfett früher saß und auf den Zug wartete und sein Hirn ihm platzte vor lauter Denken, an diesem Waldrand stehen seit Monaten schon die grasgedeckten Hütten seiner Sippe.
Reichtum ist eingezogen. Mindestens einmal in jeder Woche liegen die Männer besoffen im Busch. Sie alle haben Messer, und viele haben eine alte Hose oder wenigstens eine Unterhose. Der „Weiße Haarschopf" trägt sogar einen alten Uniformrock über der nackten Haut, und Amadeo hat ihm eine Winchesterbüchse und zehn Patronen versprochen als Gegenleistung für das Weib, das die Sippe ihm geschickt hat.
Nur die alten Frauen schimpfen. Natürlich, sie haben ja nicht Teil am Schnaps und auch nicht an den mancherlei Geschenken, welche die Cristianos den jungen Weibern bringen für ihre Bereitwilligkeit: Galletas (Hartbrot), Charqui (Trockenfleisch) und manchmal auch Geld. Die Holzfäller, die Bahnarbeiter und auch ganz richtige Weiße vom Flußufer kommen nicht selten hierher, um sich bei den Indios einen lustigen Tag zu machen. Und unter ihnen ist besonders einer, ein feiner Mann mit hellen Haaren und roten Backen, der bringt viel Schnaps und bunte Tücher und gibt den Weibern auch Geld, damit sie sich von ihm ohne Hüftschurz fotografieren lassen.
Aber trotz allem Glück ist da so manches, was einen nicht froh werden läßt. Oder ist es vielleicht ein Spaß für die Männer, ihre Weiber und ihre Geliebten in den Armen dieser übelriechenden Fremdlinge zu sehen? Manchmal blicken sie finster und tuscheln miteinander und hecken Pläne aus gegen die Weißen. Aber dann kommt wieder diese jähe Sehnsucht über sie nach Cañaschnaps und wildem Vergessen. Dann will der eine Messer, jener Tabak und ein dritter einen alten Hut, und alle Bedenken werden beiseite geschoben.
Aber da ist noch etwas anderes: die Weiber sind krank geworden von den Weißen, und sie wiederum haben die Männer krank gemacht. Man nimmt es zwar nicht allzu ernst, nicht viel ernster als die Kleiderläuse, die mit den Weißen und ihren alten Fetzen gekommen sind und die den lieben altgewohnten indianischen Kopfläusen an Lästigkeit entschieden über sind.
Die Männer sind faul geworden und untüchtig zur Jagd. Sie basteln schundige Bogen und miserable Pfeile, um sie den Weißen zu verkaufen, die mit ihren Indianerwaffen prahlen wollen, wenn sie vielleicht einmal rasch nach
Asunción oder
Buenos Aires reisen. Aber auf solchen Handel folgt immer nur wieder Faulheit und Betrunkenheit und Weibergeschimpf. „Wovon sollen wir leben?" schreien die alten Weiber. „Schafft Fleisch und Kürbisse und Straußeneier herbei, daß wir zu essen haben! Seht ihr nicht, wie eure Kinder aufgetriebene Bäuche bekommen vor Hunger, und wie sie hinsterben? Seht ihr nicht, daß eure Weiber sich abmühen, Nahrung zu schaffen? Aber die Strünke der Caraguatá geben keine Kraft, und was die Cristianos uns geben, das reicht nicht aus. „Auf, ihr Männer, schießt wieder Wildschweine", schreien die alten Weiber, „fangt wieder Gürteltiere, stehlt wieder Kälber und Ziegen, daß eure Weiber und Kinder zu essen haben!"
„Finster blicken dann die Männer der Guaná und murren. Aber manchmal denken sie auch, daß es wahr ist, was die alten Frauen sagen, spüren vielleicht, daß dieses Glück der Weißen kein rechtes Glück ist. Daß irgend etwas Entsetzliches über sie gekommen ist, das sie lähmt und verdirbt.
Manchmal hocken sie beisammen und sprechen davon mit kargen, leisen Worten. Aber es ist, als duckten sie die Köpfe. Sie finden nicht mehr zurück.
Wie die Pfefferfresser sind sie und die Wildtauben. Die fliegen in die Pflanzungen der Weißen, weil dort süße Früchte sind. Dort lauert der Tod. Und doch fliegen immer wieder Scharen zu den süßen Früchten.
Fussnoten:
| Auszug aus: „Begegnungen mit Tieren und Menschen" Verl. Paul Parey, Hamburg Berlin 1965. |
Die Indianerin Lena
Paulhans Klassen
Wenn im Frühjahr wenig Regen fällt, dann sind die Algarroboschoten gut, lang, glatt und enthalten viel Zucker, für die Indianer eine nahrhafte Speise.
Lena, die zum Stamm der Lenguas gehörte, nahm ihre große Tasche, schlug das Tragband über die Stirn und ging mit einigen Frauen ihrer Sippe auf die Suche nach Algorroboschoten. Sollte das Sammeln heute ergiebig sein, dann hätten die Frauen noch ein gutes Stück Arbeit vor sich: Für ihre Männer von den zuckerhaltigen Schoten die Chicha zu brauen.
Der uralte Algarrobobaum mit knorriger Rinde, der schon viele Jahrzehnte gute Schoten getragen hatte, war nicht weit vom Dorf der Lenguas entfernt. Schwüle Tage und warme Nächte, ein Regen mit Blitzen und Donnerschlägen hatten Millionen Insekten, Frösche und Eidechsen vom langen Winterschlaf aus der Erde getrieben, und die Schlangen auch.
In ihrer Trägheit war eine Klapperschlange in der letzten Nacht nicht gut vorangekommen, der Schlaf saß noch in ihren Gliedern. Deshalb blieb sie im trocknen Laub versteckt unter den stachligen Blättern der Bromelien, für einen Tag, träumend, beobachtend, was um sie herum unter dem alten Algarrobobaum geschah.
Lena und die Lenguafrauen, die mit ihr gingen, freuten sich. Kichernd gingen sie im Gänsemarsch den engen Pfad durch den Busch zu dem uralten Algarrobobaum. In der letzen Nacht hatte der Wind die gelben Früchte auf die Erde geworfen. In großer Menge bedeckten sie das dürre Laub. Die Frauen sammelten fleißig, langten mit ihren Händen weit unter das dornige Gestrüpp und unter die Bromelien.
Das fröhliche Geplauder der Frauen, das Knacken der brüchigen, trockenen Ästchen und die schwüle Luft hatten die Klapperschlange wach werden lassen. Lena beugte ich, schob mit der Hand ein Häufchen Laub zur Seite, faßte die Schote. – Dann schrie sie, wie man in ihrer Sippe vor Angst und Schmerz schreit. Die Klapperschlange hatte ihre Giftzähne in ihre Hand geschlagen. Lena rieb die Bißwunde mit den Fingern, spuckte immer wieder auf die Blutflecken, saugte mit dem Mund an der Wunde, um den Schmerz zu lindern.
Alle Frauen liefen ins Dorf zurück. Lena setzte sich in ihre Hütte und kühlte die verwundete Hand im Wasser, aber das Fieber stieg von Stunde zu Stunde. Hilflos saßen die Frauen um Lena herum, die große Giftmenge der Klapperschlange wirkte schnell, und als ihr Man abends von der Arbeit nach Hause kam war sie bewußtlos. Sie starb in derselben Nacht.
Durch Urwald und Kamp (600km mit Maultieren.)
Schon lange hatte ich in mir den Wunsch gehegt, näher mit dem südlichen bzw. südöstlichen Chacogebiet bekannt zu werden. Vor 10 Jahren wurde es mir vom damaligen parag. Oberkommando der Wehrmacht im parag. – boliv. Kriege gestattet, bis an den Pilcomayostrom (Grenze zwischen
Paraguay und Argentinien) zu reisen, was mir damals großes Vergnügen bereitete. Ich hatte auf jener Reise auch die Gelegenheit, durch das Gebiet der drei großen Indianerstämme Chulupes, Tobas und Matacos zu reisen und wurde für kurze Zeit auch freundlich aufgenommen auf der Mission der deutschen katholischen Patres zu Esteros.
Nun war ich immer auch interessiert, einmal die Gebiete der anglikanischen Mission unter Lenguas und Sanapanas kennen zu lernen. Manche unserer Leute und auch unsere Missionare waren dort schon Gäste gewesen. Da auch unser Arzt, Dr. J. Schmidt, ähnliche Pläne hatte, so rüsteten wir beide zur Reise, denn Dr. Schmidt hatte nach längerer anstrengender Arbeit einmal einen Urlaub nötig. Durch neue Pflichten, die Missionar Giesbrecht erwachsen waren, mußte er davon abstehen, unser Führer zu sein. Freundlicherweise aber stellten die Brüder der Mission uns einen Federwagen (Buggy) sowie ein Pferd und Maultier zur Verfügung. Mit diesem Gespann sollte es uns vergönnt sein, rund 600 km durch
Kamp und Busch zu reisen durch sehr interessante Gebiete des
Gran Chaco von
Paraguay.
So „starteten" wir denn am 4. Sept. von unserer Missionsstation.
Frau Dr. Schmidt und die andern Missionsgeschwister umstanden den Wagen, nachdem in recht mütterlicher Weise alles schön verstaut war, nämlich der Vorratskasten, in welchem Brot, Zwieback, Eier, Zitronen, Zucker, Kakao, Kaffee, Yerba, Konserven u. drgl. gute Dinge sich befanden, ferner dann Decken, Kissen, Mückennetz und ein gemeinsamer Koffer mit Wäsche und Reserveanzügen. Aber auch väterlicherweise hatte man an alles gedacht wie z.B. an die übliche leinenumzogene „Caramayola" (Feldflasche), außerdem an eine „domojvana" (Korbflasche) für 20 l. Trinkwasser durch Trockengebiete. Ferner eine Zeltplane, eine Dose mit Wagenschmiere, einen Kochpott, Wassereimer, Axt, Zange, Eisendraht, Kafirrispen, etwas Erdnußstroh und Riemen waren nicht vergessen, und das war so ungefähr alles. Außerdem führte Dr. Schmidt noch einen Photoapparat und eine Jagdflinte mit Patronen mit sich, wie auch Schlangenserum und andere Kleinigkeiten.
Begleitet von vielen Segenswünschen ging’s denn los in östlicher Richtung zunächst. Nach guten 3 Stunden bei ziemlich hoher Temperatur erreichten wir Isla – Poi, die Militärviehstation. Hier wurden wir im Hause des Chauffeurs, dessen
Frau unlängst Patient von Dr. Schmidt war, nicht ohne Abendbrot vorbeigelassen. Nachdem auch unsere Tiere getränkt waren, ging es weiter. Da, halt! – Ein Reifen war locker geworden und rollte gemächlich vom Damm. Erstes Pech, aber dennoch ganz zeitgemäß hier in diesem Gebiet, wo der Schaden auszubessern ist. Mit vielem Klopfen gelang es uns, ihn fast auf das Rad zurückzubekommen. Nachdem er dann gut mit unserm Reserveriemen umwickelt war, konnte es doch Schritt für Schritt weitergehen, bis wir kurz vor Mitternacht das Gehöft von Freund H. Töws in Waldheim erreichten. Hier wurden unsere Tiere an die Krippe und wir ins Bett gebracht; denn die freundliche Wirtin und ihre Töchter erlaubten es durchaus nicht, daß wir auf dem Hofe unter freiem Himmel schlafen sollten.
Morgens, (5. Sept.) während wir ein sehr treffliches Frühstück einnahmen, hatte der Dorfschmied das Rad in Ordnung gebracht. Unsere Reise ging nun zunächst über Bergtal, und dann, nach einer kleinen Irrfahrt, kamen wir auf der mennonitischen
Viehstation „Laguna Kapitan" an, wo wir Rast machten.
Gegen Abend brachen wir auf und erreichten zur Nacht die Fernheimer
Kolonie–
Viehstation „Laguna Ipuna", die von den Gebrüdern G. und H. Martens verwaltet wird. Freundlicherweise wurde uns hier gegen unser Pferd ein Maultier eingetauscht, was auch wirklich gut war.
Morgens (6. Sept) schlägt der Wind um nach Süden. Nach guter Nachtruhe und kräftigem Frühstück traben wir lustig weiter. Wir erreichen um die Mittagszeit „Campo Luque", wo heute Freund W. Dück seinen Wohnsitz hat. Unsere Tiere kommen an den Trog, und wir werden zur Hühnersuppe geladen. Freund Dück spendet uns für die Reise noch einen Sack Kafirrispen und gute Bataten.
Nun geht die Reise weiter durch lange, trockene
Salzlagunen. Das Wetter ist angenehm kühl, und ein feiner Nieselregen sprüht über das Land, so daß wir unsere Mäntel hervorholen müssen. Fast hat man den Eindruck, während die Räder durch die blendend weiße Ablagerung der Salztäler knirschen, im Schnee zu fahren.
Gegen die Vesperzeit erreichen wir einen großen
Kamp, und bald halten wir auf der Estancia von Freund Rudolf Linnert. „Campo Maria" hat man diesen Ort genannt. Die Anlage ist fein gewählt. Ein schöner See mit vielen Vögeln. Hier wurde ein gemütliches Häuschen gebaut und der Hof angelegt. Wir wollten hier eigentlich nur unsere Mulas tränken, nach dem Wege fragen, und dann weiter reisen. Aber so etwas gibt’s gar nicht. Ehe wir uns versehen, sind die Pferde ausgespannt. Wir müssen hier über Nacht bleiben, um uns morgen die „Markation" anzusehen.
Nun denn, so müssen wir uns ins Unvermeidliche fügen. Der Wirt hat auf seinem Hof das Kommando. Es sieht hier eigentlich auch nach Leben aus. Ein ganz großer Korral aus Palmstämmen, unruhige Rinder, böse Stiere, die jeder für sich die Herrschaft beanspruchen und mit drohender Haltung ihrem Rivalen gegenüberstehen, die Erde mit den Vorderfüßen zu Staub aufwirbelnd, wobei sie wütend brüllen. Die Herde sieht gutgenährt aus; denn Hoch- und Niederkamp nebeneinander mit guten Süßwasserlagunen wie hier, sind treffliche Bedingungen für den Viehzüchter. Heute ist „
Rodeo", also der Tag, wo möglichst alles Vieh eingetrieben wird, was übrigens bei kühlem Wetter nicht so ganz einfach ist, da das Vieh sich nun in den schützenden Busch verkriecht vor dem rauhen Pampero (Südwind). 16 Mennoniten sind hierher gekommen; meist sind es Besitzer des hier eingedungenen Viehs aus
Menno und
Fernheim. An 1200 Kopf werden heute auf Campo Maria geweidet; davon gehört nur der kleinere Teil Herrn Linnert. Auch einige mennonitische „Mumkis" sind mit ihren Gatten mitgekommen, um als rechte Wirtinnen ihre Kühe und Kälber selber zu sehen. Die Tanten werden aber auch in diesen Tagen reichlich Gelegenheit haben, der fleißigen
Frau Linnert zur Hand zu sein bei der Bewirtung der vielen Gäste. Heute morgen wurde eine fette Kuh geschlachtet, und in der Küche kocht und brodelt es nur so. Die Bewirtung ist äußerst gut. Neben reichlichem Fleisch gibt es da auch Bataten, Sauerkohl, Tomaten, Zwiebeln, Butter, Milch, Kaffee, Tee und Gebäck. Niemand bleibt hier hungrig.
Der dunkle, kühle Abend findet die Gesellschaft in traulicher Runde um ein wohliges Palosantofeuer auf dem Hofe. Mate kreist, und Erlebnisse werden zum Besten gegeben. Endlich sucht jeder sein Plätzchen für die Nacht auf. Wohnstuben, Eßzimmer, Küche und Gänge werden „belegt", da draußen ein Unwetter aufzuziehen scheint. Es gibt nachts auch Gewitter mit kleinem Regen, der den Staub etwas niederschlägt.
Der frühe 7. September findet die Gesellschaft wieder beim heißen Mate. Nach dem Frühstück besteigen mehrere Reiter ihre Pferde. Hei, wie die Lassos durch die Luft schwirren! Ein Brüllen und Fauchen seitens der Rinder, ein Pfeifen und Johlen der Menschen! Anders kann es wohl bei der Markation nicht zugehen. Jemand führt die Liste. Im Feuer nebenan liegen die verschiedenen Brennmarken. Auch mehrere Indianerjungen sind tapfer dabei. Die Tiere, die entweder Brennzeichen oder Ohrschnitt erhielten, oder die jungen Stiere, die kastriert wurden, sind nun frei. Hier kann man sich üben im Lassieren, aber auch im Klettern, denn ein Tier, welches alle drei Prozeduren durchmachen muß, ist, wenn es endlich aus der nicht gerade sanften Behandlung loskommt, bereit, den ersten besten seiner Peiniger auf die Hörner zu nehmen. Geschickt wird dann ausgewichen und der Korral erklettert, um so der Rache des Gereizten zu entkommen. Das aber sind alles Momentsachen.
Dr. Schmidt und ich reparieren etwas an unserm Geschirr und schmieren unsern Wagen. Dann wird zu Mittag gespeist. Obzwar man uns für eine weitere Nacht nötigt, müssen wir doch jetzt aufbrechen. Uns gefällt dieses Anwesen sehr. Es ist erstaunlich, wenn man bedenkt, daß Herr Linnert vor etwa 8 Jahren zurück aus Polen hier ankam. Während dieser Zeit gründete er zuerst Laguna Ipuna, welches dann
Fernheim als Kolonieviehstation kaufte. Dieser Platz hier wurde vor weniger als 4 Jahren besiedelt. Es herrscht hier Ordnung und Sauberkeit, denn auch die tapfere
Frau Linnert weiß überall anzupacken und scheut sich vor keiner Arbeit. Allerdings sagte mir einmal der energische Herr Linnert, daß er Raubbau mit seiner Gesundheit treibe, und jedenfalls darf man nicht sehr oft solchen Wechsel mit Plätzen durchmachen.
Wir verabschiedeten uns in Dankbarkeit von unsern freundlichen Gastgebern und eilen weiter. Hinten im Wagen liegt noch ein tüchtiges Stück Rindfleisch, welches die Hausfrau mitschickt für den nächsten Nachbar, die
Familie Joh. Derksen. Diese gute Sitte herrscht hierzulande, daß man sich in dieser Wiese gegenseitig erfreut.
Bald erscheinen auch die ersten Palmen. Immer herrscht hier aber der Algarrobo vor. Wir kreuzen etliche trockene Salzbäche. Zuletzt fahren wir durch den jetzt trockenen „Riacho Yacare" (Krokodilenbach), und bald befinden wir uns nun auf einem
Kamp mit 2 einsamen Höfen. Der Ort führt den Namen „Laguna Verde" (grüner See). Hier wohnen seit weniger als 2 Jahren die Familien Joh. Derksen und Wolf. Sie wanderten 1937 von
Fernheim aus in die Gegend von Concepcion, von wo sie zurückkehrten nach hier. Man erzielte in diesem Jahre eine gute Ernte. Hauptsächlich besteht aber ihre Habe in Rindvieh. Dieser Ort ist nur etwa 60 km von der Pinaskobahn (Km 92) entfernt. Hier kann man auch gut Eier, Butter und Käse absetzen. Im Winter ist der Weg auch trocken, aber in der Regenzeit meist unpassierbar.
Das Gehöft von Freund Derksen ist gelegen an einer heute trockenen Laguna auf einer Anhöhe unter einer ganz sonderbaren Baumgruppe, wie man sie selten findet. Friedlich wachsen hier auf engem Raum zusammengedrängt wilde Kirschbäume, Flaschenbäume, Algarrobo, gelbe Quebracho, Palosanto und andere Gebüsche. Die Häuser sind noch nicht ganz fertig. Über den Betten hängen die unentbehrlichen Moskitonetze, denn, wie man uns erzählt, wird das Ungeziefer hier zur Regenzeit besonders schlimm. Dies gilt auch von den kleinen lästigen Polvorinos, vor denen man sich nur unter ganz dichtem Gewebe schützen kann. Doch in dieser Nacht müssen wir uns gehörig in dicke Wolldecken einhüllen, da das Thermometer bis zum Gefrierpunkt sinkt. Dann gibt’s auch kein Ungeziefer. Auch bei Derksens war die Aufnahme warm und gut.
Nach dem Frühstück am 8. Sept. geht es nun los in südlicher Richtung. Uns begleitet der Sohn des Hauses eine Wegstrecke, bis wir an den trockenen „Riacho González" kommen. Dann fahren wir allein weiter. Der Weg ist streckenweise ganz tadellos und hart. Der niedere Busch weist meistens Gestrüpp auf, das nur noch im Salzboden wächst. Jetzt verlassen wir das Gebiet, wo die letzten Mennoniten wohnen.
Bald tauchen vor uns weite Palmenkämpe auf. Hohe, schlanke Stämme, auf denen in sonniger Luft die majestätischen Kronen sich wiegen, wobei auch im leisesten Winde die sonderbaren Wedel zauberhaft flattern. Mir kommt ein Sinnspruch der Wüstenaraber bezüglich der Dattelpalme ein, welcher lautet: „Diese Königin der Oase taucht ihren Fuß in Wasser und ihr Haupt in Feuer des Himmels".
Jetzt erscheint vor uns ein einsamer Hof. Freundlich tritt uns ein hochgewachsener Mann, der Verwalter der
Viehstation des Herrn Arias, entgegen und begrüßt uns mit echt paraguayischer Höflichkeit. Wir wollten eigentlich weiter fahren, nur möchten wir um einen wegkundigen Indianer bitten und um genügend Trinkwasser, da vor uns eine längere Strecke lauter trockene Lagunen sein sollen. Der Indianer wird uns zugesagt, da es so Landessitte ist, daß man immer einem Fremdling den Wegweiser gern mitgibt. Aber wir dürfen doch nicht weiterreisen, ohne zuvor bewirtet zu werden. Heute morgen war ein fettes Rind geschlachtet worden. Bald schmort ein saftiger Braten („asado") am Spieß. Es gibt gute Galleten dazu und aufgekochte Milch. Der Verwalter und Herr Arias wundern sich nur, wie wenig wir vom Asado nehmen. Doch dieser ist wirklich gut und schmackhaft.
Nun ist auch unser Führer reisefertig. Es ist ein älterer Halbblinder Häuptling, „Cazice Montinyo" aus dem Stamme der hier wohnenden Sanapana-Indianer, die in der Sprache den Lenguas verwandt sind. Unsere Gastgeber lassen uns nicht fahren, ohne daß wir für die Reise noch ein tüchtiges Stück Fleisch zum „asado" mitnehmen. An der Laguna tränken wir unsere Tiere und nehmen auch unser Gefäß voll Wasser. Dann traben wir mutig weiter. Zunächst leitete uns eine Spur des hier unlängst durchgefahrenen Missionskarren. Dank des Südwindes ist es nicht heiß, und so reisen wir bis 3:30 Uhr nachmittags. Nun machen wir halt unter einem schattigen Algarrobo. Die Weide ist hier gut. Unser Häuptling schürt das Feuer. Er steckt Fleisch an den Spieß und backt uns Süßkartoffeln in der Glut. Wir trinken noch Kaffee dazu und sind dann wieder unterwegs, nachdem auch unsere Tiere noch etwas Wasser aus der Flasche erhielten. Unser Vorsatz ist es, heute noch die erste Missionsstation („Mission chica" oder auch „Campo Flores" genannt) zu erreichen.
Die Sonne neigt sich zum Untergange. Lauter Wildnis! Niemand wohnt hier mehr. Dort sehen wir ein verlassenes Indianerlager. Wohl infolge der Dürre und des Wassermangels haben die Wilden jetzt diesen Platz verlassen. Uns gerade entgegen kommen 3 große Füchse, die im Sonnenuntergang einen Ausflug machen.
Nun senkt sich rasch das Dunkel der Nacht über den
Chaco. Vorn und hinten, rechts und links rötet sich der Himmel. Es sind Kampbrände, die hin und her vom jagenden Indianer angelegt wurden. Morgen kann er so besser das Wild erkennen, als wenn es durch das graue Gras geschützt ist. Dann wird auch der Pampastrauß auf dem kohlschwarzen Gelände nach toten Schlangen und verbrannten Eidechsen suchen und so ein besseres Ziel für den Pfeil des heranschleichenden braunen Jägers bieten.
Nur noch im Schritt, im ganz langsamen, wie ihn nur ein Maultier eben zu gehen vermag, streben wir weiter. Cazice Montinyo hinten im Buggy hat Schlaf, sehr starken sogar. Er mag wohl träumen von dem saftigen Spießbraten und den leckeren Bataten am Lagerfeuer vorhin. Abwechselnd wecken ihn Dr. Schmidt und ich. Er reibt sich sein einziges Auge, schaut nach den Sternen und lispelt beruhigend: „Camino Mission!" um dann wieder einzunicken.
Da halt, die Maultiere können nicht weiter. Ein aus Rohr und Stäben gemachter Palisadenzaun muß durchbrochen werden, dann kommen wir an einen Indianerlager vorbei. Gesang. Lagerfeuer und davor ein glänzender Wasserspiegel. Sofort verstummt das Leben in der Tolderia. Das geübte Ohr der Wilden erkennt im schwarzen Dunkel der Nacht unbekannte Laute. Es ist unheimlich still dort über dem Wasserspiegel. Bald schwenken etliche Männer brennende Feuerscheite im Rad wie Fackeln. Sie umkreisen geisterhaft den Wassertümpel und stehen nun am Wagen. Wir glauben, daß vielleicht irgend eine Unterhaltung sich anbahnen wird zwischen ihnen und unserm Führer. Aber vergeblich! Alles ist still, nur ganz geheimnisvoll führen sie im halblauten Flüsterton eine Unterhaltung, wohl über den Zweck der nächtlichen Störung unsererseits. Seelenruhig schöpft unser Montinyo Wasser aus der Laguna und tränkt die Tiere. Ich schneide für die Braunen ein Stück Brot ab, und wir fahren weiter, in die Nacht hinein.
Wahrscheinlich waren wir, während unser Führer immer wieder einschlummerte, irgendwo in dieser Gegend vom Wege abgebogen. Bald befanden wir uns auf schmalem, aber gut ausgetretenem Indianerpfade. Cazice Montinyo behauptet, indem er immer nach den Sternen schaut, daß die Richtung recht sei. Ihn kümmert es wenig, daß unsere Tiere in diesen Palmenkämpen mit hohem Schilf ohne Weg schwer ziehen, er sitzt ja hinten in guter Ruhe im Wagen. Nur noch ganz mühsam kommen wir voran, bis wir endlich im dichten Buschdickicht an einem verlassenen Indianerdorf halten. Nun muß aber der schlaftrunkene Wilde vom Wagen und nach einem Ausweg suchen. Und wieder gehts durch schweren Sandweg oder durch Schilfrohr mühsam weiter. Wir wissen überhaupt nicht mehr, wo wir noch hinkommen, aber jedenfalls schon heute nicht mehr zur Missionsstation. Nachdem wir ein trockenes Flußbett gekreuzt haben, einigen wir uns, hier das Nachtlager zu machen, denn die Uhr geht bereits auf 10.
Am Buschrande spannen wir unsere Tiere aus. Sie erhalten das letzte Langfutter, da wir es nicht wagen, sie hier in der Wildnis auf die Weide zu lassen. Bald lodert ein lustiges Feuer. Der Häuptling
macht rings um uns noch mehrere Feuer, der Tiere und Schlangen wegen. Bald schmort das Fleisch wieder am Spieß und Kartoffeln werden gebacken. Ein warmer Kaffee kommt dazu und dann gehen wir zur Ruhe. Recht gut zustatten kommt uns meine sibirische Filzdecke als Unterlage und unsere Decken und Mäntel, denn die Nacht ist sternenklar und kalt.
Am 9 Sept. in der Frühe weiden wir unsere Tiere, und nach dem Kaffee brechen wir auf. Bald sind wir wieder in dem ausgetretenen Pfad. Fast scheint es uns unmöglich, in dieser Richtung unser Ziel zu erreichen, aber der braune Mann bleibt dabei, daß wir recht fahren. Nach einem See, der am Morgen von dem Geschrei vieler Sumpfvögel widerhallt, wird schon der Wald höher. Hier gibt es auch wieder den uns bekannten Quebracho colorado in Mengen und von hohem Wuchs. Ob wir etwa in einer Obrache (Holzfällerei) der Pinasko-Gesellschaft landen werden?!
Ein Reiter! Wir winken ihm; er kommt näher. Wie weit es bis zur Mission sei. „Ein Kilometer", ist seine Antwort. Dieses kommt uns dann doch überraschend, und wir denken, ob er km und Legua (fast 5 km) verwechselt. Er scheint aber sicher zu sein und treibt einen Trupp Pferde in der eingebogenen Richtung weiter. Wenn wir geglaubt hatten, daß unsere Mulas bereits erschöpft waren, so sollten wir nun eines andern belehrt werden. Im vollsten Galopp jagen sie in steifer Leine hinter den Pferden daher und richtig, nach etlichen Minuten tauchen die Dächer von Campo Flores vor uns auf.
Am frühen Vormittag halten wir auf dem Missionshof. Freundlich werden wir begrüßt von Missionar J. Sanderson. Bald umkreist uns auch eine Schar neugieriger Indianer. Einer von ihnen ist der getaufte Evangelist Augustin, der schon etliche Male in
Fernheim war und uns nun freundlich als alte Freunde begrüßt. Unser Tiere werden auf die Weide gebracht. Uns weist man in einem Häuschen, das als Hotel dient, ein Zimmer mit Betten und Wasch- und Badegelegenheit an.
Zu den Mahlzeiten sind wir Gäste der
Familie Sanderson. Mr. und
Frau S. mit ihrem 4jährigen Söhnlein sind die einzigen Europäer hier. Ihre Heimat ist England. Während die junge
Frau erst etwa 5 Jahre hier lebt, ist ihr Gatte im
Chaco aufgewachsen. Seine Eltern waren Mitbegründer dieses Missionsfeldes vor mehr als 40 Jahre zurück. Die Mutter lebt noch, war aber zur Zeit unseres Besuches abwesend. Mr. S. ist in einer Person Missionar, Wirtschafter, Ladenwirt u. sonst alles, was hier noch vorkommt. Er ist stark beschäftigt. Der Hausfrau stehen ein paar Indianerfrauen in der Küche zur Hand. Wir werden äußerst gut bewirtet und können uns trefflich unterhalten.
Zum Missionshof gehören das schon erwähnte Hotel, das Wohnhaus des Missionars, ein Warenladen und eine Kirche. Erstere Häuser sind von Wänden aus gespaltenen Palmenstämmen gebaut und mit Lehm ausgeschmiert. Die Kirche wurde aus Hartholzgerüst aufgeführt und die Wände mit Lehmziegeln ausgemauert. Der Raum ist etwa 20 mal 5 mt. groß und ringsum mit einem Schattendach umgeben, und ist mit Wellblech gedeckt. Die Fenster sind oben nach gotischem Stil spitz zugewölbt. Die Kanzel, Pulte und Stühle für die Kirchendiener am oberen Ende sind aus Algarroboholz angefertigt, die Bänke für die Zuhörer aus Lehmziegeln aufgemauert. Alles ist Arbeit von Indianern. Selbst ein kleines Fußharmonium fehlt nicht. Vorn am Eingang hängt eine richtige Glocke. Ein kleiner Windmotor auf dem Hofe sorgt für Licht durch Batterien.
Der Abend verläuft in gemütlicher Unterhaltung. Auch hören wir Radionachrichten aus Europa. Dann ruhen wir in der Nacht gut aus.
10. September. Es ist Sonntag. Nach dem Kaffee um 8 Uhr läutete es zur Kirche. Sofort, nach den ersten Glockenschlägen, strömen Alte und Junge aus dem naheliegenden Indianerdorf in die Kirche, welche in wenigen Minuten mit Menschen besetzt ist. Missionar Sanderson erscheint im weißen Talar. Auf der Brust trägt er am blauen Band ein kleines Emblem mit einem Christuskreuz. Seine
Frau setzt sich an das Harmonium und nun singt die
Gemeinde ein Lied nach der Melodie „Siegend schreitet Jesus über Land und Meer". Nach der Liturgie, woran auch die Versammlung beteiligt ist am Hersagen des Glaubensbekenntnisses, predigt Mr. S. über Luk. 6, 36ff, wo vom Splitterichter die Rede ist und von den 2 Männern, welche auf versch. Grunde bauten. Die braune Schar lauscht der Botschaft nicht so, wie wir Weißen es wohl gewohnt sind, indem bei uns die Blicke des Redners und der Zuhörer sich treffen, sondern sie sitzen meist mit gesenktem Blick da. Und doch sagen die Kenner dieser Leute, daß sie sogar sehr aufmerksam zuhören. Zum Schluß spricht ein Indianer das Gebet und nach einem Lied wird die Versammlung entlassen.
Obzwar Dr. Schmidt und ich leider nichts verstanden haben, sind wir doch tief beeindruckt. Wir zählen draußen 90 Erwachsene und 30 Kinder. Familien mit 3-4 Kindern sind hier keine Seltenheit. Diese Indianer auf Campo Flores gehören zum Stamm der Sanapanas. Die Sprache ist ein Dialekt der Lenguas, mit welchen sie sich auch gut verständigen. Liederbücher und Testamente sind alle in der Lenguasprache gedruckt.
Nach der Mittagspause und dem hier üblichen „tea time" (Tee Zeit) läutet um 4 Uhr die Kirchenglocke wieder, und nun versammelt Miss. S. etwas 20 junge Leute beiderlei Geschlechts. Es sind dieses Kandidaten, die zur
Taufe vorbereitet werden in etlichen Klassen. Dies dauert 2 Jahre. Der Missionar spricht mit den jungen Leuten heute über das Gleichnis von den 10 Jungfrauen und erklärt ihnen die Bedeutung des Öls als Vergleich mit dem hl. Geist.
Später habe ich mit ihm eine anregende Unterhaltung. Ob man es wirklich auch verstehen könne, daß diese Menschen eine Bekehrung durchmachen, ist meine Frage. Die Antwort ist etwa folgend: „Wir sind nicht interessiert, eine große Menge von „sogenannten Christen" zu registrieren, deshalb ist auch die lange Prüfungszeit vorgesehen. Natürlich ist der Anfangsbegriff von einer Umwandlung im bibl. Sinne bei diesen primitiven Naturkindern besonders am Anfang sehr bescheiden. Wir dringen aber auf niemanden ein. Jene junge
Frau, die sie dort vor mir auf der Bank sahen, kam eines Morgens zu mir und erklärte, daß auch sie ein anderes Leben anfangen möchte. Ich lud sie ein, zu diesen Vorbereitungsstunden zu kommen. Ich habe nun gerade gute Gelegenheit, ihr inneres Wachstum zu prüfen, indem ich in Form von Fragen auf ihr inneres Seelenleben komme. Auch fordere ich in diesen Stunden die Kandidaten auf, ein lautes Gebet zu sprechen, wobei man recht gut wahrnehmen kann, wie manche unter ihnen zunehmen am inwendigen Menschen".
In den
Mennonitenkolonien hört man immer wieder darüber klagen, daß unsere Indianer bei uns ein zu negatives Vorbild erhielten, um auch Christen zu werden. Mr. S. spricht nun darüber eine uns ganz neue Meinung aus und zwar, daß man bei ihnen glaube, daß es für diese Braunen von Nutzen ist, wenn sie prüfen und unterscheiden lernen, daß nicht alle Weißen auch von Geburt schon Christen sind. Dieses – so glaube er – kann die Christen unter den Braunen sogar mehr befestigen in ihrem neuen Leben. Dieser Gedanke war uns neu, er leuchtet aber ein, denn in der Tat, nicht die bloße Benennung „Christ" od. „
Mennonit" gibt uns schon den Paß zum Himmel Welch große Verantwortung im Vorbild aber liegt, von dieser Warte aus gesehen, doch auf allen wirklich gläubigen Kindern Gottes!
Vor Abend machen wir einen Rundgang durch das Indianerdorf. Die Braunen wohnen hier nicht mehr in Grashütten, wie bei uns. Der Holzreichtum gestattet es ihnen, sich Wände u. Dächer aus Palmen aufzuführen. Obzwar der meist harte Lehmboden für größere Pflanzungen ungeeignet ist, haben doch die Indianer hier recht gute Lebensmöglichkeiten. Einmal ist es der hier abgedämmte Riacho
Paraguay, der großen Fischreichtum aufweist. Auch werden jetzt bei niederem Wasser meterlange Aale mittels Spießen aus dem Sumpf geholt und schmecken gekocht oder am Feuer gebacken gut. Zu manchen Jahreszeiten kommen die sehr nahrhaften Algarroboschoten oder sonstige Waldfrüchte hinzu. Ferner liefert die junge Palme Strünke als Gemüse; so werden auch auf passenden kleinen Stellen etwas Kürbisse oder Bataten gezogen, oder man erhält Fleisch von der Jagd oder Vogeleier. Endlich hat man ein paar Ziegen oder Schafe, und im Notfall können diese Naturkinder sich im Laden gegen Straußfedern, Wildfelle oder Webewaren Mais, Bohnen oder Galetten einhandeln. So ist ihr Tisch immer gedeckt und sie sehen gutgenährt aus.
Der Besuch war hier wirklich anregend und belehrend. Wir glauben, daß dieser mit Arbeit überhäufte junge Missionar ein gutes Werk tut, das der Herr auch weiter segnen möge. Spät gehen wir zu Bett, denn morgen früh soll die Reise weiter gehen.
Am 11. Sept. stehen wir schon um 4 Uhr auf. Während ich die Sachen zusammenpacke, holt Dr. Schmidt die Mulas heran. Nach dem Frühstück und warmen Abschied von Mr. Sanderson fahren wir um 5.30 Uhr weiter. Unser Gastgeber war so freundlich, uns einen Evangelisten als Begleiter bis zur großen Missionsstation (120 km) mitzugeben. Hoch zu Roß reitet dieser unserm Wagen voran, was für unsere faulen Tiere ein guter Ansporn ist. Nachdem wir den Riacho
Paraguay gekreuzt haben, nehmen wir südliche Richtung und kommen zunächst an großen Einzäunungen und auch an einer
Viehstation von Pinasco vorbei.
Bald befinden wir uns nun in unermeßlichen Palmwäldern (Palmares). Unser Reiter bedeutet für uns eine große Hilfe. Nicht nur, daß wir den Weg finden, sondern es kommen auch immer wieder Tore, die er uns öffnet und wieder schließt. Das ist keine so kleine Aufgabe, denn es sind gewöhnlich zwei Torpfosten mit großen runden Löchern, durch welche 4 lange Palmenstämme geschoben werden. Einmal bleibt er an einem solchen Tore lange zurück. Wir werden unruhig und halten an, um zu warten. Da endlich taucht der Schimmel hinter uns auf; Augustin hatte sich beim Schließen an den Palmenstämmen die Hände ganz voll spitzer Nadeln getrieben, die erst einmal entfernt werden mußten. Während sich die Palmenkronen majestätisch auf ihren stolzen Stämmen wiegen, gerade auch in diesem Gebiet zwischen den 2 Missionsstationen, kommt mir immer wieder der Vers in den Sinn, der früher viel in Rußland gesungen wurde:
Warum fernhin ziehen,
Wo die Palmen weh’n?
Wenn vor unsern Türen
Seelen untergeh’n?
Hier, so längst die
Bibel Licht und Leuchte war,
Rauchen Götzenopfer
Auf dem Brandaltar.
Welches ist wohl noch mein Götze, dem ich etwa noch räuchere? Möchte doch jeder vor Gott diese ernste Frage zu beantworten suchen!
Es ist noch ziemlich früh, als wir auf der Estancia „Pozo bigote" (Schnurrbartbrunnen) halten. Sie gehört dem Engländer Gormann und dem Nordamerikaner Eaton und ist gelegen am Riacho San Carlos. Auch hier nötigt man uns freundlich zu Mittag, aber da es nicht Weide gibt, so ziehen wir vor, noch anderthalb Stunden weiterzureisen.
Um 12 Uhr Mittags erreichen wir dann die Estancia des Italieners Carlos Gianni. Der Ort hier heißt „India sola" (einzige Indianerin). Der Besitzer selber ist wohnhaft in Concepcion. Vom Verwalter werden wir freundlich bewirtet, während auch unsere Tiere weiden.
Um 3 Uhr geht es dann weiter. Um 5 Uhr kommen wir beim Gehöft eines einsamen armen Paraguayers vorbei, der uns zum Mate einladet. Wir müssen aber eilen. Der Ort hier heißt „Laguna Santiago" (Jakobs See). Unser Augustin erklärt uns, daß hier sein Geburtsort ist. Wo wir durchkommen, da begrüßen ihn die Paraguayer mit dem Namen Santiago, so wie er früher bei den Einheimischen hieß. Erst nach seiner Bekehrung gaben ihm die Missionare den Namen Augustin. Nun kommen wir an einer Jaguarfalle vorbei. Sie ist aus starken Palmenstämmen hergestellt. Man befestigt in der Falle an einem Hacken ein Stück Fleisch. Sobald die Riesenkatze darnach schnappt, fällt die Tür zu, und der Räuber ist lebendig gefangen.
Um 6, 30 Uhr abends erreichen wir die Estancia „Laguna Salada". Hier ist der Besitzer ein Engländer M. Green. Er selbst ist Hauptadministrador der Land und Viehgesellschaft Lancaster & Cia, die hier weit und breit riesige Länderstrecken im Besitz hat. Der freundliche Verwalter bemüht sich, damit wir Abendbrot erhalten sollen; doch wir danken und kochen selbst ab. Er läßt es sich aber nicht nehmen, uns gute Betten herzurichten. Unsere Tiere bringt Augustin auf eine grasreiche Insel. Die Landschaft hier ist fein. Auf grünem Teppich am Ufer des Sees leuchten tausende von Glühkäferchen und spiegeln sich im See wider. Es ist, als ob auf einer Sammelfläche lauter funkelnde Edelsteinchen glänzten. Doch lästige Mücken nötigen uns, unter die Moskitonetze zu schlüpfen, was ich bisher nicht durfte auf dieser Reise.
Am 12 Sept., nach dem Kaffee eilen wir weiter. Schon seit gestern mittag war der Wald bedeutend stärker geworden. Hier streben die Stämme, auch des Laubwaldes, stolz himmelan. Manch einen schönen Baum bewundern wir, der hier jedenfalls noch lange stehen wird. Wie würde man wohl in den Kolonien diese schlanken Stämme ausnutzen, aber hier, in dieser Wildnis, finden sie kaum Verwendung. Die Landschaft hier deutet an, daß wir uns einem Flußbett nähern und richtig, da gehts auf ausgespültem Hohlwege schon ein steiles Ufer hinunter. Es ist der „
Rio Verde" (grüner Fluß), der aber auch jetzt, im Winter, fast trocken ist. In der Regenzeit wird er zeitweilig zum reißenden Strom. Dann schwillt er an zu einer Tiefe von 5-6 m. und kann Roß und Reiter zum Verhängnis werden, da es hier nicht Brücken gibt. Hier ist auch die Heimat der Carpinchos, zahlreicher Wildschweine, Rehe und gar des stolzen Sumpfhirsches mit seinem Gabelgeweih. Hier ist, dank immer gedecktem Tisch, auch der gefleckte Jaguar, wie man sagt, stark vertreten. Leider zeigte sich jetzt selten ein Tier, und außer etlichen Rehen und Straußen ließ sich nichts sehen.
Um 11.30 Uhr halten wir auf der Estancia des Herrn Lima, eines Argentiniers, wo wir Rast machen. Der Ort heißt „Laguna sola". Der redselige Besitzer hat eine parag.
Frau. Sie haben 3 Töchter und 2 Söhne. Eine Frage ist hier in der Wildnis auch die Schulung der Kinder. Herr Lima hat sich aus
Asunción einen alten Mann von 70 Jahren hergebracht, der für 2500 Pesos monatlich bei freier Kost die Kinder unterrichtet. Wir werden nun auch zu Mittag geladen. Die Einrichtung des Hauses ist ganz primitiv. Außer etlichen Hirschgeweihen, einem riesigen Ochsenschädel mit seinen langen Hörnern und etlichen Waffen ist die Wand noch mit einigen Bildern geziert. Eine Photographie des Hausherrn in guter Kleidung wird mit Wohlgefallen gezeigt als aus der „guten alten Zeit". Herr Lima ist schon 20 Jahre im Lande und kennt fast jeden Menschen in weiter Umgebung. Er besitzt an 1000 Köpfen Rindern und ist zufrieden mit seinem Los. Allerdings ist er heute schon besorgt um die Dürre, trotzdem noch Wasser in den Lagunen ist.
Nach der größten Hitze brechen wir auf. Nachdem wir durch mehrere Kämpe und Buschwerk gekommen sind, meldet uns nun Augustin, indem wir wieder ein Tor passieren, daß wir uns jetzt auf dem Gebiet der großen Missionsstation befinden. Zunächst kommen wir durch einen riesigen
Kamp, der mit tausenden von Termitenhügeln wie besät ist. Man wird erinnert an ein Feld mit Heuhäufchen in Rußland. Dann taucht aus der Landschaft, die nun schon wochenlang in einen blauen Dunst gehüllt ist in ganz
Paraguay, eine ganz besondere Baumart auf und endlich, auf einer Anhöhe, lugt ein ziegelrotes Dach hervor. Es ist die Kirche der Mission. Bald halten wir mit unserm Wagen vor einem primitiven Haus, welches als Hotel für Fremde eingerichtet ist. Freundlich werden wir von einem spanischsprechenden Indianer begrüßt und zu Mr. Train, dem englischen Leiter der Station geführt, der uns willkommen heißt.
Der Leiter der Missionsstation, Mr. F. Train, weist uns ein Zimmer mit Betten und Waschgelegenheiten an. Unsere Tiere lassen wir frei laufen, da ja alles Land eingezäunt ist. Dann werden wir zum Abendbrot geladen. Nachher sitzt die ganze Gesellschaft beim Radio. Zu dieser M. Station gehören folgende Europäer:
Mr. Train mit
Frau und 2 Kindern von 5 – 7 Jahren. Dr. Ed. Dermott, ein weißbärtiger, über 70 Jahre alter Arzt mit seiner 80jährigen Gattin. Trotz ihres Alters sind die beiden noch humoristisch und voll Übermut. Der Alte wird scherzweise „General Smuths" genannt, mit dem er gewisse Ähnlichkeit zeigt. Dann ist zu nennen Mr. William Caddow mit
Frau. Schon um die Jahrhundertwende arbeitete er hier, hielt sich dann längere Zeit in Argentinien auf, bis seine Kinder alle versorgt waren. Nun sitzt er als der Majordomo (Verwalter) täglich stundenlang im Sattel trotz seiner Wohlbeleibtheit und seiner bald 70 Jahre. Ein junger Mann, Mr. Phil. Comerford, arbeitet in der Schlosserei mit Indianern. Endlich ist noch zu nennen Mr. H. Webb (Lehrer) und
Frau und die alte Witwe Sanderson, die aber gegenwärtig verreist sind.
Wir gehen zur Ruhe, denn morgen wird es für uns interessant sein, mit vielem hier bekannt zu werden.
Über die Mission erhalten wir folgendes Bild:
Dieses Werk hier wurde gegründet von einer anglikanischen Miss. Gesellschaft im Jahre 1888. Der Platz, bekannt unter dem Namen „Mission Central", auf dem heute die Arbeit betrieben wird, ist jedoch nicht der erste; man hat längere Zeit getastet, bis endlich der geeignete Ort gewählt wurde. Die Indianer nennen diese Station „Makthlawaiya" und zwar nach einem schirmartigen Baum mit hellgelber Rinde, der nur hier zu finden ist. (Maktlha=Ort; waiya=Name dieses Baumes). Dieser Baum ist auch eben als Wappen für den Stempel der Mission gewählt worden. Mit der Zeit sind denn nach und nach 10 Quadratlegua Land angekauft worden, die jedoch auf etliche Stellen verteilt sind. Es wird ausschließlich
Viehzucht getrieben und die Mission verfügt heute über rund 5000 Rinder mit einer entsprechenden Anzahl von Pferden.
Der Missionshof ist angelegt auf einer Anhöhe an den Ufern eines Flusses. Zur Hochwasserzeit befindet man sich auf einer Insel, denn das ganze Gehöft ist ringsherum mit Wasser umgeben. Auf einem weiß umzäunten Platze, der genau von West nach Ost liegt und etwa 100 m. Länge und 50 m. Breite mißt, ist ein schöner Rasen mit Fußstegen. Eine riesige Dattelpalme, etliche Algarrobo und einige „Waiya-Bäume" als Wahrzeichen der Gegend leuchten weit in das Land hinein. Auf dem westlichen Ende ist das Haupttor, welches auf schwarzem Schild die weiße Aufschrift in spanischer Sprache trägt: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig! nebst der Jahreszahl 1888.
Auf dem östl. Ende dieses Platzes erhebt sich die Kirche, in T-Form erbaut. Es ist ein hohes Hartholzgerüst unter Blechdach und hat eine Größe von etwa 30 mal 20 mtr. Bisher waren die Wände aus Palmenstämmen. Jetzt ist große Reparatur, denn das ganze Dach wird von unten weiß und von oben rot mit Farbe gestrichen, während man die Wände mit Backsteinen ausmauern will. Der Altarraum ist mit bunten Glasfenstern und Gedenktafeln geziert. Alles Mobiliar wie Kanzel, Pulte, Sessel und Bänke ist aus Algarroboholz von Indianern angefertigt.
Am Ende der Kirche befindet sich eine in Holz geschnitzte Tafel, die vom Bau der Kirche berichtet. Hier liest man in der Lenguasprache folgende Worte:
Dios sata nelsowaschama kiso
nimpitkina sa yantesiksik
(Gott wird unsere Freude sein)
Juni 29. 1906
Rings um diesen würdigen Platz sind dann von allen Seiten die Gebäude für die Missionare, Hotel, Laden, Schule und Werkstätten errichtet. Es sind auch Pflanzungen von Orangen, Guayaba, Gemüse und Blumen, was in diesem harten Boden besonderer Pflege bedarf. Endlich befinden sich in verschiedenen Gruppen je nach der Sippe der Indianer zu 4 – 5 beieinander die 60 Häuschen der 90 Indianerfamilien. Die Wände und Dächer der Hüttlein sind aus Palmenstämmen. Manche Höfe zeigen auch kleine Anpflanzungen
Ein Tagewerk auf dieser Station verläuft folgend: Um 5.15 Uhr läutet die Glocke zur Gebetsstunde. Wer das Bedürfnis hat und ab kann, findet sich in der Kirche ein. Einer der Missionare behandelt kurz ein Bibelwort nach einem Programm. Alle beten still und zuletzt einer laut. Nachher ist Frühstück und um 6.30 geht jeder an seinen Arbeitsplatz. Um 8.30
macht man eine kurze Teepause. Dann geht die Arbeit bis Mittag fort um 11.30 Uhr. Jetzt folgt eine gute Siesta bis etwa 3 Uhr. Nun gibts Tee und dann wird gearbeitet bis 5.30 Uhr.
Etliche male in der Woche gibts um die Abendzeit noch einen Gottesdienst, geleitet von einem eingeborenen Evangelisten; so auch an den Sonn- und Festtagen.
Stillenden Müttern und kleineren Kindern wird von der
Frau des Missionars jeden Morgen ein kleines Frühstück, eine Mais- od. Mehlsuppe mit Milch, verabreicht. Mehrere Frauen od. junge Mädchen stehen sowohl bei dieser Arbeit als auch in den Küchen, Waschstuben od. Gemüsegärten den Missionsfrauen helfend zur Seite.
Was die Arbeit mit dem Vieh betrifft, so tun diese hier ausschließlich die braunen Männer, die sehr geschickt mit dem Lasso umzugehen wissen. So sind auch in den Werkstätten für Tischlerei und Schmiede einige Handwerker herangebildet worden, die unter Anleitung recht gute Arbeit liefern können. Klugerweise haben schon frühere Missionare oder deren Frauen angeknüpft an die angeborenen Handfertigkeiten der Indianerrinnen im Spinnen und Weben. Es werden Leibbinden, Taschen und dergleichen Dinge angefertigt in lebhaften farbigen Mustern. Man stickt sogar Ornamente oder Initialen ein. Auch die sogennanten „jergas", die Satteldecken, und malerische Ponchos aus Schafwolle werden hier hergestellt und in der ganzen Umgebung gern gekauft.
Endlich sei noch eines wichtigen Zweiges, der Schule, gedacht. Dr. Schmidt und ich treten an einem schönen Morgen in ein Haus, in welchem in 2 Räumen etwa 55 Kinder unterrichtet werden. Der eingeborene Oberlehrer Esteban reicht uns freundlich die Hand. Er imponiert ganz in seinem Wesen. Als ein Mann von etwa 50 Jahren trägt er eine Brille. Auf ein Zeichen erheben sich seine 34 Zöglinge von 8 – 15 Jahren, die alle im blauen, gelbumborteten Schulkittel gekleidet sind und hübsch zu zweien auf einer Schulbank sitzen, stramm von ihren Plätzen. „Buenos dias!" sagen uns alle im Chor. Der freundliche Lehrer zeigt uns nun die Künste seiner Schüler. Man singt uns schöne christliche Liedchen in der Lenguasprache vor; der Inhalt wird uns dann in Spanisch erklärt. Da der Indianer nur die Zahlen von 1 – 5 kennt, so rechnet man in spanischer Sprache. Zunächst zählen die Kinder bis 100, dann die Hunderter bis 1000, nun die Zehntausender bis 1.000.000. Das Einmaleins wird aufgesagt. Uns werden auch die schriftlichen Arbeiten gezeigt, von denen einige recht sauber aussehen. Auch in die kleine Schulbibliothek machen wir einen flüchtigen Einblick.
Im Nebenzimmerchen unterrichtet eine junge anständige Indianerin eine Gruppe von 20 Kleinen im Alter von 5 – 8 Jahren. Man malt und schreibt hier etwas, man singt Kleinkinderliedchen und zählt ganz flott. Auch die Kleinen sind alle in der Schuluniform, die nach dem Unterricht hier in den Schränken hängt.
Nach Schluß erhalten alle Schüler draußen einen Brei und verlaufen dann in ihre Hütten. Nicht alle aber wohnen auch in der Nähe; manche von ihnen sind etwa 3 km entlegen.
Diese Arbeit wird beaufsichtigt von Mr. Webb, der aber gerade verreist war. Uns hat dieses Werk wirklich gefallen, und es ist, mit Christentum verbunden, wohl als eine der wichtigsten Tätigkeiten, auch im Hinblick auf die Zukunft, zu nennen.
Wie uns Mr. Train mitteilt, zählt das Missionsfeld heute 185 getaufte Mitglieder. Im Durchschnitt hat hier jede
Familie 4 Kinder. Auf 25 Geburten, die pro Jahr gezählt werden, gibt es 10 – 15 Todesfälle. Erfreulich ist es auch, daß diese Indianer hier in der Zeit der Algarroboschoten keine Saufgelage dulden, sondern die süßen Früchte nur als Nahrung benutzen. Dieser Einfluß geht, wie man uns berichtet, von den Christen über auch auf die noch Unbekehrten. Welch ein Segen! denn wer schon einmal dieser unmäßigen Trunksucht zugesehen hat, muß diesen Fortschritt unter den Wilden dankbar begrüßen.
An einem Abend leitet Dr. Schmidt in englisch eine Bibelstunde über Pauli Bekehrung. Nachdem uns dann von dem freundlichen Mr. Train alles gezeigt und manches mitgeteilt worden ist, sind die geplanten 2 Tage unseres Besuches verlaufen.
Am Freitag, 15. Sept. verabschieden wir uns von allen lieben Menschen, die uns wirklich freundlich aufnahmen. Auch mancher braune Mann streckt uns seine Hand entgegen. Mr. Train ist so gefällig, uns einen wegkundigen Indianer anzubieten für die etwa 140 km, denn nun wird der Evangelist Augustin, den wir wirklich liebgewonnen haben, zurückkehren. Begleitet von den Segenswünschen unserer Gastgeber nehmen wir die Richtung westwärts, um auf der Rückreise noch andere Teile des Chacos kennen zu lernen.
Wir nehmen die westliche Richtung. Bald passieren wir den Ort, „Canja Castilla", wo die englische Mission noch vor etlichen Jahren zurück eine große Kirche hatte. Der Arbeitermangel aber war die Ursache, daß hier das Werk aufgegeben werden mußte. Durch Gelände von Algarrobo, Seen und Weidekämpen erreichen wir um die Mittagszeit die
Viehstation des deutschen Besitzers C. Bischof. Er ist nicht zuhause. Wir werden aber freundlich aufgenommen von seinem Verwalter, einem deutschen Jungen aus der Gegend bei Concepcion, namens Niedhammer. Nach der Mittagsrast setzen wir unsere Reise fort durch eine Gegend, welche nun gekennzeichnet ist durch tausende von Termitenhügel und Palmenwälder. Nachdem wir durch etliche Tore gefahren sind, befinden wir uns nun auf dem Gelände eines der reichsten Chacokrösusse, des Nordamerikaners Jorge Lohmann. Nach Sonnenuntergang halten wir auf offenen Felde zur Rast und machen hier Nachtlager.
16. September. Wir brechen schon früh auf, und sind um 9 Uhr auf der Estancia des Mr. Lohmann. Der Ort heißt „Pozo Colorado" (roter
Brunnen). Mitten auf weitumzäuntem Hof an einer Laguna befinden sich die Gebäude, deren Wände in einfacher Art aus Palmenstämmen aufgeführt und mit Lehm verputzt sind. Die Dächer sind aus halbierten und ausgehöhlten Palmen, die Fußböden aus Lehm. Der Hof ist von 3 Seiten mit Gebäuden umsäumt. Alles trägt hier einfachen Charakter. Ein Dienender führt uns unter ein Schattendach, wo wir freundlich von der Hausherrin begrüßt werden, die uns nach Landessitte heißen Mate serviert. Don Jorge, so wird allgemein Herr L. genannt, sei in den
Kamp geritten, käme aber bald heim.
Während wir uns unterhalten, steigt im Hofe ein kräftiger, gesetzter, freundlich aussehender Mann von etwa 55 Jahren aus dem Sattel. Er drückt uns warm die Hand und stellt sich vor als der Besitzer. Nun spricht Dr. Schmidt nur noch in englisch, denn sie sind ja Landsmänner. Auf die Frage an seine
Frau, ob sie ein gutes Frühstück für die Gäste bereit habe, werden wir zu Tische genötigt. Und das Essen ist kräftig und fein serviert, denn Herr L. hat bei der Wahl seiner Ehehälfte nicht Wert gelegt auf Reichtum – den hat er selber – sondern auf eine arbeitsame, tüchtige Wirtin. Er heiratete eine
Frau, die im Hotel das Kochen lernte.
Der geräumige Speisesaal ist mit gemütlichem Korbmöbel ausgestattet. Der Hauswirt erklärt uns einige Bilder an der Wand, die inmitten von Waffen und Hirschgeweihen angebracht sind. Manche erzählen von alter Zeit. Mit besonderem Stolz wird uns ein großes Bild gezeigt. Es sind 2 hübsche Mädchen von 20 – 22 Jahren, Töchter des Hausherrn von einer Lenguaindianerin, bevor die heutige Wirtin hier waltete. Diese Mädel besuchten in
Asunción die Schulen und erhielten dann ihre weitere Ausbildung in England. Auch die andren Kinder mit dieser
Frau werden in den Städten ausgebildet.
Mr. L. berichtet uns nun etwas aus seinen Anfängen im
Chaco, wohin er vor etwa 35 Jahren als armer Texas-Cowboy und Wildfellhändler kam. Das Glück war ihm hold, die Zeiten damals noch angemessen, um rasch emporzukommen, was heute längst nicht mehr der Fall sei. Auf unsere Frage nach der Zahl seiner Rinder erklärt er achselzuckend: „Vielleicht 40-50.000 Stück.
Ja, wer mag das wohl wissen in diesen unermeßlichen Weiten?! Es wird uns berichtet von ganz romantischen Sachen, wie auch z. B. von Jagden auf Viehdiebe, wie es vor etwa 2 Jahren einmal passierte, daß man einer gestohlenen Herde auf der Spur war. Es war gerade Trockenperiode, und die Diebe beabsichtigten, etliche hundert Rinder über den Pilcomayo nach Argentinien zu bringen. Die durstigen Tiere stürzten sich bei der fluchtartigen Jagd auf eine Salzwasserlagune, denn anderes Wasser war überall versiegt, und als Mr. Lohmann mit seiner Reiterkafalkade endlich die Rinderherde erreichte, lag alles am Salzsee tot. Selbst die Pferde der Diebe lagen verendet, mit einer aus dem Schenkel herausgeschnittenen Brennmarke. Die Diebe waren in den Busch geflüchtet; vielleicht mußten auch sie verdursten. M. Lohmann verachtet jeglichen Prunk und Staat. Er erklärt uns, weshalb manche Viehzüchter nicht hoch kommen. Sie bauen schöne Häuser, geben viel um hübsche Kleider, anstatt sich im Winter die Trockenflüsse abzudämmen. Die Regen kommen, das Wasser läuft ab, und im Winter leiden die Herden an Wassermangel und viel Vieh geht verloren. Mr. L kann es sich leisten, auch einmal eine Reise in den Kreis der Zivilisation zu machen, wie auch z.B. vor etlicher Zeit nach Argentinien, aber er fühlt sich beengt im Gesellschaftstaat; besser gefällt es ihm im Reitanzug u. hoch zu Roß, durch die Kämpe streifend.
Mr. L. ist auch sonst ein Menschenfreund. Kommt ein Arbeitsloser bei ihm durch, so findet er hier eine Stelle. So ist er auch ein Freund der Mennoniten. Jährlich kauft er gegen gute Preise den mennonitischen Viehaufkäufern hunderte von jungen Rindern ab, läßt sie auf seinen Kämpfen ausweiden, um sie dann nach etlichen Jahren laut Verträgen an das Militär im
Chaco als gutes Schlachtvieh abzuliefern. Er gibt auch etwas auf gute Pferde. Für die Trockenzeit benutzt er seine Autos. Er ist auch im Besitz eines Radiosenders und eines Flugplatzes. Wenn es einmal die Not der fordert, so verlangt er per Radio aus der Hauptstadt ein Flugzeug und ist dann in zwei Stunden in
Asunción. Wir haben nun auch Gelegenheit, per Radio unsere Angehörigen in Philadelphia zu benachrichtigen, wo wir uns befinden und wann wir heimzukommen gedenken, und man erhielt die Nachricht gut. Es ist dieses doch auch eine noble Einrichtung, überaus hier in der Wildnis.
Bald werden wir zu Mittag geladen, was eigentlich nach dem späten reichlichen Frühstück eine zu große Belastung bedeutet. Nach der Siesta u. einer guten Dusche verabschieden wir uns von unsern freundlichen Gastgebern, die uns nötigen, noch eine Nacht zu bleiben. Wir müssen aber eilen. Man will uns wenigstens Lebensmittel mit auf den Weg geben. Wir danken für das Angebot, denn unser Kasten ist noch gut versehen. Um 4 Uhr verlassen wir die Estancia in nunmehr wieder nördlicher Richtung.
Nun kommen wir an Seen vorbei, wo es von tausenden verschiedener Vögel wimmelt, die hierher kamen, um zu fischen oder ihren Durst zu stillen. Hier sieht man die kleinen flinken Schnepfen, das zierliche Wasserhuhn, den grauen und schneeweißen Reiher, den riesigen Storch Marabú und einige andere dieser Gattung, den plumpen Sumpftruthahn, Chahá, den krummschnabeligen Curukau, die behäbige Löffelgans, den rötlich schimmernden Flamingo u. vor allem verschiedene Sorten von Wildenten. Dr. Schmidt erlegt mit einem Schuß 2 Enten. Als sich die andern Vögel durch den Knall in die Luft erheben, hört man von den tausend Flügelschlägen ein eigentümliches Pfeifen. Dann läuft uns ein Panzerschweinchen über den Weg. Unser brauner Begleiter betäubt es mit einigen Schlägen und wirft es in den Wagen.
Um 9 Uhr machen wir Rast auf einem
Kamp. Am Lagefeuer häuten wir unsere Enten ab, da das Rupfen zu langweilig ist und schmoren sie am Spieß. Der Indianer entweidet sein Gürteltier, steckt es voll glühender Kohlen und bratet es dann im eignen Panzer. Auch wir schmecken etwas; es ist ein zartes Fleisch. Nachdem wir unsern Entenspießbraten verzehrt und Tee getrunken haben, schlafen wir nach einem gemeinsamen Abendsegen durch die Nacht.
Der 17. September (Sonntag) findet uns schon um 5 Uhr morgens wieder unterwegs. Hart am Wege lebt hier eine arme paraguayische
Familie, die für Bezahlung einen Damm für einen Viehzüchter aufschüttet. Der Mann bittet uns um etwas Zucker für seine kranke
Frau. Wir können ihm außerdem noch etliche Sauerorangen geben und eilen weiter. Der arme Mann kennt keinen Sonntag, sondern arbeitet hier in der trostlosen Einöde unter Sonne und Ungeziefer, um kümmerlich sein Leben zu fristen.
Nun kreuzen wir wieder den
Rio Verde, der auch hier hohe Ufer, aber jetzt fast kein Wasser hat. Noch etliche Kilometer weiter durch eine liebliche Landschaft, und wir halten um 10 Uhr auf dem einsamen Gehöft, des am weitesten von allen Mennoniten nach Süden vorgedrungenen Mennoniten Dietrich Dück. Eine parag.
Familie führt dem Junggesellen den Haushalt. Der Herr sei vor etlichen Tagen ausgeritten, so erklärt man uns. Nach kurzer Zeit erscheint er selber. Wir sind seine Mittagsgäste. Er treibt Handel als Vermittler mit Vieh oder landwirtschaftlichen Erzeugnissen der
Mennonitenkolonien mit seinem reichen Nachbarn, Herrn Lohmann. Unter Lebensgefahr hat er mitunter den Kafir auf einem Floß aus Strauch u. Rinderhäuten über den hochangeschwollenen Fluß geschafft. Er hat heute vielleicht einige 60 oder 70 Köpfe Rindvieh.
Nach der Mittagsrast verlassen wir um 3 Uhr diesen Ort und erreichen durch Niederkämpe um 6 Uhr die Estancia des Mister Kent, wie der Mann weit und breit bekannt ist. Mr. K. war Engländer und fing hier etwa seine Arbeit gleichzeitig mit Mr. Lohmann an. Man erzählt, daß es ihm gelang, ein einziges Mal seine englische
Frau zu überreden, von
Asunción in den wilden
Chaco zu kommen. Nachdem sie dann zurückkam, sei sie nie wieder hier gewesen. Der Vater starb vor einem Jahr und hinterließ seinen Söhnen ein armseliges, vernachlässigtes Erbe. Vielleicht hatte auch noch der Schnaps das seinige getan. Einer der Söhne dient heute auf einer Estancia, während der andere nun der Besitzer des einst ziemlich großen Gutes ist, das heute bis auf etwa 1000 Köpfe Vieh herabgesunken ist. Doch wir finden heute den Wirt nicht daheim und schlafen im Hofe des Verwalters.
18. September. Frühmorgens um 5.30 sind wir bereits wieder unterwegs. Hier verläßt uns unser Indianer Enrique, um zur Mission zurückzukehren. Ein anderer Brauner begleitet uns eine kurze Wegstrecke, bis wir nicht mehr verirren können. Unser Weg führt hier durch unermeßliche Palmenwälder, wie wir sie vorher wohl noch nirgends antrafen. Von hier holen auch schon die Mennoniten Palmstämme. Um 9 Uhr halten wir zum Frühstück bei Bürger P. Töws, aus
Menno, der hier ein kleines Sägewerk mit Dampfkraft errichtet hat. Er halbiert Palmenstämme und höhlt sie mittels einer entsprechenden Maschine aus für Dächer. Er kann gar nicht soviel herstellen, wie angefordert werden. Der Ort wird „Campo Techo" (Dachziegelfeld) genannt. Hier in unmittelbarer Nähe haben auch die Fernheimer Bürger W. Martens und P. Wieler als Viehaufkäufer ihre Estancia.
Frau Töws stellt uns zum Kaffee auch feinen Fischbraten auf den Tisch, da bei den jetzt austrocknenden Seen die Indianer sehr den Fischfang betreiben. Übrigens will die
Familie Töws bald diesen Ort verlassen, einmal aus dem Grunde der Schulung der Kinder und dann auch der furchtbaren Ungezieferplage wegen. Mücken und Polvorinos sollen hier z.B. in der nassen Zeit ungeheuer sein. Wir dürfen uns auch glücklich schätzen, daß unsere Reise jetzt in der Trockenzeit so glatt von statten geht. Wir fahren bald weiter und kommen an der
Viehstation der beiden Vetter Kliewer vorbei. Der Ort heißt „Campo de los Buenos Amigos" (der guten Freunde). Dann füttern wir unsere Tiere über die Hitze und trinken Kakao.
Um 3 Uhr brechen wir wieder auf und erreichen um 6 Uhr das am weitesten nach Süden vorgeschobene Mennonitendörflein „
Pozo Amarillo" (Gelbbrunnen). Es wohnen hier 8 Wirte, die abseits des Blocks der
Kolonie Menno siedelten. Neben Ackerbau wird sich auch die
Viehzucht hier lohnend gestalten. Im Hause der
Familie W. Unrau werden wir überaus freundlich bewirtet. Wir schlafen dann im Hofe.
19. September. Frühe um 5.30 verlassen wir dieses Dörflein und erreichen nach etlichen Stunden die
Viehstation „Campo Leon" (Löwenfeld), wo 2 Familien die Aufsicht haben über Vieh, das der
Kolonie Menno gehört. Man zieht eben ein junges Rind aus dem
Brunnen, welches durch Drängen und Stoßen hineinfiel. Etwas steif durch die ungewohnte Lage, sonst aber unversehrt, geht es wieder auf die Weide. Nach kurzer Kaffeepause eilen wir weiter und erreichen um 10.30 Uhr Neu Mölln. Wir besuchen noch vormittags etliche Wirte und die Schule. Die Leute hier sind so froh, daß endlich auf etlichen Stellen Süßwasserbrunnen entdeckt wurden, nachdem man jahrelang in der Winterzeit das Trinkwasser von weit her holen mußte.
Nach der Mittagsrast im Hause von Isaak Neufelds eilen wir um 2.30 Uhr weiter und fahren über die Militärstation „Villa Militar" der Missionsstation zu, wohin unser Fuhrwerk gehört. Anders Hätten wir auch geradewegs nach Philadelphia näher gehabt. Um 9 Uhr Abends sind wir dann auf dem Missionshof, wo man uns willkommen heißt.
Resumen: Für diese Reise von rund 600 km hatten wir 15 Tage gebraucht. Wir fuhren total 100 Stunden, machten auf 25 Stellen halt, davon auf offenem Felde 5 mal und schliefen 7 Nächte im Freien. Wir sind durch 44 Tore gefahren, schmierten 6 mal den Wagen und verbrauchten 2 Sack mit Kafirrispen. Sonst lebten unsere treuen Mulas Ginn und Philipp von Gras, welches mitunter recht dürre war, und Wasser. Wir selber hätten es kaum nötig gehabt, Lebensmittel mit uns zu nehmen, dank der Gastfreundschaft aller Leute. Wir hatten recht viel Vergnügen an der ganzen Reise und werden immer gern uns dieser Fahrt durch Urwald und
Kamp erinnern. Auch nachträglich sei allen lieben Menschen für ihr freundliches Entgegenkommen unser wärmster Dank ausgesprochen.
Fussnoten:
| Dieser Reisebericht aus den frühen Nummern des Mennoblattes, gibt Aufschluss über den Prozess der Landnahme und Missionierung im südöstlichen Teil des Gran Chaco, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. |
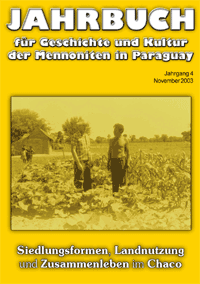



 Die folgenden Grafiken(7) sind gelegentlich benutzt worden um zu zeigen, wie verschiedene kulturelle Elemente in einer Gesellschaft oder einer Einzelperson verwurzelt sind.
Die folgenden Grafiken(7) sind gelegentlich benutzt worden um zu zeigen, wie verschiedene kulturelle Elemente in einer Gesellschaft oder einer Einzelperson verwurzelt sind.