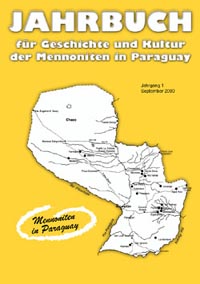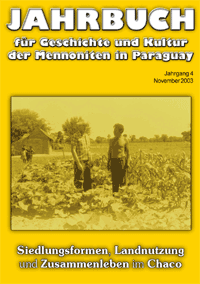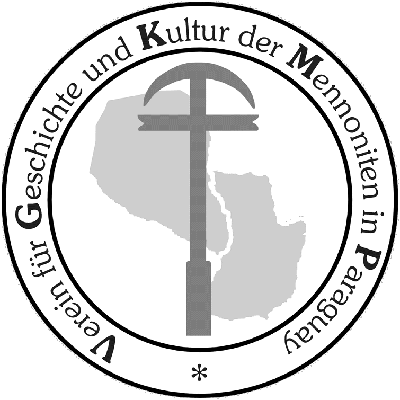Aufsätze
Das russländische Erbe der Mennoniten in Lateinamerika
Peter P. Klassen (1)
1. Einführung
Ein junges Ehepaar, dessen Vorfahren 1874 von Russland nach Kanada ausgewandert und von dort nach Mexiko gezogen waren, war 1980 nach
Paraguay gekommen. Als es hier eine Fahrt machen wollte, sagte er zu ihr: „Nemm du den Schimmedaun." Die
Frau wusste, dass der Koffer gemeint war, doch beide wussten sicher nicht, dass es eine Abwandlung des russischen Wortes „schemodan" war.
In
Paraguay hießen die Ochsen der mennonitischen Einwanderer, die aus Russland gekommen waren, Wanjka und Mischka, die Pferde Kukla, Halka und Sorka.
Die Jungen im Dorf gingen „kapeize", wenn sie baden wollten, und wenn sie ihre Kräfte maßen und miteinander rangen, hieß das „barotze". Von „sebauje" sprach man, wenn es regnete. Das Pförtchen hieß „Kalitke", der Dachbalken „Swolok", grobes Tuch „Radno" und eine Tragetasche „Kaschorka". Peter hieß Petja, Hans – Wanja, Gerhard – Griescha, Kornelius – Kolja, Maria – Marusja, Anna – Njunja, Katharina – Katja.
Meine Mutter sang: „Solawej, Solawej, Lapitschka, Kanarejuschka dschalernap najatj," und das Mädchen im Dorf sang: „Naskolkoi glaski gowarila, satjsto, satjsto tje ja ljublju."
Das sind Bruchteile der Begriffe, die die Mennoniten in Russland in ihr Umgangsplattdeutsch aufgenommen hatten, Volks- und Liebeslieder, die wahrscheinlich das russische Dienstpersonal gesungen hatte. Hinzu kämen die Bezeichnungen für manche Gebrauchsgegenstände und vor allem für Speisen. Viele von ihnen sind immer noch im Gebrauch, obwohl kaum noch jemand weiß, dass das russische Worte sind, wie Borschtsch, Wareniki, Galupze, Pilimenji, Piroschki, Paska, Bulki, Praniki, Grusnik und manche andere. Manche der Wörter sind so verformt, dass sie im Mennonitenplatt gar nicht auffallen. Die Begriffe sind mit den Auswanderern und Flüchtlingen, über Meere und Kontinente mitgewandert.
Es gibt heute eine Reihe sprachwissenschaftlicher Untersuchungen über das
Plattdeutsch der Rußlandmennoniten, und sie stellen neben holländischen, polnischen, kaschubischen oder litauischen auch eine Menge von russischen Reliktwörtern fest. Ich will hier von den vielen nur Jack Thiessens Wörterbuch nennen.
(2)Zur Zeit stellt Professor Harald Thun in Kiel einen Sprachatlas von Lateinamerika her, in den auch das Mennonitenplatt einbezogen ist. Er stellt fest, dass viele der russischen Reliktwörter wieder im Schwinden sind und spanischen und portugiesischen Platz machen.
2. Kurzer Überblick über die Einwanderung der Russlandmennoniten in Lateinamerika
Die Auswanderung und die Flucht der Mennoniten aus Russland, die dann auch zur Einwanderung in Lateinamerika führten, erfolgten in großen Schüben. Die Ursachen dafür waren sehr unterschiedlich, doch allgemein kann man sagen, dass sie stark mit den jeweiligen politischen Ereignissen der Zeit verzahnt waren.
Der Druck, der zur Auswanderung aus Russland und später zur Flucht aus der Sowjetunion führte, war ein doppelter. Er traf einmal die mennonitische Glaubensüberzeugung, zum andern aber auch ihre Wirtschafts- und Siedlungsstruktur. Die Bedrohung des Glaubens reichte von der Infragestellung der durch das
Privilegium geschützten
Wehrlosigkeit, wie unter den Zaren, bis zur Eliminierung des christlichen Glaubens überhaupt, wie unter dem Bolschewismus. Die Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur der mennonitischen Dörfer und Kolonien wurde durch die radikale Entkulakisierung und Kollektivierung nach dem Fünfjahresplan Stalins von 1928 zerstört.
(3)Der erste Auswanderungsschub erfolgte 1874, als in Russland die allgemeine Wehrpflicht eingeführt wurde. Damals wanderten die Bewohner der
Kolonie Bergthal bei Mariupol geschlossen nach Kanada aus, und ihr schlossen sich Gruppen aus der Altkolonie Chortitza und aus andern Siedlungen an. Insgesamt verließ damals etwa ein Drittel der Mennoniten Russland.
Die Nachkommen dieser sehr konservativen Gruppen stellten dann auch die ersten Kontingente, als die Einwanderung von Mennoniten nach Lateinamerika begann. 1922 kam es zur Auswanderung aus Kanada nach Mexiko und 1927 und 1948 nach
Paraguay.
(4) Es folgten dann später kontinentale
Wanderungen gerade dieser Gruppen, so von Mexiko nach
Paraguay, Bolivien, Belize und Argentinien um 1970 und später und von
Paraguay nach Bolivien.
(5)Der zweite große Schub der Auswanderung aus der Sowjetunion begann 1923. Viele Mennoniten verließen ihre Kolonien, die unter der Revolution und dem Bürgerkrieg schwer gelitten hatten. Die NEP-Zeit bewirkte dann einen zeitweiligen Stopp der Auswanderung. Doch als dann 1928 der Fünfjahresplan realisiert werden sollte, kam es im Oktober und November 1929 zu einer spontanen Flucht deutschstämmiger Bauern nach Moskau. Von den etwa 14 000 Flüchtlingen, die meisten davon Mennoniten, konnten etwa 5000 die Sowjetunion verlassen und in Deutschland Aufnahme finden. Die anderen waren von der Sowjetregierung zuvor zurückgeschickt worden.
Von diesen Flüchtlingen kamen 1930 etwa 1500 nach Brasilien und 2000 nach
Paraguay. (Eingeschlossen sind hier auch jene Gruppen, die 1930 über den Amur in die Mandschurei flüchteten, von wo aus sie ihre Reise nach
Paraguay -1932- oder Brasilien -1934- fortsetzten).
(6)Ein letzter großer Schub von Mennoniten aus Russland kam nach dem Zweiten Weltkrieg (1947 – 1948) nach
Paraguay. Sie waren beim Rückzug der deutschen Truppen 1943 bis 1945 in den Westen gekommen.
Paraguay war damals das einzige Land, das eine ganze Gruppe von Flüchtlingen geschlossen aufzunehmen bereit war.
(7)Die Folge all dieser
Wanderungen ist, dass es heute in mehreren Ländern Lateinamerikas Nachkommen der Rußlandmennoniten gibt. In geschätzten Zahlen leben heute in Mexiko 50 000, in Bolivien 30 000, in
Paraguay 25 000, in Brasilien 9000 und in kleineren Gruppen ungefähr 3000 Mennoniten. Zusammen mit den etwa 700 Mennoniten in Uruguay, die aber aus dem ehemaligen Westpreußen stammen, kann man die Zahl der Mennoniten in Lateinamerika auf 120 000 schätzen.
3. Das Manifest Katharinas der Großen und andere Verordnungen der Zaren
3.1. Ausländerkolonien in Russland
Die absolutistische Regierungsform in Russland im 18. und 19. Jahrhundert war die Voraussetzung für die Kolonisation, die den ins Land gerufenen Ausländern aufgetragen wurde. Die Zaren waren in ihren Entscheidungen frei, und für ihre Manifeste, Erlasse und Instruktionen war der Nützlichkeitsstandpunkt maßgebend. Sie brauchten keine Hemmungen zu haben, den gerufenen Einwanderern Sonderrechte zu gewähren, wenn sie sie für nützlich hielten. Die erklärte Absicht der russischen Regierung war um diese Zeit, die neu eroberten und in ihrem Sinn noch unkultivierten Gebiete für die Wirtschaft zu erschließen.
So kamen seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts große Gruppen von Einwanderern ins Land, vorwiegend aus Deutschland. Einwanderungsziele dabei waren die Gebiete an der Wolga und dann auch der Süden am Dnjepr. Die Einwanderung der Mennoniten aus Preußen begann 1789. Sie siedelten vorerst im Dnjeprgebiet und breiteten sich dann im Lauf der Jahrzehnte über weite Teile Rußlands aus.
Die Grundlage aller Privilegien und Erlasse zugunsten der sog. Ausländerkolonien war das Manifest der Kaiserin Katharina der Großen vom 2. Juli 1763. Alle Bereiche des wirtschaftlichen, kommunalen, kulturellen und religiösen Lebens waren in dieses Manifest und in die späteren Erlasse, die in einem Kolonialgesetz gipfelten, eingeschlossen. Dazu gehörte auch die Geschlossenheit der Siedlungen, die Siedlungsstruktur und die Selbstverwaltung.
(8)3.2. Voraussetzungen in Lateinamerika für das russländische Erbe
Die Mennoniten hatten sich in Russland so stark an diesen Sonderstatus gewöhnt, dass es nach der Auswanderung oder Flucht im 19. und 20. Jahrhundert ihr sehnlichster Wunsch war, auch in ihrer neuen Heimat möglichst in der gleichen Form weiterzuleben. Dazu gehörten in erster Linie wieder die Geschlossenheit der Siedlungen, die Siedlungsstruktur selbst und möglichst auch die Selbstverwaltung.
Dieses Bestreben widersprach aber, besonders nach der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, der Verfassung der meisten Staaten. Die Demokratisierung hatte zur Folge gehabt, dass grundsätzlich alle Bürger im Land vor dem Gesetz gleich sein sollten, mit gleichen Rechten und Pflichten. Ein Sonderrecht für eine Gruppe der Bevölkerung musste deshalb als verfassungswidrig angesehen werden.
So fest war aber der Wille bei manchen mennonitischen Gruppen, an dem russischen Modell festzuhalten, dass sie auch bereit waren, dafür Entbehrungen auf sich zu nehmen und nötigenfalls auch in unwirtliche Landstriche zu ziehen.
Das war andererseits auch der Grund dafür, dass sich einige Länder in Lateinamerika für die Einwanderung der Mennoniten öffneten. In diesen Ländern gab es Gebiete, die nur durch eine gezielte Kolonisation erschlossen werden konnten. Die Regierungen in diesen Ländern waren, trotz ihrer demokratischen Verfassung, mehr oder weniger stark ausgeprägt autokratisch. Das galt zum Beispiel für Mexiko,
Paraguay, Bolivien und in eingeschränkter Form auch für Brasilien. Diese Länder waren bereit, Sonderrechte zu erteilen, wenn die Mennoniten Landstriche besiedelten, in die sonst niemand gehen wollte.
Das angestrebte Ziel der mennonitischen Einwanderer und der Bedarf in den genannten Ländern kamen sich also weitgehend entgegen. Der Historiker Henry C. Smith brachte das auf der Mennonitischen Weltkonferenz in Amsterdam 1936, auf der es auch um die mennonitischen Neusiedlungen in
Paraguay und Brasilien ging, zum Ausdruck: „Eine Demokratie ist, so unwahrscheinlich das klingen mag, oft weniger tolerant gegen Gewissensskrupel als eine Autokratie. In Ländern, in denen die Herrscher nicht weiter von der öffentlichen Meinung abhängig sind, kann immer noch eine Ausnahmestellung gewährt werden, besonders wenn irgend welche materiellen Vorteile, wie die Besiedlung gewisser Ländereien, in Betracht gezogen werden können."
(9)Das galt in Mexiko für die Trockengebiete im Hochland des Nordens, in
Paraguay für den unerschlossenen
Chaco, in Brasilien für den Urwald in Santa Catarina und in Bolivien für die Umgebung von Santa Cruz.
In diesen Ländern war es jedenfalls möglich, geschlossene mennonitische Siedlungen anzulegen, die dann die Voraussetzungen dafür boten, das russländische Erbe weiter zu pflegen.
3.3.
Landbesitz, Dörfer und Kolonien
Die noch unter Katharina II. herausgegebene Kolonialordnung enthielt genaue Anweisungen über den
Landbesitz und auch über die Struktur der Siedlungen. Die eingewanderten Kolonisten wurden den Staatsbauern gleichgestellt, denen Land zugewiesen wurde, dessen potentieller Eigentümer aber der Staat blieb.
In der Kolonialordnung heißt es im Artikel 670, dass „alle zur Ansiedlung der Kolonisten zur Verfügung stehenden Ländereien ihnen zum unbestreitbaren und ewigen Besitz zugeeignet werden, jedoch nicht zu persönlichem, sondern zu gemeinsamem Besitz des Dorfes." Jede
Familie erhielt 65 Desjatinen Land mit der Verordnung in Artikel 671, dass „sie auch nicht den geringsten Teil ihres Landes ohne Einverständnis der über sie eingesetzten Obrigkeit verkaufen darf, damit diese Ländereien niemals in die Hände von Außenstehenden gelangen können."
(10)Adolf Ehrt nennt diese Form des Landbesitzes „individualistische Feldgemeinschaft", und sie hatte sehr spezifische Folgeerscheinungen. Sie wurde, wohl zunächst von den Einwanderern ungewollt, zu einer Garantie für die Geschlossenheit der jeweiligen Siedlung. Für die Mennoniten kam noch hinzu, dass sich diese Form des Landbesitzes mit ihrem Gemeindeverständnis, d. h. mit der
Absonderung von der Welt, die für sie außerhalb der Siedlung lag, deckte.
Überall in den neuen Siedlungen Lateinamerikas haben die mennonitischen Siedler, wo es nur anging, diese Form des Landbesitzes angestrebt und beibehalten. Hier war damit nun bewusst die Absicht verbunden, die Geschlossenheit, die meist durch kein Gesetz abgesichert war, zu erhalten. Der ganze Landkomplex, auf dem die jeweilige
Kolonie angelegt wurde, war auf einen gemeinsamen Landtitel gekauft worden. Jeder Siedler bekam sein Land wohl zu eigenem Besitz, aber nur auf einen internen Zessionsvertrag. Niemand konnte sein Land ohne Zustimmung der Dorf- oder Koloniegemeinschaft verkaufen, und niemand konnte hier ohne Zustimmung der ganzen Gemeinschaft kaufen. So blieb die Geschlossenheit abgesichert wie in Russland, solange alle Einwohner damit einverstanden waren.
Auch die Siedlungsform in Russland entsprach der Kolonialordnung. Die Kolonisten siedelten in Dörfern, die die kleinste kommunale Einheit bildeten und die etwa auch der „mirskoe" der Russen entsprach. In den Siedlungen setzte sich das Straßendorf durch.
(11)Für die Mennoniten war das Dorf schon von Preußen her eine Siedlungsform, die auch ihrem Gemeindeverständnis entgegenkam. Es war die kleine, überschaubare und kontrollierbare Landgemeinde mit der Kirche und der Schule.
(12) So kamen sich auch hier, wie beim
Landbesitz, die Anweisungen der russischen Regierung und das Bedürfnis der mennonitischen Gemeinden entgegen.
Das Dorf als Siedlungsform hatte sich in Russland so eng mit dem mennonitischen Gemeindeverständnis verbunden, dass es den Auswanderern, die 1874 nach Kanada zogen, schwer wurde, sich auf das dortige „home steading" einzustellen, wo jeder Farmer auf seinem eigenen Land wohnte. In
Manitoba suchten die mennonitichen Siedler einen Ausweg, indem zum Beispiel sechzehn Farmer ihre Landkomplexe so zusammenlegten, dass auf der Mittelachse ein Straßendorf wie in Russland angelegt werden konnte.
(13)Überzeugend und beindruckend sind die Karten der
Mennonitenkolonien in Mexiko,
Paraguay und Bolivien. Es sind ausschließlich Straßendörfer, in ihrer Form meist begünstigt durch ebenes Land, auf dem sie angelegt wurden, wie in Russland.
Ein weiteres Erbe, das allerdings eher auf die Weichselniederung in Preußen zurückzuführen ist, sind die
Dorfnamen: Osterwick, Bärwalde, Rosenort, Montau und viele andere. Sie wanderten mit nach Russland und von dort weiter nach Lateinamerika. Doch auch Namen aus Russland sind mitgewandert wie Chortitza, Kronstal, Kronsgart, Kronsweide.
(14)Ein weiterer Begriff, den die Siedlungsstruktur der Ausländer in Russland prägte, war die
Kolonie. Im Kolonialgesetz von 1764 heißt es: „Die Immigranten sind in Bezirken anzusiedeln. Die Bezirke sind zirkelförmig anzulegen, derart, dass zum Beispiel der Umfang eines Bezirkes nicht weniger als 60 und nicht mehr als 70 Werst betrage und in sich genügend Grund und Boden enthalte zur Dotierung von 1000 Familien."
(15)Für den Begriff
Bezirk, der immer eine Anzahl Dörfer einschloss, ist dann
Kolonie gesetzt worden, der auch dem russischen Sprachgebrauch entsprach. „Naschi Kolonii" heißt das eben zitierte Buch von A. Klaus. Chortitza, Molotschna, Sagradowka, Memrik, Borosenko sind einige der Kolonienamen.
Der Begriff „
Mennonitenkolonien" ist dann mit nach Lateinamerika gewandert, und es gibt sie heute noch von Mexiko bis Uruguay. Immer handelt es sich um eine Anzahl von Dörfern, meist mit einem Zentrum, die durch eine wirtschaftliche, kulturelle und administrative Infrastruktur zusammengeschlossen sind. Im spanischen und portugiesischen Sprachbereich sind sie als „Colonias Mennonitas" bekannt und ein selbstverständlicher Begriff.
Hier einige Namen:
Fernheim,
Menno,
Neuland,
Volendam,
Friesland,
Sommerfeld in
Paraguay, Witmarsum und Colonia Nova in Brasilien, Morgenland oder Swift Current in Bolivien,
Santa Clara oder Santa Rita in Mexiko.
3.4. Schulzen und Oberschulzen
Es entsprach dem Pragmatismus der russischen Regierung, den Ausländerkolonien eine gewisse Selbstverwaltung aufzuerlegen. Einmal versprach sie sich davon ein erhöhtes Maß an Produktivität, zum anderen die Vermeidung von Konfliktsituationen. Dazu sollte auch die glaubensmäßige Isolierung beitragen. Lutheraner, Katholiken und Mennoniten mussten sich in gesonderten Kolonien ansiedeln. An Integration und Assimilation scheint die Zarenregierung nicht interessiert gewesen zu sein. „Die Regierung umgab unsere Kolonien gewissermaßen mit einem Zaun," schrieb David H. Epp.
(16)Für die interne Verwaltung der Kolonien lagen ab 1769 genaue Anweisungen vor, die nach und nach durch Instruktionen und Ukas ergänzt wurden. Das Kolonialgesetz, ab 1818 in den Kontoren der Fürsorgekomitees in Odessa, Jekaterinoslaw, Kischinew und Bessarabien niedergelegt, war zugleich Gesetzbuch, Dorfrecht und Strafkodex. In 78 Paragraphen waren die Bestimmungen festgelegt.
(17)Die vorgeschriebene Struktur der Verwaltung
macht einen ausgesprochen demokratischen Eindruck, mit Wahl- und Stimmrecht aller beteiligten Bürger eines Dorfes oder einer
Kolonie.
In jedem Dorf, der kleinsten kommunalen Einheit, wurde von allen stimmberechtigten Bürgern, wozu allerdings nur die Land besitzenden Familienhäupter zählten, ein
Dorfschulze auf drei Jahre und zwei Beisitzer auf zwei Jahre gewählt. Auf je zehn Dorfbürger wurde ein
Zehntmann (Dessatnik) gewählt, der das Dorf auf der Kolonieversammlung zu vertreten hatte.
In ähnlicher Weise war die Verwaltung der
Kolonie geregelt. Dem Gebietsamt (Wolost) stand ein durch Wahl aller stimmberechtigten Siedler bestimmter
Oberschulze vor, zusammen mit zwei ebenfalls gewählten Beisitzern. Das Gebietsamt hatte sowohl die Beschlüsse der Kolonieversammlung als auch die Anweisungen des Fürsorgekomitees auszuführen.
Das
Fürsorgekomitee war zugleich auch Kontrollorgan der Regierung, und sein verlängerter Arm war der Landwirtschaftliche Verein, als dessen erster Vorsitzender sich Johann Cornies ( 1789 – 1848) einen Namen gemacht
(18)Diese von den Zaren verordnete Selbstverwaltung wurde für die Mennoniten, die Russland verlassen hatten, zum Traum- und Wunschbild des Zusammenlebens, andererseits auch zum Rettungsanker während der oft schwierigen Pionierarbeit in unerschlossenen Gebieten.
„Etwas sehr Wertvolles haben die Kolonisten bei ihrer weitgehenden Selbstverwaltung in Russland gelernt, nämlich in allen Wirtschafts- und Verwaltungsfragen geschlossen zusammenzustehen." So schrieb Walter Quiring 1936 in seinem Buch über das Siedlungsunternehmen der
Mennoniten in Paraguay.
(19)Tatsächlich ist das russländische Verwaltungssystem in allen
Mennonitenkolonien Lateinamerikas erhalten geblieben, wenn oft auch in abgewandelter Form und der jeweiligen Umwelt angepasst. Am ausgeprägtesten und unverfälschtesten kann man es heute in
Paraguay vorfinden. Die ersten mennonitischen Einwanderer siedelten hier in dem noch völlig unerschlossenen
Chaco, weitab von der Zentralregierung des Landes und von jeder Infrastruktur. Sie waren in jeder Beziehung auf sich selbst angewiesen, wirtschaftlich, kulturell und administrativ, und sie gingen sofort daran, das von Russland her bekannte System umzusetzen. Alles war da, die Schulzen und die Dorfversammlung, der
Oberschulze und die Kolonieversammlung, und alle gefassten Beschlüsse waren verbindlich und wurden ausgeführt.
So ist es bis heute, wenn auch in abgewandelten Formen und in Anpassung an die Umweltbedingungen, geblieben, in
Paraguay und weitgehend auch in den anderen Ländern mit
Mennonitenkolonien.
(20)3.5. Ordnung und Gerichtsbarkeit
Die nach Russland gerufenen Ausländer waren durchaus keine homogene Gesellschaft. Nicht selten, jedenfalls in den ersten Jahren der Einwanderung, waren es nicht gerade die besten Elemente, die sich in Deutschland zur Auswanderung entschlossen hatten. Das zog in den neuen Siedlungen dann manche Schwierigkeiten nach sich. Deshalb ließ Alexander I. in einem Ukas vom 20. April 1804 anweisen, bei der Auswahl der Einwanderer sehr sorgfältig vorzugehen.
(21)Ebenso wie um die Verwaltung war der Regierung auch um die Ordnung in den neuen Kolonien zu tun, und auch hier verstand sie es, den größten Teil der Verantwortung auf den Sonderstatus der Siedlungen abzuwälzen. In der Kolonialordnung waren auch die Anweisungen für die innere Ordnung der Ausländerkolonien gegeben.
Die richterliche Instanz im Dorf war der
Schulze mit seinen Beisitzern. Das Dorfgericht war die erste Instanz in Zivilsachen, das Koloniegericht zweite Instanz. In größeren Zivil- und Strafsachen war der
Oberschulze erste Instanz. Die Wolost war auch oberste Strafvollzugsbehörde. Nur schwere Strafsachen unterlagen den ordentlichen Gerichten.
(22)Das gleiche galt auch für die öffentliche Ordnung. Auch die Polizei war Angelegenheit des Dorfes und der
Kolonie. Ein gewählter „Desjatski" war Polizist im Dorf und ein „Sotski" in der Wolost. Dem Sotski kam auch die Oberaufsicht in Sachen Ordnung zu.
(23)Für die Mennoniten war diese eigene Gerichtsbarkeit ein Problem für sich. Ihrem eigentlichen Wesen nach waren sie eine Glaubensgemeinde, die nach der Bergpredigt leben wollte, also in absoluter Gewaltlosigkeit. Streitfragen innerhalb der
Gemeinde sollten nach der Lehre der Apostel gütlich in der
Gemeinde geregelt werden, wo dann der Ausschluss die härteste Strafe war. „Niemand soll um weltliche Dinge hadern und streiten oder vor Gericht gehen, noch weniger zu Gericht sitzen," so interpretierten die Mennoniten noch in Preußen die Forderung des Neuen Testaments.
(24)Doch ein mennonitisches Dorf oder eine
Kolonie in Russland war keine Glaubensgemeinde mehr. Die Einwanderer waren eine Siedlungsgemeinschaft geworden, zu der durchaus auch schwarze Schafe gehören konnten. Die Siedler hatten vollen Anspruch auf Ordnung und Sicherheit, und dafür genügte die Bergpredigt allein nicht. So galten denn in allen
Mennonitenkolonien die gleichen Ordnungsvorschriften wie in allen anderen Ausländerkolonien auch, und sie waren selber dafür verantwortlich.
David H. Epp beschreibt diesen Übergang von der neutestamentlichen Lehre zur weltlichen
Gerechtigkeit in Russland sehr deutlich: „Die Gerichtsbarkeit befand sich anfangs in den Händen des Direktors, welcher zusammen mit dem Kirchenältesten über Recht und Unrecht zu entscheiden hatte. Diese Vereinigung der unerbittlichen rächenden
Gerechtigkeit mit dem Amt, das die Versöhnung predigt, mag nicht nur dem geistlichen
Vorsteher schwer gefallen sein, sondern war auch eine Ursache der anfänglichen Verwicklungen. Wir können daher verstehen, wenn ein weitsehender Kirchenlehrer jener Epoche bei der ersten Nachricht von der Einführung einer geregelten Gebietsverwaltung ausrufen konnte: ,Gottlob, dass wir ein Gebietsamt bekommen!` Zugleich mit dem Gebietsamt ging auch die Gerichtsbarkeit an den Oberschulzen über."
(25) Das geistliche Amt war entlastet.
Auch diese Form der Gerichtsbarkeit, wie sie die Zaren verordnet hatten, ist mit den Mennoniten in die Neue Welt gewandert, obwohl immer auch verbunden mit der zwiespältigen Haltung dazu. Zum Teil aus Mangel an zuverlässigen polizeilichen und richterlichen Instanzen in der neuen Heimat, zum Teil aber auch aus dem Bedürfnis, Streitfälle unter den eigenen Leuten möglichst selbst regeln zu wollen, richteten die Siedler eine eigene Rechtsordnung nach jenem Vorbild in Russland ein.
Doch ein Unterschied zwischen jener Situation im alten Russland und der in der jeweiligen neuen Heimat machte sich sehr bald bemerkbar. Während dort die rechtlichen Verhältnisse durch staatliche Verordnungen abgesichert waren, mußten sich die Siedler hier für ihre geschlossenen Siedlungen eine eigene Ordnung schaffen. Solche Ordnung kann aber nur so lange funktionieren, wie die Mitglieder der Gesellschaft bereit sind, auch hinter dieser Ordnung zu stehen. Da das aber längst nicht immer der Fall ist, und der einzelne sein Recht auch außerhalb der Gemeinschaft suchen kann, wenn er unzufrieden ist, bröckelte diese Ordnung mancherorts mit den Jahren.
Die Fragen der öffentlichen Ordnung und des Rechts gingen dann immer mehr in die Hände der zuständigen Stellen des Staates über, obwohl viele dem russländischen Modell nachtrauerten.
(26) 4. Glaubensgemeinschaft und Siedlungsgemeinschaft
4.1. Die
Gemeinde ohne Flecken und Runzeln
Wie im Fall der Gerichtsbarkeit schon deutlich geworden ist, wurde Russland mit seiner Kolonialordnung nicht nur der große Lehrmeister. Es brachte die mennonitische Glaubensgemeinschaft auch in eine Konfliktsituation, aus der sie bis heute, jedenfalls überall dort, wo es selbstverwaltete
Mennonitenkolonien gibt, nicht mehr herausgekommen ist.
Die Lehre von der reinen
Gemeinde „ohne Flecken und Runzeln" nach Eph. 5, 27, zu der nur überzeugte Gläubige gehören sollten, war einmal der Grundgedanke des 1525 in der Schweiz entstandenen Täufertums gewesen. Diese Lehre brachte die neuen Gemeinden sehr bald in Konflikt mit den jeweiligen Staatskirchen und dem Staat. Unter dem Druck der Verfolgung wurden die Gemeinden und vor allem ihre Führer unstet und flüchtig, was durchaus auch ihrem Wesen, nicht von der Welt zu sein, entsprach.
(27)In den Nachfolgegruppen des Täufertums hat es unterschiedliche Entwicklungen gegeben, wodurch das heutige Erscheinungsbild des Mennonitentums weltweit ein buntes Spektrum aufweist. Einer der Flucht- und Wanderwege der
Täufer-Mennoniten führte von Holland über das untere Weichselgebiet nach Russland. Auf der Wanderung übertrug sich die innere Geschlossenheit der
Gemeinde allmählich auf die ganze Sippengemeinschaft, zu der nun nicht mehr nur überzeugte und fleckenlose Mitglieder gehörten. In Russland ist dann aus der Glaubensgemeinschaft eine Lebensgenossenschaft geworden, wie Leonhard Froese es formuliert.
(28) Man könnte auch sagen, dass sie eine ganz normale menschliche Gesellschaft wurde.
Das Kolonialgesetz mit seinen Verordnungen zur inneren Struktur und zur Isolation nach außen hin war dem mennonitischen Bedürfnis nach
Absonderung entgegengekommen. Doch gerade das, vor dem sie geflohen waren und was sie nach ihrer Schriftauslegung als „Welt" bezeichneten, das alles hatten sie nun in ihren Kolonien selbst zu bewerkstelligen.
Dieser Wandlungsprozess ist in Russland über Jahrzehnte so langsam und organisch verlaufen, dass die Beteiligten ihn selber kaum wahrnahmen, ihn jedenfalls nicht als störend empfanden. Peter M. Friesen schrieb 1911 im Rückblick auf diesen Prozess in voller Zustimmung mit dem Hinweis auf Johann Cornies, den maßgebenden Mitgestalter der mennonitischen Selbstverwaltung: „So hatte also eine breite Gruppe der Taufgesinnten, die Südrussische Mennonitische Brüderschaft, zum ersten Mal in der Geschichte ein gemeinsames bürgerliches Oberhaupt in der Person eines mennonitischen Mitbruders! Und diese Regentschaft ist uns wohl bekommen."
(29)Wie man diesen Prozess auch beurteilen will, als eine Fehlentwicklung des Täufertums oder als eine unausweichliche Entwicklung zu einem „modus vivendi" einer christlichen
Gemeinde oder Kirche in dieser Welt, er hatte sich in Russland so bewährt, dass er auch in den späteren
Mennonitenkolonien anderer Länder seine Anwendung fand. Überall dort gab es nun neben dem kirchlichen auch ein weltliches Amt, das ebenfalls von Mennoniten bekleidet wurde. Auf dieses Erbe, das die Zaren Russlands den Mennoniten beschert hatten, wollten sie auch in Lateinamerika nicht mehr verzichten.
(30)4.2. Das mennonitische Volk
Der Ausdruck „mennonitisches Volk", liebevoll oft auch „unser Völklein", ist in Russland geprägt worden, und er hängt eng zusammen mit dem oben erwähnten Wandlungsprozess. Die Mennoniten, der Herkunft nach eine Freikirche, wie oben deutlich geworden ist, waren hier zu einer Sippengemeinschaft geworden, die durchaus auch als Volksgruppe angesehen werden konnte.
In Abhandlungen und Gedichten war, unbekümmert um den Widerspruch in sich, oft von einem mennonitischen Volk die Rede. Der Vergleich mit dem Volk Israel lag dann nahe. Das gab auch dem Volkscharakter einen biblischen Anstrich, und man fand ohne Schwierigkeiten manche Parallelen. Heinrich Görz dichtete zur Vierhundertjahrfeier 1925 in Russland:
Ein kleines Völklein sind wir nur auf Erden,
Das hier kein Vaterland sein Eigen nennt,
Das einem Fremdling, einem Pilger gleichet,
Weil’s eine bess’re, eine ew’ge Heimat kennt.
Wie war es zu dieser Volkwerdung gekommen? Eine wesentliche Rolle dabei hat der Isolationscharakter der
Gemeinde, die sich von der „Welt" absondern wollte, gespielt. Ein Element dieser
Absonderung bestand darin, dass die
Gemeinde ihren Mitgliedern nur die Heirat mit Mitgliedern erlaubte. Sie verbot die „Außentrau" mit Gliedern anderer Religionsgemeinschaften
Diese Form der Endogamie hat sich dann später auf die ganze Sippengemeinschaft übertragen, und sie fand ihre stärkste Ausprägung in den Kolonien in Russland. Der Isolationscharakter der Siedlungen förderte auch die ethnische Abgrenzung, verstärkt durch die kulturellen und sprachlichen Unterschiede zur Bevölkerung der Umgebung. Die Mennoniten heirateten unter sich, und das war beinahe selbstverständlich. „En wann du west gohne no de Russemejal, dann bruckst du nich kome no mi," sangen die Jugendlichen in einem plattdeutschen Lied. (Und wenn du willst gehen zum Russenmädchen, dann brauchst du nicht kommen zu mir).
Ein äußeres Zwangsmittel, dass diese ethnische Endogamie zusätzlich förderte, war der Umstand, dass Kinder aus Mischehen rechtlich nicht mehr als Mennoniten galten und dann des Privilegiums verlustig gingen. So konnte Adolf Ehrt in seiner Studie von 1932 eine „mennonitischen Physis" feststellen, die sich in Russland herausgebildet hatte.
(31)Man kann also von einem mennonitischen Volkscharakter sprechen, der neben dem physischen Erscheinungsbild in der
Kultur, im Brauchtum und vor allem in einer gemeinsamen Sprache, dem sog. Mennonitenplatt, zum Ausdruck kam.
Dieser Volkscharakter, der in Russland seine Form gefunden hatte, ist heute eines der stärksten Wesensmerkmale der Mennoniten in Lateinamerika. Sie erkennen sich gegenseitig nicht in erster Linie an Elementen ihres Glaubens, die bei den verschiedenen Gemeinderichtungen recht unterschiedlich sein können, sondern am ehesten an der plattdeutschen Sprache, an den
Familiennamen und an dem auf Brauchtum und Sitte beruhenden Verhalten.
Auch in den Augen der jeweiligen Landesbevölkerung sind die Mennoniten in erster Linie Angehörige einer Volksgruppe, die sich durch Aussehen und Sprache, durch wirtschaftliche Tüchtigkeit oder auch durch gewisse Tugenden oder Untugenden auszeichnen. So mag es auch schon in Russland gewesen sein.
5. Das kulturelle Erbe
Leonhard Froese formulierte jenen Wandlungsprozess in Russland so: „Die Gemeinschaft entwickelte neben dem Glaubenssystem weitgehend auch ein eigenes Wirtschafts-, Rechts-,
Politik-, Sozial-, Sitten- und Kultursystem."
(32) Die Kulturelemente, die sich auf dem langen Wanderweg der Mennoniten von Westen nach Osten entwickelten, haben sich dann in Russland konsolidiert. Einige davon sollen hier verdeutlicht werden.
5. 1. Wirtschaftliche und soziale Elemente
Fleiß und Sparsamkeit sind als besondere Tugenden der Mennoniten gerühmt worden, und sie haben oft zu einem Wohlstand geführt, der die Siedlungen von ihrer Umgebung abhob. Ein anderer wesentlicher Zug kam in den meisten Fällen noch dazu, der sowohl auf die christliche Gesinnung als auch auf die sippenmmäßige Verbundenheit zurückzuführen ist. Das war der Gemeinschaftssinn, ein gegenseitiges Verantwortungsgefühl, verbunden mit Hilfsbereitschaft. Das kam in Russland in einigen Regelungen zum Ausdruck, die dann alle Mitglieder mit einbezogen und sie in die Pflicht nahmen.
Eine davon war das
Scharwerk, auch Reihendienst genannt. Es war eine geregelte Gemeinschaftsarbeit, zu der alle Bewohner eines Dorfes verpflichtet waren. Das
Scharwerk kannten die Mennoniten schon von Preußen her, wo es ursprünglich ein Frondienst der Landarbeiter gewesen war. Die Mennoniten hatten es dort in ihren Dörfern zu einer alle verpflichtenden Gemeinschaftsarbeit umgewandelt, um so gemeinsam den Deichbau und die Entwässerung durchführen zu können.
Eine andere ähnliche Einrichtung waren die
Zechen, eine kompliziertere Form der Gemeinschafts- und Pflichtarbeit, die einem bargeldlosen Währungssystem gleichkommen konnte. Bei der Zeche wurde geleistete Arbeit und aufgebrachte Zeit in einen bestimmten Wert umgerechnet.
(33)Beide Elemente waren die Voraussetzung dafür, dass die zu einem Dorf oder zu einer
Kolonie gehörenden gemeinschaftlichen Einrichtungen wie Straßen, Schulen, Zäune, Gräben usw. aufgebaut und unterhalten werden konnten. Grundvoraussetzung dafür war, dass alle bereit waren, die Verpflichtungen auch zu erfüllen. Sie waren mit ein Grund für den oft mit Stolz und vielleicht auch mit ein bisschen Überheblichkeit gerühmten mennonitischen Erfolg. Sie mögen sogar mit die Ursache dafür gewesen sein, dass sich die
Mennonitenkolonien vor den anderen Ausländerkolonien in Russland auszeichneten, wie Karl Lindemann hervorhebt, der den Mennoniten „den höchsten Platz unter allen Völkern Russlands" zuweist.
(34)Zwei andere Einrichtungen mögen nicht weniger zur Funktion des Zusammenlebens und zum Aufschwung beigetragen haben, die
Feuerversicherung und das
Waisenamt.
Die
Feuerversicherung auf Gegenseitigkeit, bei der Anfälligkeit der strohgedeckten Häuser eine lebensnotwendige Einrichtung, brachten die Mennoniten aus Preußen mit. Nur im Fall eines Brandes wurde eine Auflage auf alle Versicherten im Verhältnis zum Wert ihrer versicherten Güter erhoben. Sie schloss auch die gegenseitige Hilfe aller Beteiligten bei dem Betroffenen mit ein. Die
Feuerversicherung ist dann auch von anderen deutschen Siedlungen in Russland übernommen worden.
Die Einrichtung eines
Waisenamtes zur Regelung der Erbangelegenheiten war in der Kolonialordnung festgelegt worden. Zusätzlich heißt es in dem speziell für die Mennoniten um 1800 von Kaiser Paul I. gegebenen
Privilegium: „Anbei verstatten wir auch den Dorfgemeinden das Recht, nach ihren eigenen hergebrachten Gebräuchen Vormünder über die den Unmündigen zugehörigen Nachlassenschaften der Verstorbenen zu bestellen."
(35)In den
Mennonitenkolonien Russlands wurden das
Waisenamt und die Witwen- und Waisenkasse zu einer festen und unentbehrlichen Einrichtung. Die Kasse war gleichzeitig eine Art Bank, die die deponierten Gelder gegen feste Zinssätze auslieh. Eine Teilungsordnung regelte alle Erbschaftsangelegenheiten bis ins Einzelne.
(36)All diese wirtschaftlichen und sozialen Einrichtungen sind mit den Mennoniten aus Russland nach Lateinamerika mitgewandert. Hier wurden sie zu unentbehrlichen Elementen der Kolonisation.
Das gilt für das
Scharwerk und die Zechen. Bei der Armut, die meist bei einer Ansiedlung vorherrschte, und bei dem Mangel an Geldmitteln boten diese Elemente die Möglichkeit, alle gemeinschaftlichen Einrichtungen im Dorf oder auch in der
Kolonie aufzuführen.
Walter Quiring berichtet, um nur ein Beispiel zu nennen, von dem Dorf Schönwiese in der
Kolonie Fernheim im
Chaco von
Paraguay aus dem Jahr 1931, ein Jahr nach der Gründung der
Kolonie, dass jede Wirtschaft im Dorf 114 Arbeitstage, also 36% der Arbeitstage des Jahres, für Gemeinschaftsarbeit aufbringen musste.
(37)In der gleichen
Kolonie wurde im September 1930 , sofort nach der Ankunft aus Europa, folgendes festgelegt: „Ein Tagelohn physischer Arbeit sind 30 Zechen, ein Tagelohn geistiger Arbeit 40 Zechen. Einem Fußgänger, der für seinen Auftrag 30 km zurücklegt, wird ein Tag physischer Arbeit angerechnet. Ein Fuhrwerk verdient 0,01 Zeche für die Beförderung von 1 kg Fracht pro km." Alle Einzelheiten waren in einem Zechen-Statut festgelegt, und die Kolonieverwaltung führte genau Buch über alle Leistungen der Siedler.
(38)Die
Feuerversicherung und das
Waisenamt waren den in
Paraguay eingewanderten Mennoniten so wichtig, dass sie sie in das bei der Regierung 1921 beantragte
Privilegium mit aufnehmen ließen. Sie stehen im Gesetz 514, Artikel 1, Absätze 3 und 4.
5.2. Das Schulwesen
Das Schulwesen der Mennoniten in Russland hat tiefgreifende Wandlungen durchgemacht, deren Differenziertheit sich dann auch in Lateinamerika bei den in ihrer Lebenshaltung sehr unterschiedlichen Siedlern niederschlug. Die Schule war bei den Mennoniten in Westpreußen eine Angelegenheit der Glaubensgemeinde geworden, weil sie die Voraussetzung dafür bot, die Heilige Schrift lesen zu können. Zudem wurde sie auch als Sicherung des Nachwuchses für die
Gemeinde angesehen. Die Mennoniten hatten hier um 1700 das Recht erhalten, in ihren Dörfern eigene Schulen mit eigenen Lehrern zu unterhalten.
(39)Die in Russland eingewanderten Mennoniten richteten dann in gewohnter Weise sofort Schulen ein, die alle Kinder pflichtgemäß besuchen mussten. Obwohl die Schulen meist von minderer Qualität waren, bewirkten sie doch, dass es unter den Mennoniten keine Analphabeten gab, während der Anteil der russischen Bevölkerung mit Elementarbildung noch Ende des 19. Jahrhunderts nur 19 % betrug.
Man kann bei den Mennoniten in Russland von zwei Strömungen in ihrer Stellung zur
Bildung sprechen. Eine Gruppe lehnte konsequent alle Neuerungen im Schulwesen ab. Diese konservativen Gruppen verließen Russland, zum Teil gerade aus diesem Grund, um 1874.
(40) Sie zogen nach Kanada und von dort nach Mexiko,
Paraguay und Bolivien, immer mit der Absicht, die Eigenart ihrer Schulen zu erhalten.
Die andern machten im Lauf der Jahrzehnte mehrere Reformen durch, zum Teil aus eigener Initiative, dann aber auch auf Druck der russischen Regierung. Vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges gab es in allen
Mennonitenkolonien Russlands zusammen 450 sechsjährige Elementarschulen, 23 vierjährige Fortbildungsschulen, Zentralschulen genannt, und zwei Lehrerseminare.
(41)Die aus Russland ausgewanderten oder geflüchteten Mennoniten verfügten in der Mehrzahl nicht nur über eine gute Allgemeinbildung, sie nahmen auch das Wissen um den Aufbau eines tragfähigen Bildungswesen mit.
Vor allen Dingen war es für diese Neusiedler, ob konservativ oder fortschrittlich, selbstverständlich, dass in jedem Dorf eine Schule gebaut werden musste, bei den Fortschrittlichen auch ein Fortbildungsschule. In Mexiko,
Paraguay und Bolivien sind diese Schulen heute noch durch ein
Privilegium abgesichert, das ihnen ihre Eigenart in Sprache und Religionsunterricht garantiert.
(42)Eine andere Entwicklung nahm das Schulwesen der Mennoniten in Brasilien. Ihnen wurde kein
Privilegium zugestanden, und ihr Schulwesen wurde sehr bald der Integration unterworfen.
(43)Zusammenfassung
In diesen Ausführungen ist deutlich geworden, dass das Mennonitentum in Russland seit der Einwanderung um 1789 bis etwa zum Ende des Ersten Weltkrieges ein Prägung erhalten hat, die einmalig ist.
Es kann ohne Einschränkung festgestellt werden, dass in diesem Zeitraum von mehr als hundert Jahren aus der täuferischen Glaubensgemeinde eine homogene Sippengemeinschaft geworden ist, die dann gern als Volk oder Völklein bezeichnet wurde. Ein
Mennonit war nun nicht mehr in erster Linie ein getaufter Gläubiger, sondern der Nachkomme einer ethnisch geprägten Siedlungsgemeinschaft. Obwohl die Anfänge dieser Entwicklung schon im preußischen Siedlungsgebiet liegen, hat das russische Umfeld am stärksten zu dieser Entwicklung beigetragen. Die im
Privilegium und in der Kolonialordnung verankerte Siedlungsform in geschlossenen Dörfern und Kolonien bestärkte die Neigung der Mennoniten zur
Absonderung und zum Isolationismus. Die kulturelle Verschiedenheit zwischen den Eingewanderten und der einheimischen Bevölkerung begünstigte die Entwicklung zu einem typischen russlanddeutschen Mennonitentum.
Von den Mennoniten selbst ist diese Lebensform, in der sich der Glaube mit allen Ebenen des Lebens, der sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen, verband, als ein Idealzustand empfunden worden. Ob sie Russland dann durch Auswanderung oder später die Sowjetunion durch Flucht verließen, ihr Traumziel blieb, wieder eine Lebensform in einer geschlossenen Mennonitenkolonie zu finden.
Nirgendwo hat sich dieser Traum besser verwirklichen lassen als in einigen Ländern Lateinamerikas. Hier kamen sich der Bedarf des jeweiligen Einwanderungslandes und der Wunsch der einwandernden Mennoniten in einer Weise entgegen, die die Wiederherstellung der in Russland geprägten
Mennonitenkolonien ermöglichte.
Das russländische Erbe war für die Mennoniten in Lateinamerika ein so hoch eingeschätztes Gut, dass die meisten es bis in die Gegenwart hinein gepflegt haben, wenn auch mit Abwandlungen und Variationen. Die Bezeichnung „russlanddeutsche Mennoniten" rechtfertigt sich auch heute noch als Sammelbegriff für diese sozioreligösen Kolonisatoren von Mexiko bis Argentinien. Als ein Musterbeispiel kann dabei
Paraguay bezeichnet werden, weil sich hier gerade die besten Voraussetzungen sowohl von Seiten der Einwanderer als auch von den Umweltbedingungen her ergeben haben.
Fussnoten:
| Vortrag für das internationale Symposium zum Thema „Chortitza ’99: Mennoniten im zaristischen Russland und in der Sowjetunion" in Saporoschje, Ukraine, vom 27. – 30. Mai 1999. Da der Autor verhindert wurde, an diesem Symposium, wie geplant, teilzunehmen, stellte er seinen Aufsatz für das diesjährige Jahrbuch zur Verfügung. |
| Thiessen, Jack: Mennonitisches Wörterbuch, Marburg , 1977 |
| Töws, John B.: Ein Vaterland verloren, Winnipeg, 1971, S. 15 – 28, und Walter Quiring: Rußlanddeutsche suchen eine Heimat, Karlsruhe, 1938, S. 109 |
| Friesen, Martin W.: Neue Heimat in der Chacowildnis, Altona, Manitoba, 1987, 1 – 12, dazu auch Sawatzky Leonhard: Sie suchten eine Heimat, Marburg, 1986 |
| Klassen, Peter P.: Die rußlanddeutschen Mennoniten in Brasilien, Band 2, Bolanden- Weierhof,1998, S. 392 – 404 |
| |
| Klassen, a.a.O., S. 120 |
| Stumpp, Karl: Die Auswanderung der Deutschen nach Russland in den Jahren 1763 – 1892, Tübingen, 1978, S. 14 |
| |
| Ehrt, Adolf: Das Mennonitentum in Russland von seiner Einwanderung bis zur Gegenwart, Berlin, 1932, S. 34 |
| Ehrt, a.a.O., S. 36 |
| Penner, Horst: Die ost- und westpreußischen Mennoniten, Karlsruhe, 1978, S. 140 |
| Wilhelmi, Herbert und Rohmeder, Wilhelm: Die La Plata-Länder Argentinien, Paraguay und Uruguay, Braunschweig, 1963, S. 204 |
| Vergl. Schroeder, William und Huebert, Helmut T.: Mennonite Historical Atlas, Winnipeg, 1990 |
| Klaus, A.: Unsere Kolonien, (übersetzt von J. Toews, Odessa, 1887), S. 29 |
| Epp, David H.: Die Chortitzer Mennoniten (Odessa 1889), Neudruck Steinbach, Manitoba, 1984, S. 73 |
| Haberl, Mathilde in: Heimatbuch der Deutschen aus Russland, 1978 – 1981, S. 169 |
| Stach, J.: Die deutschen Kolonien in Südrußland, Prischib, 1904, S. 26 |
| |
| Klassen, a.a.O. S. 217 ff |
| Haberl, a.a. O. S. 169 |
| Ehrt, a.a.O. 37 |
| Lohrenz, Gerhard: Sagradowka, Winnipeg,1947, S. 60 |
| Penner, a.a.O. S. 167 |
| Epp, a.a.O. S. 76 |
| Klassen, a.a.O.: S. 223 ff |
| Littel, Franklin H. in: Hershberger, Das Täufertum, Erbe und Verpflichtung, Stuttgart, 1963, S. 116 |
| Froese, Leonhard: Das pädagogische Kultursystem der mennonitischen Siedlungsgruppe in Russland, Göttingen, 1949 II |
| Friesen, Peter M.: Altevangelische Mennonitische Brüderschaft in Russland (1789 – 1910), Halbstadt, 1911, S. 129 |
| Klassen, a.a.O. S. 348 ff |
| Ehrt, a.a.O. S. 16 |
| Froese, a.a.O. S. XII |
| Klassen, a.a.O. S. 227 |
| Lindemann, Karl: Von den deutschen Kolonisten in Russland – Ergebnis einer Studienreise 1919 – 1921, Stuttgart, 1924, S. 9 |
| Isaac, Franz: Die Molotschnaer Mennoniten, Halbstadt, Taurien, 1908, S. 7 |
| Klassen, a.a.O. S. 288 |
| Quiring, a.a.O. S. 29 |
| Klassen, a.a.O. S. 230 |
| Penner, a.a.O. S. 187 |
| Wiebe, Gerhard: Ursachen und Geschichte der Auswanderung der Mennoniten von Russland nach Amerika, Winnipeg, 1900, S. 98 ff |
| Froese, Leonhard in: Mennonitisches Lexikon, 1967, Band 4, S. 109 |
| Klassen, a.a.O. S. 266ff |
| Klassen, Peter P.: Die rußlanddeutschen Mennoniten in Brasilien, Band 1, Bolanden- Weierhof, 1995, S. 346 ff |
Gerhard Ratzlaff
In
Paraguay gibt es eine Vielfalt mennonitischer Kolonien und Gemeinderichtungen. Die
mennonitische Weltkonferenz verzeichnet in ihrer Statistik von 1998 weltweit 194 Konferenzen bzw. selbständige Gemeinden. Darin steht
Paraguay mit 21 an der Spitze, gefolgt von Kanada mit 15. In
Paraguay leben Mennoniten mit kanadischem, russischem, mexikanischem und amerikanischem Hintergrund. Diese eingewanderten Mennoniten und ihre Nachkommen zählen rund 28.500 Personen, von denen etwa 13.700 getaufte Gemeindeglieder sind. Daneben gibt es 8.500 Getaufte unter den Indianern und schätzungsweise 5.000 unter den Lateinparaguayern, verteilt auf etwa 100 lokale Gemeinden. In der Tat, ein buntes Mosaik von Mennoniten. Die am wenigsten bekannten Mennoniten im Lande sind die mit amerikanischem Hintergrund. Sie sind Inhalt der folgenden Beschreibung, mit der Absicht, ihre Präsenz in
Paraguay hervorzuheben.
Diese Mennoniten leben in den vier folgenden Kolonien:
Luz y Esperanza,
Agua Azul,
Florida y La Montaña. Doch der Begriff
Kolonie (bzw. Siedlung) findet hier nur bedingt Anwendung und darf nicht im Sinne der anderen mennonitischen Siedlungen mit eigenem Verwaltungsapparat und Kooperativen verstanden werden. Sie sind einfach Glaubensgemeinschaften, die auf engem Raum zusammenleben. Auf einen gemeinsamen Landtitel wird wenig Wert gelegt. Wer einen Titel auf seinen Besitz beantragt, dem wird er zugestanden, wenn der Eigentümer das Land an Käufer außerhalb der Siedlung verkaufen möchte. Das ganze Leben der kleinen Gemeinschaften konzentriert sich auf die
Gemeinde und muss von daher verstanden werden.
Mit der Bezeichnung „konservative Mennoniten" sind hier diejenigen gemeint, die an der Lehre der
Täufer nach Inhalt und Form festhalten. Von den traditionellen Mennoniten (
Rio Verde und Durango) unterscheiden sie sich dadurch, dass sie mehr Wert auf den Inhalt der Lehre und ihre Geschichte legen als auf die äußere Form. Das geistliche Leben wird intensiv gepflegt. Wenige Veränderungen sind von ihnen im Laufe der Jahrhunderte eingeführt worden. Wahrscheinlich repräsentieren sie am besten die mennonitische Frömmigkeit in urtäuferischer Form, wie sie in der Vorstellung vieler lebt.
Geschichtlicher Hintergrund
Der geschichtliche Ursprung der konservativen Mennoniten liegt in der Schweiz. Das
Schleitheimer Bekenntnis aus dem Jahre 1527 gilt ihnen, mehr als allen anderen
Mennoniten in Paraguay, als Grundlage in Lehre und Wandel. Unter dem Druck furchtbarer Verfolgungen in der Schweiz wanderten viele, völlig ausgeraubt, in Gebiete und Länder aus, in denen sie geduldet wurden. So kamen sie in das Elsaß und in die Pfalz, wo die Fürsten ihnen erlaubten, in den von Kriegen verwüsteten Ländern zu siedeln.
Ab 1710 begann die Auswanderung aus der Schweiz, dem Elsaß und der Pfalz nach Nordamerika. Diese war möglich dank der großzügigen Hilfe der holländischen Mennoniten (Doopsgezinde). In Pennsylvanien siedelten sie sich in Lancaster county, etwa 100 km westlich von Philadelphia, an. Lancaster county ist eine durch Fruchtbarkeit gekennzeichnete Landschaft. Im Laufe der Zeit kam es hier zu einer großen Konzentration der Mennoniten in den USA.
In Lancaster county liegt Ephrata, wo von 1748 bis 1749 die erste Auflage des Mennonitischen Märtyrerspiegels in deutscher Sprache erschien. In Ephrata lebten die Tunkers (Schwarzenauer
Täufer, engl. Church of the Brethren, die
Taufe erfolgt durch dreifaches Untertauchen), mit pietistisch-mennonitischer Prägung, die, von Deutschland vertrieben, in die Staaten ausgewandert waren und in Gütergemeinschaft lebten. Sie hatten in ihren Reihen eine Anzahl gebildeter Brüder. Ihnen übertrugen die Mennoniten die Übersetzung und den Druck des Märtyrerspiegels.
Die gezielte Absicht dabei war, das biblische Prinzip der
Wehrlosigkeit in einer von Kriegen verworrenen Zeit aufrecht zu erhalten und an die junge Generation weiterzugeben. Überfälle von Seiten der Indianer, dann die Kriege zwischen Franzosen und Engländern, Revolutionen und Unabhängigkeitskriege und der damit verbundene gesellschaftliche Druck stellten die wehrlose Haltung der Mennoniten hart auf die Probe, der nicht alle standhalten konnten. Die Treue zum Glauben der Väter setzte sich dennoch in den Gemeinden durch. Durch ihren Fleiß, ihre Sittsamkeit, einfache Lebensweise und Kleidung stachen sie in der Gesellschaft hervor. Allgemein sind sie am besten unter dem Namen Altmennoniten (nicht zu verwechseln mit den Altkoloniern aus Russland) bekannt. Sie selber bevorzugen heute den Namen Mennonite Church. Zu dieser Linie gehören Persönlichkeiten wie Orie O. Miller, Harold S. Bender, Erie Sauder, Edgar Stoesz u.a.m., die auch in
Paraguay bekannt sind. Im
MCC (seit 1920) waren sie immer stark vertreten und wegweisend.
Doch ab etwa 1900 machte sich auch unter den Altmennoniten in Nordamerika der Modernisierungsprozess bemerkbar. Viele blieben nicht mehr auf dem Land, sie zogen in die Stadt, gründeten eigene Unternehmen und traten in nichtbäuerliche Berufe ein. Schulische Ausbildung auf Universitätsniveau gewann an Bedeutung. Eigene Schulen und Colleges entstanden. Das erforderte engere Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden, und infolgedessen wurde die Schaffung von Organisationen und Konferenzen (Vereinigungen) notwendig.
Neue Gottesdienstordnungen mit
Musik und modernem Gesang fanden den Weg in die
Gemeinde. Anderen Gemeinderichtungen gegenüber wurde größere Toleranz geübt. Die
Gemeindedisziplin wurde gelockert und vom geschlossenen
Abendmahl (nur für Glieder der eigenen
Gemeinde) gingen die Gemeinden zum offenen
Abendmahl über, d.h. auch Gläubige aus anderen als der lokalen
Gemeinde durften am
Abendmahl teilnehmen. Die
Gemeinde wurde dadurch offener und anziehender für Außenstehende, die aus nicht-mennonitischen Kreisen kamen. Doch nicht alle Altmennoniten konnten sich mit dem neuen Trend abfinden. So kam es zu Trennungen in der Lancaster Mennonite Conference (eine unter einer Anzahl von Konferenzen der Altmennoniten), die auch für
Paraguay von Bedeutung werden sollten. Fragen der Ehescheidung und Wiederverheiratung, größere soziale Verantwortung in der Gesellschaft, Gebrauch des Fernsehers und traditionelle Kleidertracht spielten bei dieser Trennung eine entscheidende Rolle. Denjenigen, die sich von der
Konferenz trennten, waren die Kompromisse mit der „Welt" zu groß geworden. Sie meinten, den Glauben der Väter nur in Verbindung mit der alten Lebensweise aufrecht erhalten zu können. Das Prinzip der
Absonderung von der Welt müsse auch durch äußere Formen (z.B. Kleidertracht) sichtbar gemacht werden, meinten die Konservativen. Doch gingen sie nicht so weit, den Andersdenkenden den christlichen Glauben abzusprechen. Auf diese Weise konnten die Gemeindespaltungen nach gegenseitiger Absprache auf friedliche Weise durchgeführt werden. Die Konservativen heben hervor: Unsere Lebensform
macht uns nicht selig, aber sie
macht das Ausleben des christlichen Glaubens leichter und deutlicher sichtbar. 1960 entstand so die Mennonite Christian Brotherhood (Christliche Mennonitische
Bruderschaft). Durch eine weitere Spaltung von der Lancaster Mennonite Conference entstand 1968 die Eastern Pennsylvania Mennonite Church. Glieder dieser konservativen amerikanischen Gemeinden gründeten in
Paraguay die Kolonien
Agua Azul (1969),
Rio Corrientes (1975) und La Montaña (1980).
(1)
Zu den konservativen amerikanischen Mennoniten zählen auch zwei amische Gemeinden. Ihre Geschichte läuft parallel zu den bereits beschriebenen konservativen Mennoniten. Die Gründung der amischen Mennoniten geht auf Jakob Ammann in den Jahren 1693-1710 zurück. Er war Ältester einer Täufergemeinde in der Schweiz und fand das Gemeindeleben seiner Zeit bereits verweltlicht, daher drängte er vor allem auf eine strenge
Gemeindedisziplin. Hinzu kam die Verwerfung der modernen Kleidung einerseits und die Einführung der
Fußwaschung in der
Gemeinde andererseits. In der Folge kam es zu langen und schwierigen Auseinandersetzungen und schließlich zu einer schmerzvollen endgültigen Spaltung der Gemeinden in der Schweiz und im Elsaß im Jahre 1711. Damit waren die amischen Gemeinden entstanden.
Ab 1733 wanderten die Amischen ebenfalls mit Hilfe der holländischen Mennoniten nach Nordamerika aus. Sie betrachten sich als die treuen Hüter des ursprünglichen Täufertums. Der Ausbund, das älteste Gesangbuch der schweizerischen und süddeutschen
Täufer (entstanden ab 1535), ist bei den Old Order Amischen immer noch im Gebrauch.
Doch auch sie waren dem Druck der Änderungen der Zeit ausgesetzt. Unter der Leitung des Ältesten Moses M. Beachy, der nicht mit der strengen Form der Gemeindezucht, wie sie in der
Gemeinde geübt wurde, einverstanden war, trennte sich ein Teil seiner
Gemeinde 1927 von den Old Order Amish. Andere Gemeinden schlossen sich ihr an und so entstanden die Beachy Amish, immer noch konservativ in Theologie und Lebensform, aber im Vergleich zu den Old Order Amish jedoch weit aufgeschlossener. Moderne Hilfsmittel wie Autos, Strom und
Telefon werden von ihnen voll genutzt. Aber Radio, Fernseher und die politische Beteiligung lehnen sie als dem Glauben nicht förderlich entschieden ab. In
Paraguay gibt es zwei amische Gemeinden:
Luz y Esperanza (1967) und
Florida (Beachy Amish Mennonite Fellowship, 1976).
Die Amischen in Luz y Esperanza und Florida
Die
Kolonie Luz y Esperanza umfasst 2 147 ha und liegt zwischen
Sommerfeld und
Bergthal nördlich von Ruta 7 bei
Km 216. Sie wurde 1967 gegründet. Jedoch, die ersten Amischen in
Paraguay siedelten im
Chaco. Nach Auflösung ihrer
Gemeinde im
Chaco gingen einige nach Ostparaguay (Klassen, 1988, S. 146). Ihnen schlossen sich weitere amische Zuwanderer aus den Vereinigten Staaten an.
Für die Auswanderung nach
Paraguay gaben die Pioniere zwei Gründe an. Der erste ist die Missionstätigkeit. Sie sind der Überzeugung, dass nach biblisch-täuferischem Prinzip jeder Christ ein Missionar sein soll. Aus diesem Grunde schicken sie als Gemeinden keine Missionare aus, sondern die Gemeindeglieder sollen dort, wo sie sind, mitten in ihrem Beruf ihre Missionsaufgabe erfüllen. Der zweite Grund ist die Erhaltung ihres Gemeindelebens in einer mehr oder weniger geschlossenen landwirtschaftlichen Siedlung. In den USA ist das nicht mehr möglich.
Die Siedlung und somit auch die
Gemeinde wurde 1967 gegründet. Eine fromme und christliche Lebensweise fällt bei diesen Leuten scharf ins Auge. Die Trennung von der Welt wird betont, wie es im
Schleitheimer Bekenntnis von 1527 gefordert wird. Äußerlich zeigt sie sich einmal in der Kleidung und Kopfbedeckung bei den Frauen und dem Tragen eines Bartes bei den Männern. Das Wesentliche soll dabei nicht die äußere Form sein, sondern ein vorbildliches Christenleben, das sich in Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit vor der Welt äußert. "Die Kleidung sichert keine Errettung, sie hilft jedoch, die Gruppe zu erhalten". (McGrath 1984, S. 77)
Gemeindeveranstaltungen finden jeden Sonntagmorgen und -abend und jeden Donnerstagabend statt. Bibelstunden nehmen einen wesentlichen Teil in ihren Veranstaltungen ein. Alle Versammlungen werden in englischer und spanischer Sprache geführt. Es ist ihr ernsthaftes Anliegen, die in ihrer Nachbarschaft lebenden Paraguayer an ihren Veranstaltungen teilnehmen zu lassen. Wenn diese die von der
Gemeinde gesetzten Verordnungen und Normen erfüllen, werden sie gerne in die
Gemeinde aufgenommen. Dazu gehört grundlegend die Bekehrung und die
Taufe, äußere Formen kommen später dazu. Der
Taufe geht eine sechsmonatige Probezeit und Bewährungsfrist voraus. Das Leben des Gläubigen muss sich unbedingt in einem christlichen Lebensstil äußern – in Tugenden wie oben bereits beschrieben. Jeglicher Gebrauch von Tabak und der Genuss von alkoholischen Getränken wird als unchristlich gemieden.
Am vierten Sonntag jeden Monats verteilen die Glieder der
Gemeinde Traktate in der Umgebung und laden die Nachbarn zu ihren Gottesdiensten ein. Am zweiten Sonntag jeden Monats versammelt sich die Jugend zu gemeinsamem Mahl, und anschließend
macht sie Besuche bei Kranken und Bedürftigen außerhalb der Siedlung. Bei solchen Besuchen wird die
Bibel gelesen, gebetet, und es werden geistliche Lieder gesungen.
Die Familienandacht darf in keinem Heime fehlen. Ob die
Familie klein oder groß ist, man versammelt sich morgens nach dem Frühstück und jeden Abend nach dem Abendbrot zum Familiengesang, Bibellesen und Gebet.
Die Siedlung zählt gegenwärtig 165 Einwohner, verteilt auf 28 Familien. Davon sind 47 Gemeindeglieder, zehn Amerikaner und 37 Lateinparaguayer. Zur
Gemeinde gehören außerdem sechs Lateinparaguayer, die nicht in der
Kolonie leben. Die
Gemeinde hat drei Pastoren und einen Diakon. Gemeindeleiter ist zur Zeit Mario Quevedo, Lateinparaguayer. Mit Unterstützung der Muttergemeinden in Nordamerika unterhält die
Gemeinde eine Klinik, die vorwiegend von Personal (Krankenschwestern und Verwalter) aus den Vereinigen Staaten auf freiwilliger Basis geführt wird. Diese Personen beteiligen sich zugleich aktiv an der Gestaltung des Gemeindelebens. Geboten werden in der Klinik vor allem Erste Hilfe und Geburthilfe.
1976 kam die
Kolonie und
Gemeinde Florida dazu, heute unter dem Namen Mennonite Christian Fellowship bekannt. Sie hat gegenwärtig 33 Glieder, davon sind 20 Amerikaner und 13 Lateinparaguayer. Der Gottesdienst wird in drei Sprachen geführt: Spanisch, Englisch und Guarani. John Meyers ist der Leiter der
Gemeinde. Die
Gemeinde ist aktiv in der Verteilung von Bibeln und christlicher Literatur in der Nachbarschaft.
Die Gemeinden in Agua Azul (Mennonite Christian Brotherhood) und La Montaña de la Fe (Eastern Pennsylvania Mennonite Church)
Die Siedlung
Agua Azul wurde 1969 gegründet. Sie liegt 375 km von
Asunción und 80 km von Puerto Guairá entfernt an der Ruta 10. Auf einer Fläche von 1900 ha siedelten hier die ersten Mennoniten aus den USA an, gefolgt von einigen aus Kanada. Durch die Vergabe von Privattiteln ist der Gemeindebesitz inzwischen auf etwa die Hälfte herabgesunken. Einen Gemeinschaftstitel für das Land zu besitzen, wie es die
Mennoniten in Paraguay mit russischem Hintergrund praktizieren, ist nicht Teil ihrer
Tradition, und so zeigen sie auch kein Interesse, dieses Modell in ihren Kolonien zu praktizieren. Das ganze Leben konzentriert sich auf die
Gemeinde.
Die geistliche Ausrichtung und Form zwischen den konservativen Mennoniten und den Amischen ist im Wesentlichen die gleiche, Unterschiede sind für den Außenseiter überhaupt nicht erkennbar. So gibt es kleine Unterschiede im Tragen des Bartes und in der Form der Kopfbedeckung. Beide betonen sie die Selbständigkeit der lokalen
Gemeinde und schließen sich zu keiner
Konferenz zusammen. Ihre erbauliche Literatur sowie didaktisches und geschichtliches Material für ihre Gemeinden und Schulen beziehen sie aus dem konservativen Verlag Rod and Staff (Editorial Vara y Cayado, Inc.), Crokett, Kentucky, USA. Neuerdings wird ein Teil ihrer Literatur in spanischer Sprache in Guatemala gedruckt, wo es einheimische Gemeinden gibt.
Der Gottesdienst verläuft auch hier in zwei Sprachen: Englisch und Spanisch. Eine gute Anzahl Paraguayer haben sich schon der
Gemeinde angeschlossen. Einer Heirat zwischen Paraguayern, wenn sie gläubig sind, und den Mennoniten wird nichts in den Weg gestellt. Die
Gemeinde erreichte vor Jahren mit 101 Gliedern ihre größte Stärke, und die Zukunft sah vielversprechend aus. Jedoch infolge von Auswanderung, Gemeindetrennung und disziplinarischen Fällen sank die Gliederzahl leider bis auf 30, die je zur Hälfte aus Paraguayern und Amerikanern besteht. Die starke Betonung der
Absonderung und ein Hang zur Gesetzlichkeit bringen besonders den aus der paraguayischen Gesellschaft kommenden Gliedern Schwierigkeiten. So sind Radio, Fernsehen, organisierter
Sport (wie Fußball) und vieles andere mehr als weltliche Dinge in der
Gemeinde nicht zugelassen. Die fromme, weltfremde
Kultur der amerikanischen Mennoniten (hier als bibeltreues Christentum verstanden) und die weltoffene der Paraguayer stoßen hier aufeinander und sind der Anlass für recht viele Disziplinarfälle.
1975 entstand als zweite Siedlung
Rio Corrientes, an der Ruta 10 am gleichnamigen Fluss gelegen, 255 km von
Asunción entfernt. Sie hat sich aber 1995 der häufigen Überfälle wegen aufgelöst. Das ist zu bedauern. Alle Siedler gingen in die USA zurück.
1980 wurde im Süden des Landes im Departement Itapúa die Siedlung La
Montaña de la Fe, kurz La Montaña, gegründet. Die
Gemeinde hier zählt 63 Glieder, davon sind 23 Amerikaner und 40 Lateinparaguayer. Die durchschnittliche Anzahl der Gottesdienstbesucher am Sonntagmorgen wird mit 165 angegeben. Die Hauptsprache in den Gottesdiensten ist hier bereits Spanisch und nur gelegentlich, wenn Besucher da sind, die nicht Spanisch sprechen, teilweise auch noch in Englisch. Daneben gibt es auch Predigten in Guaraní.
Von La Montaña aus ist im Nachbarort Varana, außerhalb der Siedlung, eine zweite
Gemeinde entstanden. Zu dieser
Gemeinde gehören 13 Amerikaner und 34 Lateinparaguayer. Die Zahl der Gottesdienstbesucher beläuft sich auf etwa 110.
Einmal im Jahr, unterhalten die zwei genannten Gemeinden für eine Woche eine „Bibelschule", zu der in der Regel eine Lehrkraft aus dem Ausland (Guatemala) eingeladen wird. Der Unterricht gilt in erster Linie der Jugend.
Ein sehr tragisches Unglück ereignete sich in La Montaña am 24. August 1999. An diesem Tag wurde Benjamin E. Shank (24) überfallen und ermordet. Shank war nach dem Abendprogramm mit seinem Motorrad auf dem Wege, einen Lastwagen zu holen, um die Gemeindeglieder, die im Nachbarort Katupyry auf der Bibelschule waren, abzuholen und heim zu bringen. Auf einsamem Wege wurde er überfallen, gebunden und mit vier Messerstichen im Hinterkopf getötet. Der (die) Mörder floh(en) mit dem gestohlenen Motorrad. Shank hinterließ seine
Frau Rachel, seinen Sohn Jesse (drei Monate), sechs Schwestern, zwei Brüder und die Eltern. Mehrere vermutliche Täter wurden festgenommen, doch ist der Fall nach einem Jahr immer noch nicht geklärt. Die Polizei vermutete Rache aus irgendeinem Grunde, da Benjamin 300 000 Gs. und eine sehr kostbare Taschenlampe mit sich führte, Wertsachen, die ihm aber von dem (den) Täter(n) nicht entwendet worden waren.
Das Motiv zu dieser schrecklichen Handlung war Rache, so schrieb es die Tageszeitung Ultima Hora (30. August, 1999, S. 57). Der Mörder war als Verbrecher schon einige Male im Gefängnis gewesen. Als er zu den Mennoniten stieß, wussten diese nichts davon. Er tat freundlich, besuchte die Gottesdienste und verliebte sich in eines der noch ungetauften lateinparaguayischen Mädchen. Er drang auf eine Heirat. Doch nach den Regeln der
Gemeinde konnte diese nicht sofort vollzogen werden. Dazu hätten sie erst Glieder der
Gemeinde werden müssen. Das dauerte dem Eindringling jedoch zu lange. So heiratete er am 20. August 1999 gegen den Willen der
Gemeinde und ohne ihre Beteiligung. Damit schloss er sich von den Vorrechten, die die Glieder der
Gemeinde innerhalb der Siedlung genießen, aus, so zum Beispiel von dem Recht, innerhalb der Siedlung ein Grundstück zu erwerben. Dadurch war Claudelino derart verärgert, so eine Vermutung, dass er sich auf diese schreckliche Art und Weise an Benjamin rächte.
Doch wie verhielt sich, abgesehen davon, die
Familie und wie verhielten sich die Gemeindeglieder zu solch einer schrecklichen Tat? Das wollten auch die Reporter wissen. Benjamins Vater antwortete den neugierigen Leuten von der Presse einige Tage nach dem gewaltsamen Tode seines Sohnes folgendermaßen: "Wir, die ganze
Familie, die ganze
Gemeinde, haben dem, der meinen Sohn getötet hat, verziehen." Und mit schmerzvollem Ausdruck fährt der Vater fort: "Wenn auch Benjamins Tod gewaltsam war, so glauben wir dennoch, dass er im Dienste des Herrn starb. In der
Gemeinde lehren wir die Nächstenliebe. Aus diesem Grunde hegen wir keinen Wunsch nach Rache gegen den, der meinen Sohn getötet hat. Wir werden auch keine Untersuchung anstellen, wer es gewesen ist, denn dies ist die Aufgabe der Obrigkeit." Auf die Frage der Presseleute, ob man einen Gerichtsprozess gegen den (die) Täter, wenn sie gefunden würden, einleiten werde, antwortete der Vater mit der gleichen Überzeugung: "Wird der Mörder gefunden, ist es Sache der Polizei und der Obrigkeit. Wir werden keinen Gerichtsprozess einleiten gegen den, der das Leben meines Sohnes genommen hat. Ich werde ihn nicht verfolgen. Alles ist in Gottes Hand. …. Was geschehen ist, ist geschehen, und wir haben dem Mörder verziehen, weil wir Christen sind." (Ultima Hora, 31. August, 1999, S. 60).
Vor den Richter gerufen, antworteten die
Prediger der
Gemeinde mit einer schriftlichen Erklärung, die sie im Juli 1996 ausgearbeitet hatten, nachdem es zu wiederholten Überfällen und Diebstählen in ihrer Siedlung gekommen war. Darin heißt es:
Die
Bibel lehrt uns, dass es nicht unsere Verantwortung ist, uns an denen zu rächen, die uns misshandeln (Römer 12, 19-21). Damit sagen wir nicht, dass es in jedem Fall schlecht ist, dass gestohlene Gut zu suchen (zurückzuholen), aber als Christen müssen wir darauf achten, dass wir dies mit guter Einstellung machen. Wir dürfen einen Dieb nicht mit einer Haltung der Rache und des Richtens verfolgen. Im Gegenteil, wir müssen der Lehre und dem Beispiel Jesu folgen und unsere Feinde lieben, sie segnen und für sie beten (Matthäus 5, 39-48; Lukas 23, 34).
Im Lichte dieser Tatsachen darf der Christ keine Waffen tragen, um sich gegen irgendeine Person zu schützen. Wenn jemand das gestohlene Gut nicht zurückholen kann, ohne eine Waffe zu tragen, dann sollte er es nicht tun, denn das ist gegen die Lehre des Neuen Testamentes und dem Zeugnis der
Gemeinde hinderlich.
Auch bringen wir unsere Besorgnis über den Besitz eines Revolvers zum Ausdruck, weil er hauptsächlich der eigenen Verteidigung dient. Schon der Besitz einer Waffe könnte dem christlichen Zeugnis schaden, besonders dann, wenn sie dazu gebraucht wird, durch Schüsse in die Luft Eindringlinge abzuschrecken.
Weiter bringen wir unsere Sorge über die Fälle zum Ausdruck, in denen in unseren Wagen ein Kommissar gefahren wird, um das gestohlene Gut wieder zu erlangen. Es mag nach Matthäus 5, 41 Fälle geben, in denen wir gezwungen werden, es zu tun, aber in einem solchen Fall dürfen wir es nicht mit der Haltung tun, uns rächen zu wollen, und nicht in einer Art und Weise, wodurch unser Zeugnis schaden leiden würde.
Dieses Beispiel aus der unmittelbaren Vergangenheit kennzeichnet die Glieder dieser
Gemeinde. Sie leben nach der
Bibel in Wort und Tat und in Treue zu ihrer überlieferten Lehre, die sie von den Täufern im 16. Jahrhundert ableiten. Eine biblische Lehre reicht für sie nicht aus, sie muss auch gelebt werden. Darin besteht ihre konservative Haltung. Die äußeren Formen sind dabei unwesentlich, so lehren sie.
Auswertung und Überlegungen
Die konservativen Mennoniten sind ein verborgener Edelstein im bunten Mosaik der
Mennoniten in Paraguay. In
Paraguay fallen sie nicht auf, da sie eine kleine Gruppe sind und keine Publizität suchen. Sie gehören nicht zum Stamm der holländisch-preußisch-russländischen Mennoniten. Ein separates Verwaltungssystem auf Siedlungsebene, wie es in allen anderen mennonitischen Kolonien gang und gäbe ist, haben sie nicht. Die
Gemeinde ist das maßgebende und allumfassende Organ. Sie beherrscht das ganze Leben und Denken der Bürger. Wahrscheinlich stellen sie die reinste überlieferte Form der biblisch-täuferischen Lehre dar. Rassische Diskriminierung findet sich bei ihnen nicht. Der paraguayischen Bevölkerung sind sie offener gegenüber als die Mennoniten in den anderen Siedlungen Paraguays. Sie sind bereit, ihre eigene
Kultur zu Gunsten der Lateinparaguayer zu opfern. Das äußert sich darin, dass sie ihnen, sobald sie Gemeindeglieder sind, Land innerhalb ihrer Siedlung anbieten und einer interethnischen Heirat nichts in den Weg legen. Auch sind sie bereit, ihre Sprache aufzugeben. Sie bemühen sich ernsthaft, einen tadellosen, christlichen Wandel vor der Welt zu führen.
Doch bei aller positiven Bewertung und Anerkennung steigen auch einige Fragen auf. Liebe, Vergebung und Versöhnung werden gelehrt und praktiziert. Kommt dabei aber auch das Prinzip der
Gerechtigkeit zu seinem Recht? Die Gemeinden lehnen es entschieden ab, vor ein weltliches Gericht zu gehen. Auch bei Diebstahl verfolgen sie keinen Täter, um ihn hinter Gitter zu bringen. Wie vergleicht sich diese Haltung mit der der Mennoniten russischer
Tradition? Beide berufen sich auf das täuferische Erbe, handeln jedoch sehr unterschiedlich. Weiter, die konservativen Mennoniten legen einen bewundernswerten Missionseifer an den Tag, um ihren Nachbarn das Evangelium zu verkündigen. Daran beteiligt sich jedes Gemeindeglied. Doch unterscheidet man dabei in der
Gemeinde entsprechend zwischen
Kultur und Evangelium? Wird den Neubekehrten nicht ein Stück konservativer, mennonitischer
Kultur als Evangelium aufgezwungen und damit die Effektivität des Evangeliums in ihrer Wirkung eingeengt? Ist das magere Resultat ihrer Missionsarbeit nicht die Folge ihrer konservativen Lebenshaltung? Wäre eine größere Öffnung nicht sinvoll und biblisch? Die
Absonderung von der Welt ist ein biblisches Prinzip. Doch wird bei so enger Lebensweise der christlichen Freiheit die Möglichkeit gegeben, sich zu entfalten? Doch geht es bei diesen Fragen nicht darum, andere zu richten, um selber in einem helleren Lichte zu erscheinen. Alle
Mennoniten in Paraguay stehen in der Gefahr, ein Stück ihrer kulturellen und überlieferten Werte den anderen als Evangelium anzupreisen. Darum sollten wir die Andersdenkenden respektieren, sie segnen (und nicht nur die, die uns übel tun) und trotz verschiedener Auffassungen und Lebensformen gegenseitig unterstützen und die geistliche Gemeinschaft suchen und pflegen.
Andererseits, was geschieht, wenn die
Gemeinde ihre Formen und Normen lockert und sich der Umwelt und ihrer
Kultur anpaßt? Gehen damit auch die überlieferten täuferischen Werte verloren? Das sind Fragen und Überlegungen, die nicht so leicht und keineswegs nach einer Schablone zu beantworten sind. Mit diesen Fragen haben es alle Mennoniten mehr oder weniger zu tun. Es gilt, sich den kulturellen und sozialen Umweltbedingungen anzupassen, ohne dabei die biblischen und moralischen Werte aufzugeben. Die Geschichte der
Gemeinde zeigt eindeutig, dass der biblische begründete Glaube die zeitbedingten kulturellen Formen und Traditionen überleben wird.
Fussnoten:
| The Mennonite Encyclopedia, 1990, Band V., S. 504, 253, Band III. S. 275-27). |
Die Altkolonier in Paraguay
Hans Theodor Regier
Einführung
Auf Grund verschiedener Lebensformen und der jeweiligen kulturellen Entwicklung, kann man in
Paraguay von fünf verschiedenen mennonitischen Gruppierungen sprechen. Es geht in diesem Zusammenhang nur um eine bessere Erfassung der einzelnen mennonitischen Gemeinschaften und um keinen Fall um eine qualitative Einschätzung der jeweiligen Gruppierungen.
In
Paraguay zählt man rund 27.980 getaufte Mennoniten. Davon bilden ca. 9.160 getaufte Personen eine Gruppierung, die auf ziviler Ebene in der „Asociación de Colonias Mennonitas del
Paraguay" (
ACOMEPA) organisiert sind. In der
ACOMEPA sind die Kolonien
Fernheim,
Friesland,
Menno,
Neuland und
Volendam zusammengeschlossen. Eine Anpassung an die Umwelt im wirtschaftlichen, sozialen und auch kulturellen Bereich hat im gewissen Maß stattgefunden. Zu dieser Gruppe könnte man auch die Mennoniten von
Asunción und
Tres Palmas zählen. Die Kolonien
Fernheim,
Menno und
Neuland sind im zentralen
Chaco gelegen und die restlichen Siedlungen in Ostparaguay.
Die zweite Gruppierung stellen die sogenannten Altkolonier mit rund 4.150 getaufte Glieder dar. Die Kolonien sind
Sommerfeld,
Bergthal,
Reinfeld,
Rio Verde,
Santa Clara,
Nueva Durango und
Manitoba. Die Siedlungen liegen über ganz Ostparaguay verstreut. Diese Gruppe von Mennoniten stechen wohl am meisten durch Form und Verhalten von der Umwelt ab.
Die konservativen amerikanischen Mennoniten bilden eine dritte Gruppe unter den
Mennoniten in Paraguay und zählen rund 500 getaufte Glieder. Sie sind in den relativ kleinen Siedlungen
Luz y Esperanza,
Florida,
Agua Azul und La Montaña wohnhaft. Unter ihnen befinden sich Elemente der amischen
Kultur und in der zivilen Verwaltungsstruktur, im sprachlichen Bereich und in der Missionspraxis, unterscheiden sie sich deutlich von den anderen mennonitischen Gruppierungen. Die konservativen amerikanischen Mennoniten kamen von Süddeutschland und der Schweiz über die Vereinigten Staaten nach
Paraguay.
In
Paraguay zählt man 14.480 getaufte Mennoniten, die europäischen Ursprungs sind. Die gesamte Bevölkerung in den mennonitischen Kolonien beläuft sich auf 28.500 Personen. Hierzu muss klärend gesagt werden, dass die große Mehrheit der
Mennoniten in Paraguay, die europäischen Ursprungs sind, die paraguayische
Staatsangehörigkeit haben.
Die letzten beiden mennonitischen Gruppierungen setzen sich jeweils aus mennonitischen Paraguayer und Indianer zusammen. Die Gemeinden die sich aus paraguayischen Mennoniten zusammensetzen, zählen rund 5.000 Mitglieder. Die indianischen Gemeinschaften im
Chaco haben rund 8.500 getaufte Mitglieder.
Im folgenden soll auf die sogenannten Altkolonier näher eingegangen werden. Neben einer geographischen Standortbeschreibung der jeweiligen Kolonien wird auch das Wesen dieser Mennoniten etwas unter die Lupe genommen. Die wohl größte Begrenzung für diese Arbeit ist die fehlende deutsche Literatur in diesem Bereich und die für in
Paraguay schwer zugängliche englische Literatur zur Thematik. Für die Erarbeitung der Wesensmerkmale dieser Gemeinschaft werden in Zukunft weiterführende Untersuchungen in den jeweiligen Gemeinschaften unumgänglich sein.
Definition
Die sogenannten „Altkolonier" stellen eine der mennonitischen Gruppierungen in
Paraguay dar. Die Bezeichnung „Altkolonier" kann man aus der Tatsache ableiten, dass die große Mehrheit der Mitglieder dieser Gemeinschaften, bzw. Kolonien, ursprünglich aus der ersten in Russland gegründeten
Kolonie, d.h. "Altkolonie" stammen. Die erste in Russland von den Mennoniten gegründete
Kolonie war Chortitza im Jahre 1789. Die „Altkolonier" werden auch als „traditionelle Mennoniten" bezeichnet. Diese Gruppe charakterisiert sich durch das Festhalten an überlieferte Lebensweisen und alten Ordnungen, mit dem festen Bestreben, keine Erneuerungen in der
Gemeinde und Gemeinschaft einzuführen. Die ganze Struktur wird ständig und konstant von den Ältesten und Predigern der
Gemeinde überwacht und geführt.
Die Siedlungen der „Altkolonier" in Ostparaguay
Den Ursprung der Altkolonier finden wir im niederländischen Raum, wo das Täufertum zu Beginn des 16. Jahrhunderts seinen Anfang nahm. Der Wanderweg führte weiter über Preußen nach Russland. Auf Grund der Erneuerungen und Entwicklungen auf dem kulturellen und geistlichen Gebiet und der Einführung des obligatorischen Forsteidienstes in Russland, der als Ersatzdienst für die allgemeine Wehrpflicht galt, siedelten ab 1874 rund 7.000 Mennoniten in Kanada an.
(1) Davon waren etwa 3.000 Personen aus
Bergthal, 2.100 aus Chortitza, 1.100 aus Fürstenland und 800 aus Borsenko. In
Manitoba, Kanada, wurden die „Ost- und
Westreserve", jeweils an den beiden Seiten des „Red River" besiedelt.
(2) Hier blühten bald 65 mennonitische Dörfer. 1923 erfolgte noch einmal eine große Einwanderung von rund 20.000 Mennoniten aus Russland. Zahlenmäßig, aber auch auf wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Ebene, entwickelten sich die Mennoniten in Kanada äußerst schnell.
Im Jahre 1919 wurde in den mennonitischen Schulen Kanadas durch den zunehmenden britischen Nationalismus, die deutsche Sprache als Unterrichtssprache verboten. Um die deutsche Sprache und das eigene Schulsystem beibehalten zu können, wanderten von 1922 – 1926 rund 6.000 Mennoniten nach Mexiko aus und siedelten im Staate Chihuahua an. In mehr als 50 Dörfern fanden rund 11.000 Mennoniten in Mexiko eine neue Heimat. In den darauffolgenden Jahrzehnten zogen noch weitere Glieder aus der „Kleinen
Gemeinde" aus Kanada hinzu. Der Lebensstil blieb für die meisten Mennoniten in Mexiko in vieler Hinsicht derselbe, wie er vor Jahren und Jahrhunderten in Kanada, Russland und Preußen gewesen war. Auf Grund des hohen Geburtenüberschusses und der Vorstellung, dass man am besten in geschlossenen Siedlungen die mennonitischen Traditionen und den Glauben ausleben könne, kam man in Mexiko bald in Landnot. Ein weiterer Umstand der hinzu kam, waren die vielen Spaltungen in der
Gemeinde und Gemeinschaft, verursacht durch die verschiedenen Ansichten im religiösen Bereich. Dadurch wanderten dann ab den 70er Jahren
mexikanische Mennoniten nach
Paraguay aus und gründeten mehrere Kolonien, d.h.
Rio Verde,
Manitoba,
Santa Clara und
Nueva Durango in Ostparaguay.
(3)
Eine andere Gruppe wanderte schon 1926/7 von Kanada nach
Paraguay aus und gründete die
Kolonie Menno im zentralen
Chaco. Einige Jahrzehnte später, Ende der vierziger Jahre, gründeten mennonitische Einwanderer aus Kanada, die sogenannten „
Sommerfelder", die Kolonien
Sommerfeld und
Bergthal.
(4) Bei dieser Auswanderung spielte sehr stark der Umstand mit, dass die Mennoniten in Kanada in beiden Weltkriegen unter Druck gesetzt wurden, die jungen Männer für den Militärdienst zur Verfügung zu stellen. Nicht immer war mit einem Ersatzdienst der Wehrpflicht Genüge getan. Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges, kam dann die Auswanderung nach Mexiko bzw.
Paraguay zustande.
(5)
Die Siedlungen der Altkolonier in Paraguay sind:
SommerfeldSommerfeld wurde im Departament Caaguazú, etwa 213 km von
Asunción entfernt, von Einwanderen aus Kanada gegründet. Der größte Teil der Einwanderer kam aus
Manitoba, d.h. aus der
Ostreserve 740, der
Westreserve 764 und aus Saskatchewan 140 Personen.
(6) Die Einwanderer aus der
Ostreserve waren aus der Chortitzer
Gemeinde, die aus der
Westreserve aus der
Sommerfelder Gemeinde und aus Saskatchewan aus der
Bergthaler Gemeinde.
(7) Alle gehörten zu der Gruppe der Mennoniten, die 1874 von Russland nach Kanada übergesiedelt waren. Nach der Urbarmachung der Prärien Kanadas, entschloss man sich, nach 75 jährigem Aufenthalt, wieder den Wanderstab zu ergreifen.
(8)
Unter den schwersten Bedingungen wurden ab 1948, 44.000 ha Land besiedelt. Auf Grund der anfänglichen Schwierigkeiten kehrte ungefähr ein Drittel der Siedler wieder zurück nach Kanada. Doch mit Hilfe einer gemeinsamen Kasse überbrückte der Rest der Einwanderer die Reise und die anfänglichen Schwierigkeiten. Der wirtschaftliche Aufschwung kam mit dem Bau der Fernstraße von
Asunción nach Ciudad del Este und dem dadurch ermöglichten Holzhandel und später mit dem Anbau von Weizen und Soja. Bald nach der Ansiedlung wurde ein Krankenhaus für erste Hilfe, kleine Operationen und Geburten geführt. Auch hatte die
Kolonie eine Krankenversicherungskasse. Diakone in der
Gemeinde waren beauftragt, danach zu sehen, dass niemand in der
Kolonie materielle Not leide.
(9)
Heute wohnen in der
Kolonie Sommerfeld 444 Familien, d.h. 2.612 Personen. 1.010 Personen sind getaufte Gemeindeglieder.
(10)
BergthalDie Geschichte der
Kolonie Bergthal entwickelte sich weitgehend identisch mit der von
Sommerfeld. Die Einwanderer kamen auch aus Kanada, d.h. von der sogenannten
Ostreserve, ursprünglich etwa 764 Personen, und gründeten gegenüber der Siedlung
Sommerfeld die
Kolonie Bergthal.
(11) Die meisten Ansiedler waren aus der Chortitzer
Gemeinde in der Steinbachgegend. Die Ansiedler dieser Gemeinschaft gehörten zu der ärmeren Gruppe ihrer Gemeinschaft, und im Laufe der Jahre entwickelte sich der wirtschaftliche Aufschwung auch etwas langsamer. Außerdem wurde in
Bergthal die Trennung von der „Welt" stärker betont als in
Sommerfeld.
(12)
Da auf dem bäuerlichen Hof alle Arbeiten im Rahmen der
Familie verrichtet wurden, hatte man auch seit der Ansiedlung keine paraguayischen Arbeiter angestellt. Für die heranwachsende Generation wurde der zunehmende Landmangel ein Problem. Daraufhin gründete 1995 die
Kolonie Bergthal etwa 30 km südlich von
Sommerfeld die Tochterkolonie Neu-
Bergthal.
Heute wohnen in der
Kolonie Bergthal 460 Familien, d.h. 2.098 Personen. 867 Personen sind getaufte Gemeindeglieder.
ReinfeldIm Jahre 1966 gründeten Bürger aus der
Kolonie Bergthal und
Sommerfeld eine neue Siedlung in der Nähe von San Ignacio im Süden Paraguays. Durch den starken wirtschaftlichen Aufschwung in den Siedlungen
Sommerfeld und
Bergthal sahen sie ihre
Tradition und Glauben gefährdet. Auch der Landmangel war ein Grund zur Abwanderung. Weiter lehnten sie den Traktor für die Bearbeitung des Bodens und Autos als Fahrzeuge ab. Es wurden Pferdepflug und Buggys benutzt. Erst in den letzten Jahren beschlossen die geistlichen Führer, dass man den Traktor für die landwirtschaftliche Bearbeitung gebrauchen darf.
Heute wohnen in der
Kolonie Reinfeld 28 Familien, d.h. 146 Personen. 65 Personen sind getaufte Gemeindeglieder.
Rio VerdeIm Departament San Pedro an der Ruta III „General Aquino", etwa 350 km von der Landeshauptstadt
Asunción entfernt, gründeten mexikanische Siedler die
Kolonie Rio Verde. Für die Siedlung
Rio Verde wurden ursprünglich etwa 20.526 ha Land erworben, und Privatpersonen kauften zusätzlich an der anderen Seite der Ruta 6.000 ha. Land, das sich „Nueva Mexico" nannte. In den darauffolgenden Jahrzehnten wurde der Name
Rio Verde auf beide Siedlungen angewandt. Die ersten Ansiedler, etwa 106 Personen, kamen 1969 in
Paraguay an. Im Laufe der darauffolgenden Jahre kamen immer mehr Familien aus Mexiko, einige Familien auch aus Britisch Honduras (Belize) und Kanada hinzu. Es wurden 18 Dörfer gegründet, aber nicht alle besiedelt. Viele Hofstellen wurden von besorgten Eltern für ihre Kinder von Mexiko her gekauft. Die Dörfer konnten gleich zu Beginn der Ansiedlung in gleichmäßiger Form angelegt werden.
Die Ansiedlung war im Vergleich zu den anderen Gründungen relativ leicht. Nur das Wetter machte den Ansiedlern viel zu schaffen. Hunderte wanderten wieder entmutigt zurück nach Mexiko. Durch die quantitative Erweiterung der Landwirtschaft verbesserte sich auch später die wirtschaftliche Lage. Der Gebrauch von Autos und Motorrädern war verboten, aber das Land wurde in mechanisierter Form bearbeitet. Später wurde auf Grund von Privatinitiative eine Kooperative gegründet, die aber nicht mehr existiert. Auch mehrere kleine Milchfabriken wurden eingerichtet. In mehreren Schmieden, Sägereien, Tischlereien und Läden ist fast alles für den alltäglichen Gebrauch erhältlich.
(13)Heute wohnen in der
Kolonie Rio Verde rund 500 Familien, d.h. 3.045 Personen. 1.263 Personen sind getaufte Gemeindeglieder. Damit ist
Rio Verde die größte mennonitische Ansiedlung in Ostparaguay.
Santa ClaraSanta Clara wurde 25 km nördlich von
Rio Verde auch im Departament San Pedro gegründet. Alle Familien kommen aus der
Kolonie Santa Clara in Mexiko, ebenfalls im Staate Chihuahua. Gründe der Auswanderung waren Sozialreformen der mexikanischen Regierung. Vielen Viehzüchtern und Großgrundbesitzern wurde Land enteignet und an landlose Mexikaner verteilt. Einige hielten nur noch ihre Häuser. Vierzig Familien wanderten aus Mexiko aus, aber der paraguayische Urwald schreckte wieder viele ab, so dass nur 21 Familien die Ansiedlungsphase durchhielten. Wirtschaftlich kam man schnell voran, da man aus Mexiko Geld mitgebracht hatte. Mehrere hundert Hektar Land wurden gerodet und die wichtigsten Anbaukulturen waren Soja, Bohnen und Weizen. Vieh- und Milchwirtschaft gab es nur für den eigenen Verbrauch.
Die Ansiedler gehörten zu der „
Sommerfelder Gemeinde," die sich in der Form deutlich von der „Reinländer
Gemeinde" in den Nachbarkolonien
Rio Verde und
Manitoba unterschied. Die Kleidertracht war nicht so einförmig wie in der Nachbarkolonie
Rio Verde, und motorisierte
Verkehrsmittel sind erlaubt. Diese Tatsache ist mit ein Grund dafür, dass mit der Nachbarkolonie
Rio Verde wenig Beziehungen gepflegt werden.
Heute wohnen in der
Kolonie Santa Clara 57 Familien, d.h. 290 Personen. 124 Personen sind getaufte Gemeindeglieder.
Nueva DurangoDie Siedlung wurde 40 km nördlich von Curuguaty im Departament Canendiyú gegründet. Die ersten Siedler dieser
Kolonie verließen Mexiko am Ende des Jahres 1978 und suchten im fast undurchdringlichen Urwald in Ostparaguay ihre neue Heimat. Die Einwanderer waren vorwiegend Altkolonier aus dem Staate Durango, Mexiko. Anfänglich wurden 7.500 ha Land gekauft. Bei ihrer Ansiedlung bekamen sie vom damals amtierenden Staatspräsidenten Alfredo Stroessner die Zusage, dass die Privilegien auch für sie Gültigkeit hätten. Der Urwald musste bald Weizen- und Sojafeldern weichen. Erstaunlich schnell entstanden planmäßig angelegte Dörfer. Gummireifen waren an allen motorbetriebenen Fahrzeugen verboten, nicht aber an Pferdefahrzeugen.
Heute wohnen in der
Kolonie Nueva Durango 285 Familien, d.h. 1.850 Personen. Rund 600 Personen sind getaufte Gemeindeglieder. Im Jahre 1994 zählte
Nueva Durango rund 3.050 Einwohner. Doch durch verschiedene Erneuerungen, wie z. B. die Installierung des elektrischen Stromes, usw. setzte im erwähnten Jahr eine große Abwanderung nach Bolivien ein, und fast die Hälfte der
Kolonie wanderte aus.
Campo AltoDiese Gruppe siedelte 1980 im Departament Canendiyú an. Sie kamen ursprünglich aus Mexiko, hatten aber in Belize Zwischenstation gemacht. Man war nach
Paraguay ausgewandert, weil die unruhigen innenpolitischen Verhältnisse in Belize sie in Bedrängnis brachten. Durch die Sonderform der
Gemeinde sonderten sie sich auch in
Paraguay ganz von den anderen Kolonien und Gemeinden ab. Doch Ende 1994 wanderte diese Gruppe in geschlossener Form nach Santiago del Estero in Argentinien aus. Sie zählten 55 Personen, davon 23 Gemeindeglieder.
ManitobaManitoba wurde im Jahre 1983 im Departament San Pedro von einer kleinen Einwanderergruppe aus Mexiko gegründet, die zur selben
Gemeinde wie die Gruppe von
Rio Verde gehörten.
(14) Die Gründer kamen auch aus dem Staate Chihuahua in Mexiko.
Heute wohnen in der
Kolonie Manitoba 118 Familien, d.h. 588 Personen. 239 Personen sind getaufte Gemeindeglieder.
Wenn man das Wesen und die Lebensformen der sogenannten „Altkolonier" in
Paraguay etwas näher analysieren will, muss man davon ausgehen, dass sich die jeweiligen Siedlungen voneinander unterscheiden. Obwohl die meisten Bewohner ursprünglich von der zuerst gegründeten
Kolonie, d.h. der Altkolonie in Russland abstammen, hat doch der Einfluss der Umwelt und die „Standhaftigkeit" der jeweiligen Führer die verschiedenen Gruppen unterschiedlich beeinflusst. Aus diesem Grund könnte man in
Paraguay zwei größere Gruppierungen der Altkoloniersiedlungen sehen. Die Differenzierung, die hier gemacht wird, beruht auf der Herkunft der Einwanderer.
Einmal sind die Mennoniten zu nennen, die direkt aus Kanada eingewandert sind, nämlich die Bewohner von
Sommerfeld,
Bergthal und der Tochterkolonie
Reinfeld. Die zweite Gruppe sind die Mennoniten, die von Kanada über Mexiko nach
Paraguay eingewandert sind: die Bewohner von
Rio Verde,
Santa Clara,
Nueva Durango und
Manitoba. Bei beiden Gruppen hat aber die Gemeindezugehörigkeit mit ihrer jeweiligen Art in der ursprünglichen Heimat die heutige Lebensform der Altkolonier stark beeinflusst. In allen Fällen ist wohl festzustellen, dass bei den Abwanderungen immer jeweils die Gruppen den Wanderstab ergriffen, die eine konservativere Einstellung hatten und den negativen Einfluss der „Welt" befürchteten. In einigen Fällen bildete der Umstand, dass man sich in Landnot befand, einen weiteren Grund.
In den Siedlungen der Altkolonier gibt es seit mindestens einem Jahrzehnt auch immer wieder Versuche, im geistlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Bereich Erneuerungen einzuführen. In den meisten Fällen hatten diese ihren Ursprung in den eigenen Kreisen, in anderen Fällen wurden sie aber auch stark von außen unterstützt. In der
Kolonie Sommerfeld wurde 1994 in einem relativ friedlichen Prozess eine neue
Gemeinde gegründet.
(15) In den Kolonien
Bergthal und
Rio Verde, in denen auch Erneuerungsversuche stattfanden, lief dieser Prozess nicht so friedlich ab. In einigen Fällen kam es sogar zu Eingriffen der paraguayischen Justiz, um gewisse Missstände unter den Beteiligten zu lösen.
(16)In diesem Zusammenhang muss auch in Betracht gezogen werden, aus welcher Perspektive die Lebensweise der Altkolonier in
Paraguay näher analysiert wird. In den jeweiligen Gemeinschaften wurden über Generationen und Jahrhunderte hinweg Lebensformen vermittelt, die in vielen Fällen wenig von der Umwelt beeinflusst wurden. Daher treffen zwei vollkommen verschiedene Weltanschauungen aufeinander, wenn sich Außenseiter und Mitglieder dieser Gemeinschaften treffen. Hier bildet die Toleranz eine wichtige Grundlage für ein gegenseitiges Verständnis.
Bei den Altkoloniern ist die
Gemeinde wohl das tragende Element im Gemeinschaftsleben. Die
Gemeinde besteht aus getauften Gliedern, Diakonen, Predigern und Ältesten. Die
Prediger werden als „Lehrer" bezeichnet und die Person, die in der Schule unterrichtet, nennt man Schullehrer. Ein Ältester kann nur von einem anderen Ältesten eingesegnet werden. Dieser hat den stärksten Einfluß im Rahmen des ganzen Siedlungsgeschehens. Nur er ist befähigt, Taufhandlungen und die Austeilung des Abendmahles durchzuführen. Der Lehrstand, der sich aus ihm, dem Diakon und den Predigern zusammensetzt, schafft die Grundlage für die bestehende
Gemeinde– und Gemeinschaftsstruktur. Jeden Donnerstag versammelt sich der Lehrstand, um anfallende Fragen der
Gemeinde zu behandeln. Auf der Tagesordnung stehen sehr oft Disziplinfragen.
In den Siedlungen der Altkolonier steht die kirchliche
Macht über der zivilen Verwaltungsstruktur. So werden z.B. in
Rio Verde für die zivile Verwaltungsarbeit, zwei „
Vorsteher"
(17) für eine Amtsperiode von einem Jahr gewählt. Diese zwei
Vorsteher führen ihr Amt jeweils in einem rotierenden Turnus von zwei Jahren aus. Die Anzahl und der Wahlmodus der
Vorsteher sind in den jeweiligen Kolonien unterschiedlich. Grundeinheit der Kolonieverwaltung ist das Dorf. Der Dorfvorsteher wird lokal gewählt und
macht sich für die zivile Verwaltungsarbeit im Dorf verantwortlich. Wenn es aber erst um entscheidende Dinge geht, gilt als letzte Instanz immer noch das Wort des Ältesten. Die
Gemeinde– und Gemeinschaftsstruktur ist so aufgebaut, dass die geistlichen Führer unantastbar sind. Die gewünschte Haltung der Gemeindeglieder dem Ältesten gegenüber ist blindes Vertrauen und bedingungsloser Gehorsam. Die genannte Tatsache basiert auf dem Argument, dass Kritik an geistlichen Führern, in direkter Form Kritik an Gott ist.
(18) Sawatzky stellt fest:
„Die Stellungnahme der Altkolonisten zu Wandlungen des Zeitgeistes in bezug auf zeitliche sowie geistliche Aspekte ist einfach und unerbittlich. Was einmal von der Bruderschaft vereinbart und mit Gebet beschlossen ist, konstituiert ein feierlich abgelegtes Gelöbnis, das weder widerrufen noch geändert werden kann."(19) Auch Paulus hat gelehrt, dass man bei dem bleiben soll, was man gelernt hat.
Dieses „Machtspiel" der Ältesten hat wahrscheinlich tiefe Wurzeln, die bis nach Russland und noch weiter zurück führen. Da man seit Beginn der Gründung der
Kolonie Chortitza in Russland die Thematik der Leiterschaft im geistlichen und zivilen Bereich nicht endgültig definieren konnte, gingen die Gruppen, die ab 1874 nach Kanada auswanderten, wohl von der Tatsache aus, diesem Problem ein Ende setzen müssen zu. So wurde die Leiterschaft der Gemeinschaft ganz von den geistlichen Führern übernommen. Theoretisch ist die „
Bruderschaft", die sich aus den getauften Männern der
Gemeinde zusammensetzt, die höchste Instanz in der
Gemeinde. Die Entscheidungen, die auf der
Bruderschaft getroffen werden, sollen auch für den Ältesten und den
Lehrdienst bindend sein.
(20)Die
Taufe wird einmal jährlich durchgeführt. Der vorhergehende Taufunterricht wird zwischen Ostern und Pfingsten für die Jugendlichen im entsprechenden Alter erteilt. Meist handelt es sich hier um Jugendliche im Alter von 18 – 20 Jahren. Am dritten Sonntag nach Ostern bleiben die Väter der Jugendlichen, die getauft werden sollen, nach dem Gottesdienst zurück, und es wird eine kurze Predigt gebracht. Danach werden die Namen der Taufkanditaten bekannt gegeben. Am darauffolgenden Sonntag wiederholt sich der Vorgang mit dem Unterschied, dass die jeweiligen Väter einen Zeugen mitbringen, den sich der Taufkanditat gewählt hat. Diese Person bezeugt, dass die Einstellung des Kandidaten ernst gemeint ist. Der fünfte Sonntag nach Ostern ist der erste Prüftag der Taufkandidaten, an dem der erste Teil der Fragen und Antworten des
Katechismus auswendig aufgesagt werden muss, die zweite Hälfte erfolgt am Himmelfahrtstag. Den
Katechismus müssen die Taufkanditen vor der
Taufe auswendig lernen. Der bei den Altkoloniern gebräuchliche
Katechismus ist vom Jahre 1783 aus Elbing in Preußen.
(21) Am letzten Sonntag vor Pfingsten prüft man die Taufkandidaten, und am ersten Pfingstfeiertag erfolgt die
Taufe durch Begießen und die Aufnahme in die
Gemeinde. Die Jugend nimmt ihren Weg in die
Gemeinde durch den Katechismusunterricht. Dadurch wird die Integrität der Gemeinschaft bewahrt. Gemeindezugehörigkeit und Koloniesbürgschaft decken sich dadurch fast lückenlos.
(22)Jugendliche, die vor der
Taufe sexuellen Verkehr gehabt haben, fallen beim Taufakt durch unterschiedliche Kleidungsart auf.
(23)Das geistliche Leben geht oft über den rituellen kirchlichen Vorgang am Sonntag nicht hinaus. Der Besuch des Gottesdienstes am Sonntag ist heilig. Mit Gebet, Liedern und Predigt wird der Gottesdienst gefeiert. Sonntagsschule, Jugendstunde, Bibelkreise usw. außerhalb des Gottesdienstes finden nicht statt. Der Gemeindegesang wird von Vorsängern angeleitet. Für Außenstehende ist diese Art von Gesang ganz unverständlich.
Durch die bestehende, in jeder Lokalgemeinde selbst festgelegte Gemeindestruktur kann es in der Gemeinschaft leicht zu Spaltungen kommen. Weiter ist die
Gemeinde auch der Ort, wo Fehlverhalten der einzelnen Gemeindemitglieder, die im wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und geistlichen Bereich unterlaufen sind, bestraft werden. Die Gemeindezucht wird konsequent durchgeführt. Wenn ein Fehltritt aus dem von der
Gemeinde vorgeschriebenen Rahmen erfolgt ist, wird die betreffende Person ermahnt. Diese Arbeit übernimmt in einigen Gemeinschaften der „Kroaga".
(24) Wenn die Gespräche zu keinem Erfolg führen, wird der Schuldige „zum Donnerstag" vor den Lehrstand gebeten, wo er sich verteidigen muss. Wenn alle Ermahnungen nichts nützen, wird die betreffende Person von der
Bruderschaft am Sonntag nach dem Gottesdienst durch „Bann" und „Meidung" von der Gemeinschaft isoliert. Im Volksmund spricht man davon, dass der Gebannte „losjemogt" ist, d.h. er ist „losgemacht" von den Privilegien der Gemeinschaft. Der Gebannte muss in aller Hinsicht gemieden werden, sei es bei der Tischgemeinschaft sowie auch in den wirtschaftlichen und zivilen Beziehungen. Dieser Prozeß soll dazu dienen, dass der Schuldige zur Einsicht kommt. Nach einer Umkehr vom „sündigen Weg" sind die Türen in der
Gemeinde immer offen.
(25)Die Essenz des Glaubens ist nicht eine lebensfrohe Einstellung Gott gegenüber, der alle Freiheit gegeben hat, ihm nachzufolgen, vielmehr wird eine von der
Tradition geprägte, bedingungslose und den Gemeinderegeln unterworfene
Nachfolge gepredigt. Wem dieses Konzept zu eng ist, der wird immer wieder unter Druck gesetzt, um ihn zur Umkehr auf den „richtigen Weg" hin zu zwingen. Ein sehr beliebter und viel gebrauchter Ausspruch lautet: „Wie han daut emma soo jehaut, in so saul daut uck bliewen".
(26)Die Theologie der Altkolonier geht davon aus, dass die
Gemeinde die Autorität hat, über Punkte wie Kleidung, Nutzung der Technologie, Lebensstil usw. der einzelnen Gemeindeglieder zu entscheiden.
Tradition steht an oberster Stelle und bestimmt die Bibelauslegung. Als größter Feind gilt die „Welt". Aus diesem Grund hat die
Gemeinde das Recht und die Pflicht, dem Gemeindeglied den Weg und den Lebensstil aufzuzeigen, um der Weltlichkeit vorzubeugen. Das christliche Zeugnis besteht darin, zu zeigen, dass man von der Welt abgesondert leben kann.
(27) Für die Lebensstrecke in dieser Welt aber gelten bei den Altkoloniern Arbeitsamkeit, Ehrlichkeit und Vertrauen als oberste Werte. Immer wieder wird von der Kanzel betont, dass diese Werte unentbehrlich für das Zusammenleben auf dieser Erde sind. Wer nicht arbeiten will, wird als „Heide" betrachtet. Auch wird eine starke Leidenstheologie gepredigt. Obwohl man auch immer wieder gelassene und zufriedene Menschen findet, gibt es verhältnismäßig viele emotional gestörte und depressive Personen, weil Leiden als eine aufgezwungene Tatsache gelehrt und empfunden wird.
Andererseits betont die Theologie der Altkolonier auch die Gastfreundschaft. Sie sind tatsächlich sehr gastfreundlich, und bei plötzlichem Unglück wird die Anteilnahme betont und gepflegt. Auch der Besuch von kranken Personen wird ernst genommen.
Der Begriff vom „persönlichen Verhältnis" mit Jesus Christus, wie er in anderen Kreisen gebraucht wird, existiert bei den Altkoloniern so nicht. In den neuen Gemeinden einiger Kolonien wie
Sommerfeld,
Bergthal und
Rio Verde sucht man in dieser Hinsicht einen neuen Weg. Es stellt sich die Frage, ob man auf dieser Grundlage im biblischen Sinn gerettet werden kann. Im Verständnis der Altkolonier hat das einzelne Gemeindeglied keine Heilsgewissheit. Ein Gotteskind kann laut ihrer Überzeugung nur bis zum letzten Atemzug beten und hoffen, dass es gerettet wird.
(28) Argumentiert wird, dass man es sich nicht wagen kann zu behaupten, gerettet zu sein. Einerseits wird öffentlich diese alles bestimmende Lehre gepredigt, und anderseits beobachtet man doch viele Personen die eine innere Unruhe der bestehenden Situation gegenüber zeigen.
Der Begriff „Welt" beinhaltet für die Altkolonier alles, was sich nicht im Gemeinschaftsrahmen befindet, und damit alles Gottesfeindiche. Da man diese Erde nur als ein Durchgangslager für das nach dem Leben folgende Geschehen sieht, steht man ihr mit einer eher feindlichen und defensiven Haltung gegenüber. Mit einer sehr kritischen Haltung werden Elemente aus der „Welt" in den Kontext der Gemeinschaft integriert, sei es im wirtschaftlichen oder kulturellen Bereich. So wurde in einer
Kolonie, nachdem der Älteste selber mehrere Pferde bei der Reisproduktion verloren hatte, ein alter Beschluss aufgelöst und die mechanische Bearbeitung des Bodens zugelassen.
Die
Absonderung von der „Welt" soll dazu beitragen, dass man sich möglichst vor deren negativen Einflüssen schützt. Diese konservative Lebenshaltung ist sehr eng verbunden mit dem Gemeindeverständnis. Der Grundsatz ist eine schlichte und demütige Lebensform. Ständig steht ihnen die Warnung vor einer Gleichstellung mit der Welt vor Augen. Aus diesen Umständen hat sich eine Lebensart entwickelt, die die ganze Gruppe homogen erscheinen lässt. Andererseits hat der wirtschaftliche Fortschritt, wie z.B. in den Kolonien
Sommerfeld und
Bergthal, auch eine gewisse Öffnung mit sich gebracht. Der Reichtum drückt sich aber mehr in der Anhäufung von Kapital und Besitz aus, wie z.B. Ländereien, Fahrzeuge usw. nicht aber in einem luxuriösen Leben. Die Aufforderung, die Entbehrungen des Lebens auf sich zu nehmen sowie auch Gott und seinen Dienern den nötigen Gehorsam zu leisten, wird oft mit Bibelversen aus dem Neuen Testament belegt. Ansonsten vergleicht man sich gerne mit dem Volk Israel. Der Vergleich mit dem Volke Israel ist besonders beliebt, da dieses Volk im Laufe seiner Geschichte auch viele Demütigungen, Entbehrungen und viel Unverständnis von Seiten der Umwelt erleben musste. Auch die vielen
Wanderungen des Volkes Israel passen ausgezeichnet ins Konzept. Belegt werden diese Gedanken oft mit den Psalmworten. Die biblischen Belege für die Stärke und Weisheit Gottes und in indirekter Form auch der Ältesten werden aus dem Alten Testament angeführt, z.B. aus Mose, Hiob und Salomo.
(29) In den wenigen Schriften, die diese Themen behandeln, findet man selten Anführungen aus den Evangelien. Für Predigten werden hauptsächlich Aussprüche des Alten Testamentes verwendet, und für die konkrete Lebensweise dienen aus dem Kontext entfernte Aussagen des Neuen Testamentes. Vielleicht sind die Passagen aus dem Alten Testament bei den Altkoloniern auch so beliebt, weil sie leichter zu lesen sind für Personen, die intellektuell nicht so angeregt wurden.
In diesem Zusammenhang fällt auf, dass die Mennoniten kanadischen Ursprungs, d.h. aus
Sommerfeld und
Bergthal, eine weniger konservative Einstellung zur Welt haben. Die Mennoniten mexikanischen Ursprungs dagegen haben in dieser Hinsicht eine radikalere Haltung. In der
Kolonie Sommerfeld besteht jeweils in wirtschaftlicher und administrativer Hinsicht eine Zusammenarbeit, d.h. Kooperative, Krankenhaus, Altenheim, Sportaktivitäten werden gemeinschaftlich organisiert, die Kleidung ist nicht so einförmig wie bei den mexikanischen Mennoniten usw. Nur das
Gemeinde– und Schulkonzept ist in fast allen Gemeinschaften unverändert geblieben.
Bei den Mennoniten mexikanischen Ursprungs ist die
Absonderung von der Welt in noch radikalerer Form spürbar. Die mechanisierte
Bodenbearbeitung ist zwar erlaubt, aber im Fall von
Nueva Durango werden die Reifen der Traktoren z.B. durch Eisenräder ersetzt, um dem Einfluss der Welt zu widerstehen. Motorisierte Fahrzeuge für den Transport von Personen sind verboten, dazu steht der Buggy
(30), von Pferden gezogen, zur Verfügung. Ein Bart wird von den Altkoloniern nicht getragen. Die Kleidung ist für alle Mitglieder der
Kolonie einförmig. Die männlichen Personen haben eine Latzhose, in grünlichem oder bläulichem Ton, ein Hemd, und in den meisten Fällen einen Cowboyhut, der aus der mexikanischen
Kultur übernommen wurde. Die weiblichen Personen bekleiden sich mit einem langen, dunklen Kleid mit langen Ärmeln und einer Kopfbedeckung, je nach zivilem Stand. Das schlicht gescheitelte Haar ist immer mit einem Kopftuch bedeckt. Am Sonntag tragen die Frauen einheitlich dunkle Kleider, und wenn sie verheiratet sind, eine kunstvoll hergestellte schwarze Haube. Die einförmige Kleidung soll auf Demut und Gleichheit vor Gott hinweisen. Diese Kleidung ist für ein Land mit feuchtheißem Klima wie
Paraguay etwas unpraktisch. Eine Ausnahme bildet hier die
Kolonie Santa Clara, die in dieser Hinsicht offener ist.
Der Konsum von alkoholischen Getränken steht bei den Altkoloniern nicht im Widerspruch zum Glaubensleben. Dies ist ein weiterer Beweis für die Originalität der von Russland übertragenen Lebensformen, denn in Russland waren die Mennoniten bekannt für ihre Brauereien. In den Kolonien in Ostparaguay wird zwar kein Bier gebraut, wohl aber ohne Schuldgefühle konsumiert. Doch gegen den Alkoholmissbrauch wird stark gepredigt.
Eine große Herausforderung war für die Altkolonier auch die Einführung des elektrischen Stromes in den Haushalten. In
Nueva Durango wanderte z.B. 1994 fast die Hälfte der Bewohner nach Bolivien aus, als der elektrische Strom in der
Kolonie installiert wurde, wenn auch behauptet wurde, dass dies nur der letzte Tropfen gewesen sei, der das Gefäß zum Überlaufen brachte. So gibt es auch heute noch in der genannten
Kolonie Höfe, wo im Haus der älteren Generation noch kein elektrischer Strom eingerichtet ist, wohl aber im Haus des Sohnes auf demselben Hof. Die große Mehrheit der Altkolonier in
Paraguay benutzt heute wohl den elektrischen Strom. Der Gebrauch von Radio,
Telefon und Fernsehen ist bei den Altkoloniern mexikanischen Ursprungs ganz verboten.
Eine weitere stark ausgeprägte Eigenart der Altkolonier ist, dass sie von allen Außenstehenden in Ruhe gelassen werden wollen. So lassen sie auch andere religiöse und kulturelle Gemeinschaften in Ruhe. Kurzer Gastbesuch wird voll akzeptiert, doch sie wünschen nicht, dass jemand kommt, um sie zu studieren und noch viel weniger, um sie zu verändern. Um das „Seelenheil" der eigenen Leute wird hart gerungen, aber für die „Auswärtigen" empfindet man keinen Missionsauftrag.
Erziehung Der Erziehungsbereich ist für die Mennoniten und auch für die Altkolonier ein wichtiges Element, um die Grundlagen der
Tradition, des allgemeinen Wissens und des Glaubens, von Generation zu Generation weiter zu geben. Die unbehinderte Erziehungsarbeit war immer eine der Forderungen, wenn es darum ging, Privilegien für eine neue Heimat auszuhandeln. Man ging davon aus, dass die Umwelt und besonders auch der Staat keinen Einfluss auf den Prozess der Erziehung haben durfte. In deutscher Sprache wollte man die Glaubensprinzipien und die traditionellen Formen des Gemeinschaftslebens sowie auch das für notwendig angesehene Wissen mit Hilfe eines eigenen Schulsystems an die Kinder weiter vermitteln. Der ganze Erziehungsbereich steht bei den Altkoloniern unter der Aufsicht des Lehrdienstes.
Die akademischen Anforderungen an den Lehrer sind im Normalfall nicht hoch. Wichtig ist, dass er einigermaßen gut lesen kann, was aber nicht heißt, dass er sein Amt nicht mit viel Fleiß und Ausdauer ausübt. An erster Stelle steht nicht die Vermittlung von Wissen, sondern das Vermitteln von Werten wie Disziplin, Ordnung und Gehorsam. Der Unterrichtsstoff wird mit Hilfe eines Frontalunterrichtes erteilt. Freie Meinungsäußerungen, eigene Überlegungen und Konversation im Unterricht passen nicht ins Erziehungskonzept. Die offizielle Unterrichtssprache in den Schulen der Altkolonier ist deutsch. Die mündliche Kommunikation läuft aber hauptsächlich in plattdeutscher Sprache ab. Die spanische Landessprache gehört nicht zum Schulprogramm. Nur in Schule und Kirche
macht man Gebrauch von der deutschen Sprache. Die allgemeine Umgangssprache ist
Plattdeutsch.
Der Unterricht wird in den jeweiligen
Dorfschulen erteilt. Alle Schüler sitzen in einem Raum, und die Sitzordnung ist je nach Alter und Leistung aufgeteilt. Meistens sitzen ganz vorne beim Lehrer die besten und ältesten Schüler. Die Klasse wird je nach Alter und Leistung in „Fibler", „Katechismer" „Testamentler" und „Bibler" aufgeteilt. Unterrichtsmaterialien sind kleine Buchstabierbüchlein, der
Katechismus, das Neue Testament, die
Bibel und das Gesangbuch. In einigen Kolonien, wie z.B.
Rio Verde, wird neuerdings auch anderes Übungsmaterial hinzugezogen, z. B. die Materialien von Richard Lange für den Deutschunterricht. Die Bücher werden in Druckereien in den eigenen Kolonien hergestellt, d.h. kopiert und eingebunden. Die altdeutsche, bzw. gotische Schrift, ist noch immer die bevorzugte Schreibweise. Die Schüler lernen Lesen, Schreiben und Gebete, Sprüche und Lieder auswendig. Auch gibt es eine elementare Einführung in die verschiedenen Rechnungsarten.
(31)In allen Siedlungen der Altkolonier besuchen die Jungen sieben Jahre die Schule und die Mädchen jeweils nur sechs Jahre. Das Schuljahr wird in zwei Etappen aufgeteilt. Die erste Etappe läuft um die Mitte des Jahres etwa fünf Monate, und die zweite Etappe ist die sogenannte „Weihnachtsschule". Mit einigen wenigen Ausnahmen, wie z.B. eine kleine Schule in
Bergthal und die Schule der neugegründeten
Gemeinde in
Sommerfeld, ist keine der Schulen der Altkolonier in
Paraguay vom Erziehungsministerium anerkannt. Man beruft sich immer noch fest auf das Privileg 514, wonach die
Mennoniten in Paraguay das Recht haben, ihre Erziehungsarbeit selbständig und ohne staatlichen Einfluss durchzuführen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Altkolonier die Erziehungsarbeit als Traditionsvermittlung sehr ernst nehmen. Jedoch als Wissenvermittlung und Vorbereitung für die Zukunft lässt sie große Lücken offen und es gibt viele funktionale Analphabeten in den Siedlungen. In den Schulen der Altkolonier wird wenig Wert auf verstehendes Lesen, logisches Denken, analysierendes und zusammenfassendes Arbeiten, gegenseitiges Verständnis und Toleranz gelegt. Von der Vorbereitung für technische Kenntnisse ist hier überhaupt keine Rede. Logischerweise steht das niedrige Erziehungsniveau auch im direkten Verhältnis zu dem Niveau der Lehrer. Inwieweit die Schüler wirklich für die Herausforderungen der heutigen Welt vorbereitet werden, ist sehr fraglich. Andererseits schafft diese Art der erzieherischen Vorbereitung für das Leben auch wieder die Grundlage, dass der Einzelne nicht so leicht aus dem von der
Gemeinde und Gemeinschaft vorgegebenen Rahmen springt. Besser ausgebildete Personen können bestehende Werte und Formen leichter hinterfragen. Man sichert sich für alle Mitglieder der Gemeinschaft ein einheitliches Erziehungsniveau ab, mit dem von Seiten der Gemeindeleitung die traditionellen Lebensformen effektiver eingehalten werden können.
(32)Im wirtschaftlichen Leben zeichnen sich die Altkolonier durch ihr praktisches und effektives Handeln aus. Geprägt von einer starken Arbeitsmentalität arbeitet die ganze
Familie für den wirtschaftlichen Unterhalt des Familienbetriebes. Hier ist es auch wieder die
Gemeinde, die die Entwicklung kontrolliert und teilweise bremst. So verhängten z.B. die Ältesten von
Bergthal noch in den achtziger Jahren den Bann gegen Personen, die mit der „Außenwelt" Geschäfte machten. Doch die Entwicklung nahm ihren Lauf, und es kam zur Gründung von mehreren privaten Unternehmen sowie auch der jeweiligen Kooperativen in
Bergthal und
Sommerfeld. Die Kolonien
Sommerfeld und
Bergthal zeichnen sich durch eine starke wirtschaftliche Entwicklung aus. Erst war es das rücksichtslose Roden großer Wälder und die entsprechende Holzverarbeitung, und später brachten eine intensive Land- und Milchwirtschaft wirtschaftliche Erfolge. Im Bereich der Zusammenarbeit der verschiedenen Siedlungen der Altkolonier in
Paraguay auf auf wirtschaftlicher Ebene praktisch nichts.
In den Kolonien mexikanischen Ursprungs sieht die Situation etwas anders aus. Die vor einiger Zeit gegründeten Kooperativen in
Rio Verde und
Nueva Durango sind nicht mehr funktionsfähig. Ursachen sind wohl die fehlende Kooperation und Professionalität in der Führung dieser Institutionen.
Man kann wohl sagen, dass die große Mehrheit der Familien sich ihren wirtschaftlichen Unterhalt mit viel Fleiß und Mühe erarbeitet hat und sich mit den gegebenen Umständen auch zufrieden gibt. Die Mentalität der Altkolonier im wirtschaftlichen Bereich ist in vielen Fällen noch nicht vom Kapitalismus geprägt. Allgemein wird nicht großer Reichtum angestrebt, sondern es geht darum, für einen sicheren Unterhalt der
Familie zu sorgen. Die kinderreichen Familien in den Siedlungen der Altkolonier verlangen einen relativ großen Aufwand, eine ausgeglichene Versorgung zu erreichen. Durch eine stärkere Kooperation auf wirtschaftlichem Gebiet, sei es bei der Beratung der Bauern,
Kredite oder der Vermarktung der Produktion könnten noch viel bessere wirtschaftliche Resultate erzielt werden.
Wenn in
Paraguay von Mennoniten gesprochen wird, denken viele Paraguayer sehr oft zuerst an die Gruppe der Altkolonier, weil sie am meisten durch ihre Kleidung und Lebensweise auffallen. Doch beträgt die Anzahl der Altkolonier nur 15 % der
Mennoniten in Paraguay. Wahrscheinlich ist es die Gruppe der Mennoniten, die sich bisher am wenigsten mit dem neuen Heimatland,
Paraguay, identifizieren kann. Durch die Weltfeindlichkeit wirkt ihre Lebensweise auf die Umwelt oft abstoßend.
Fremd wirkt wohl am meisten die Einstellung zum Leben, wobei Gefühle unterdrückt werden und keine frohe Lebenseinstellung aufkommen will. Der Körper wird als ein Gefängnis für die Seele angesehen.
(33) Krankheit ist eine Strafe Gottes, die der Züchtigung dient, damit man freier von der sündigen Natur wird. Leiden ist ein Vorrecht, und darin ist Christus ein Vorbild gewesen, denn er hat am Kreuz am meisten gelitten. Harte Lebensbedingungen sind ein Mittel Gottes, um die Menschen näher zu sich heranzuziehen. Gott ist nicht ein Gott der Freude, des Lobes und der Freiheit, sondern ein Gott, der straft, züchtigt und von seinen Kindern in der Welt Entbehrungen verlangt.
Bildung und luxuriöses Leben sind für die Altkolonier Versuchungen Satans. Zu Gott hat man mehr über die
Gemeinde und den Ältesten Zugang, als direkt über eine persönliche und lebendige Beziehung. Aus diesem Grund ist auch der Älteste für das Seelenheil seiner Glieder verantwortlich.
Dieser Umstand führt notgedrungen zu einer Verflachung und Erstarrung des Glaubens und des Gemeindelebens. Zusammenarbeit unter den Gemeinden kommt nicht zustande. Auch die persönliche Freiheit des einzelnen Gemeindegliedes wird sehr stark eingeschränkt. Probleme in der Gemeinschaft und in der Siedlung werden automatisch zu Gemeindeproblemen.
Das Prinzip der gegenseitigen Hilfe und der Gastfreundschaft ist jedoch in der Gemeinschaft der Altkolonier tief verankert. Bestimmt wäre es für die Altkolonier eine große Hilfe, wenn sie ihre wiedertäuferischen Wurzeln neu entdecken könnten. Dadurch könnten sie, ohne ihre eigenen und liebgewordenen Traditionen und Werte total aufgeben zu müssen, ihre Aufgabe entdecken und sich den Herausforderungen eines neuen Jahrtausends in
Paraguay stellen.
(34)
Bibliographie - Bender, Harold S. La visión anabautista. Colección Horizontes. Ed. Clara-Semilla, Bogotá, 1944
- Dyck, Cornelius J.: An Introduction to Mennonite History. A popular history of the anabaptists and the mennonites. Scottddale – Pennsylvania, Herald Press, 1981, p. 189
- Dyck, Isaak M. Hinterlassene Schriften vom Ältesten Isaak M. Dyck. Mexiko, Imprenta Mennonita, 1994, 123 S.
- Enns, Andreas: Die Gerichtsprozesse während des Konfliktes in Bergthal 1996/7. Asunción, 1999.
- Epp, George K.: Geschichte der Mennoniten in Russland. Band I. Deutsche Täufer in Russland. Lage, Logos Verlag, 1997.
- Epp, George K.: Geschichte der Mennoniten in Russland. Band II. Die Gemeinschaft zwischen Fortschritt und Krise. Lage, Logos Verlag, 1998.
- Friesen, Martin W.: Neue Heimat in der Chacowildnis. Canada. Printet in Canada. 1987.
- Hege, Christian, Neff Christian und Gerhard Hein: Mennonitisches Lexikon. 4 Bände, Weiherhof, 1913 – 1967.
- Klassen, Peter P.: Die Mennoniten in Paraguay, Band I. Asunción, Impr. Modelo, 1988.
- Klassen, Peter P.: Die Mennoniten in Paraguay, Band II. Asunción, Impr. Zamphirópolos, 1988.
- Penner, Horst. Weltweite Bruderschaft. Ein mennonitisches Geschichtsbuch. 5. Auflage,Weierhof, 1995.
- Quiring, Dr. Walter. Russlanddeutsche suchen eine Heimat. Die deutsche Einwanderung in den paraguayischen Chaco. Verlag Heinrich Schneider Karlsruhe, 1938.
- Peters, Abe: Comunidades "Old Colony" enfrentan retos dificiles. Documento sin publicación. Canadá, 1999.
- Peters, Klaas: Die Bergthaler Mennoniten und deren Auswanderung aus Russland und Einwanderung in Manitoba. Zum 25jährigen Jubiläum. Florida, 1922, 52 S.
- Ratzlaff, Gerhard: Auf den Spuren der Väter. Eine Jubiläumsschrift der Kolonie Friesland in Ostparaguay. 1937 – 1987. Asunción, 1987.
- Ratzlaff, Gerhard: Die mennonitischen Siedlungen in Ostparaguay. Kol. Friesland, 1976.
- Ratzlaff, Gerhard: Inmigración y Colonización de los Mennonitas en el Paraguay bajo la Ley 514. Asunción, 1993.
- Ratzlaff, Gerhard. Die traditionellen Mennoniten. Unveröffentlichter Aufsatz. Asunción, 2000.
- Regier, Hans Theodor: Die Mennonitenkolonie Friesland in Ostparaguay. 1993, 20 S.
- Sawatzky, Harry Leonard: Sie suchten eine Heimat. Deutsch-Mennonitische Kolonisierung in Mexiko. 1922 – 1984. Marburg, N.G. Elwert Verlag, 1986.
- Verwaltung der Kolonie Sommerfeld. Geschichtsbildband zum 50jährigen Bestehen der Kolonie Sommerfeld. 1948 – 1998. Sommerfeld, 1998.
- Warkentin, Abe: Gäste und Fremdlinge. Strangers and Pilgrims. Kanada, Die Mennonitische Post, 1995.
- Wenger, John Christian: Compendio de Historia y Doctrina Menonitas. Buenos Aires. 1960.
Fussnoten:
| Horst Penner spricht von rund 8.000 Mennoniten, die in den 70er Jahren aus der Altkolonie Chortitza in Russland, nach Kanada übersiedelten. |
| Sawatzky, Harry Leonard. Sie suchten eine Heimat. Deutsch-Mennonitische Kolonisierung in Mexiko. 1922 – 1984. Marburg, N.G. Elwert Verlag, 1986, S. 11 ff. |
| Penner, Horst. Weltweite Bruderschaft. Ein mennonitisches Geschichtsbuch. Weierhof, 5. Auflage, 1995, S. 190. |
| Dyck, Cornelius J.: An Introduction to Mennonite History. A popular history of the anabaptists and the mennonites. Scottdale – Pennsylvania, Herald Press, 1981, S. 312. |
| Sawatzky, Harry Leonard: Sie suchten eine Heimat. Deutsch-Mennonitische Kolonisierung in Mexiko. 1922 – 1984. Marburg, N.G. Elwert Verlag, 1986, S. 60 ff. |
| Diese Zahlen sind in den verschiedenen Quellen unterschiedlich. |
| |
| Ratzlaff, Gerhard: Die mennonitischen Siedlungen in Ostparaguay. Kol. Friesland, 1976, S. 9 |
| |
| Die aktuellen Daten der mennonitischen Kolonien in Ostparaguay liegen im Archiv der "Asociación de Colonias Mennonitas del Paraguay" vor. Die Daten stammen aus dem Jahr 1998. |
| Warkentin, Abe: Gäste und Fremdlinge. Strangers and Pilgrims. Kanada, Die Mennonitische Post, Steinbach 1995, S. 85 ff. |
| Ratzlaff, Gerhard. Die mennonitischen Siedlungen in Ostparaguay. Kol. Friesland, 1976, S. 9 ff. |
| Ratzlaff, Gerhard: Die mennonitischen Siedlungen in Ostparaguay. Kol. Friesland, 1976, S.22 ff. |
| Klassen, Peter: Die Mennoniten in Paraguay. Reich Gottes und Reich dieser Welt. Bolanden – Weiherhof, Mennonitischer Geschichtsverein, 1988, S. 144 |
| Die neue Gemeinde nennt sich "Evangelische Mennoniten Gemeinde Sommerfeld" (E.M.G.). Sie führt ihre eigene Schule, ein Krankenhaus und mehrere andere Missionsprojekte. |
| Enns, Andreas: Die Gerichtsprozesse während des Konfliktes in Bergthal 1996/7. Asunción, 1999 |
| Sie haben die gleiche Funktion wie in den anderen Kolonien die Oberschulzen. |
| |
| Sawatzky, Harry Leonard: Sie suchten eine Heimat. Deutsch-Mennonitische Kolonisierung in Mexiko. 1922 – 1984. Marburg, N.G. Elwert Verlag, 1986, S. 241. |
| Ratzlaff, Gerhard: Die traditionellen Mennoniten. Unveröffentlichter Aufsatz. Asunción, 2000. |
| Ratzlaff, Gerhard: Die traditionellen Mennoniten. Unveröffentlichter Aufsatz. Asunción, 2000. |
| |
| |
| Der "Kroaga" ist eine Art kirchlicher Gerichtsbote. |
| Sawatzky, Harry Leonard: Sie suchten eine Heimat. Deutsch-Mennonitische Kolonisierung in Mexiko. 1922 – 1984. Marburg, N.G. Elwert Verlag, 1986, S. 213 |
| "Wir haben das immer so gehabt, und so soll das auch bleiben". |
| Peters, Abe: Comunidades "Old Colony" enfrentan retos dificiles. Documento sin publicación. Canadá, 1999 |
| Diese Aussagen beruhen auf Gesprächen, die mit Vorstehern und Ältesten geführt wurden. |
| Dyck, Isaak M.: Hinterlassene Schriften vom Ältesten Isaak M. Dyck. Mexiko, Imprenta Mennonita, 1994, S. 3 ff. |
| Der Buggy ist ein leichter gefederter Wagen mit Gummireifen. |
| Ratzlaff, Gerhard: Die traditionellen Mennoniten. Unveröffentlichter Aufsatz. Asunción, 2000. |
| Die meisten Schilderungen beruhen auf eigenen Erfahrungen, die während mehrerer Besuchen in den Siedlungen der Altkolonier sowie auch in den jeweiligen Schulen gemacht wurden. |
| Dyck, Isaak M.: Hinterlassene Schriften vom Ältesten Isaak M. Dyck. Mexiko, Imprenta Mennonita, 1994, S. 53 |
| Mein Dank gilt in besonderer Weise Dr. Hans Epp und Gerhard Ratzlaff, die den vorliegenden Artikel vom Inhalt her korrigiert und auf wichtige Verbesserungsvorschläge hingewiesen haben. |
Zwischen Tradition und Restitution
Perspektiven für einen katholisch-mennonitischen Dialog
Gundolf Niebuhr
1. Einführung
Kürzlich flatterte mir eine köstliche Anekdote in die Hände(2): „Es waren einmal zwei Mennoniten, die als einzige einen Schiffbruch überlebten. Sie retteten sich auf eine unbekannte Insel. Nach einiger Zeit wurden sie gefunden. Zum Erstaunen der Retter hatten diese Zwei immerhin drei mennonitische Gemeinden mit eigenen Gebäuden gegründet. Auf die Frage nach dem Warum antworteten sie: `Der eine geht in die eine Gemeinde, der andere in die andere.’ Und warum die dritte? – `Das ist die Gemeinde, in die wir beide nicht gehen!’"
Die Übertreibung zu humoristischem Zweck in dieser Erzählung ist offensichtlich, und doch ist ein Körnchen Wahrheit dabei, welches seine historischen Wurzeln hat. Im folgenden Aufsatz wird auch auf diesen Aspekt Bezug genommen.
Notwendigerweise muss das Folgende einen sehr zusammengefassten Überblick darstellen, auch wenn wir dabei Gefahr laufen, nicht alle relevanten Themen anzusprechen; noch weniger, sie gebührend zu entwickeln.
Bevor wir jedoch, ins Thema einsteigen, ein paar semantische Definitionen, um Missverständnisse zu vermeiden: Sind Mennoniten
(3) eine Ethnie, sind sie eine Kirche oder eine kirchliche Konfession? In unserem Land ist es durchaus üblich, sie als Ethnie darzustellen, was auf ganz erklärlichen Ursachen beruht. Sie wanderten als geschlossene Gruppe ein, sie hatten ihre
Kultur, ihre Sprache, ihren Glauben. Sie hatten blaue Augen, blondes Haar und noch andere Eigenschaften. Auch Mennoniten konservativer Prägung kamen ins Land und fielen noch stärker auf durch ihre einheitliche Kleidung, durch ihre isolierte Lebensweise, immer mit einem Hauch von Misstrauen und Distanz der anderen, der „fremden" Bevölkerung gegenüber. Für den Beobachter war und ist es natürlich zu schlussfolgern, dass es sich hier um eine eigenständige Gruppe handelt, mit eigener
Kultur, eigenen Werten, kurz, mit eigenen Wesenszügen. Von daher erhielt der Ausdruck „
Mennonit" im Mund des Volkes einen ausschließlich ethnisch-kulturellen Inhalt, wodurch die Tatsache verdunkelt wird, dass er in Wirklichkeit ein konfessioneller Terminus ist. Gegenwärtig befinden sich die meisten Mennoniten in Afrika, Indien, Indonesien u. a., und die Mennoniten weißer Hautfarbe sind, zahlenmäßig, nicht mehr in der Mehrheit.
Konfessionelle Bezeichnungen werden selten selbst gewählt; sie werden meistens von außen auferlegt. Im Fall der Mennoniten war es die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts, als zunehmend der Name des
Menno Simons den Mitgliedern der täuferischen Bewegung angehängt wurde, vor allem in Norddeutschland. Die Betroffenen tolerierten anfänglich und akzeptierten schließlich diese Tatsache. Jedoch war diese Akzeptanz nicht universal. In der Schweiz nennen sie sich bis heute die „Taufgesinnten" und in Holland die „Doopsgezinde" – derselbe Begriff. Sie bezeichnen sich also als diejenigen die von der
Taufe, d.h. der Erwachsenentaufe (damals eine zweite, also Wiedertaufe), überzeugt sind.
Eine weitere terminologische Erklärung, die hier implizit schon gemacht wird, ist der Begriff „Konfession" (Kirche oder kirchliche Gemeinschaft wären Synonyme) statt „Sekte". In
Paraguay war und ist es üblich, vor allem in kirchlichen Kreisen, die Mennoniten als eine von vielen „Sekten" anzusehen. Ich ziehe es vor, diesen Begriff nicht zu brauchen, einmal wegen der negativen Konnotationen, aber auch weil der historisch-theologische Hintergrund das nicht rechtfertigen würde. Weil Mennoniten die erste Freikirche darstellen, die während der Reformation in Europa entstand, kann man sie nicht mit den Kriterien beschreiben, die für Sekten aus dem 19. und 20. Jahrhundert charakteristisch wären. Der Begriff „Sekten" ist heutzutage kompliziert, und wir wollen ihn hier nicht vertiefen, zumal genügend gute Literatur darüber vorhanden ist.
Theologisch-liturgische Wesenszüge der radikalen Reformation
Die sozialen, politischen und vor allem die religiösen Turbulenzen des 16. Jahrhunderts sind allgemein bekannt. Und in dieser turbulenten Epoche steht die Wiege der Täuferbewegung. Die Mennoniten, die Brüder in Christus (die auch an der Mennonitischen Weltkonferenz beteiligt sind) und die
Baptisten bis zu einem gewissen Grad, sehen sich als kirchlich-theologische Erben dieser Bewegung im 16. Jahrhundert, heute oft die radikale Reformation genannt.
Die Merkmale dieser Bewegung? Es ist auffallend, dass Mennoniten über vier Jahrhunderte hinweg keine besonderen Bemühungen machten, ihre Lehren zu definieren oder zu verteidigen. Der Glaube wurde durch ein Leben praktischer Jüngerschaft sichtbar, durch einfache Liturgie und eine Gemeindeordnung, die dem Leben in der ländlichen Dorfgemeinschaft entsprang. Alle Ämter wurden weitgehend von Laien geführt. Anfänglich, in den Jahrzehnten nach der ersten
Taufe im Grebelkreis, gab es sehr wohl kreatives und kompetentes theologisches Denken. Aber im späten 16. Jahrhundert versandeten diese Bemühungen zunehmend unter dem Druck der starken Verfolgung, dem Verlust von geistigen Führern und den wiederholten Migrationen auf der Suche nach toleranten Fürstentümern. Kurz gesagt, man schaffte eine eigene
Tradition und lebte nach ihren Vorgaben, nachdem die chaotische, aber auch kreative Phase der Reformation verebbt war. Erst das 20. Jahrhundert hat eine Renaissance anabaptistischer Studien erlebt. Anlaß dazu war teilweise die Identitätskrise der Mennoniten in Nordamerika, hervorgerufen durch die fundamentalistisch-modernistische Kontroverse zu Beginn des Jahrhunderts.
In Europa war das Anliegen mehr die Befreiung vom alten Stigma, welches den Nachkommen der Täuferbewegung anhaftete. Durch Tragödien, wie die von Münster, hatten sich Vorurteile sowohl in den Universitäten als auch in der Volksmentalität eingebürgert. Diese Vorurteile fanden z.B. im Roman „Ursula" von Gottfried Keller ihren Ausdruck, in dem die Anhänger der Täuferbewegung als von einem fremden Geist besessen dargestellt werden, der ihnen den eigenen Willen zerstört.
Trotz des Risikos unzulässiger Verallgemeinerungen wollen wir in ein paar Zügen das religiös-intellektuelle Klima nachzeichnen, welches zur Reformation führte und welches auch dieser Bewegung seine Fußspuren einprägte.
Das Hochmittelalter war Zeuge einer nie dagewesenen Institutionalisierung der Kirche gewesen. Die Hierarchie war z.T. hermetisch vom Volk abgesondert und hielt natürlich das Monopol über die Austeilung der gnadenspendenden Sakramente. Ab dem 14. Jahrhundert, verzeichnen wir einen gewissen Gegenstrom der sich, sehr vorsichtig zwar, im Mystizismus der „Deutschen Theologie" und bei Autoren wie Johannes Tauler, Meister Eckhart und Thomas von Kempen manifestierte. Auch der dritte Orden der Franziskaner, welcher erheblichen Einfluss auf die frühe Täuferbewegung hatte, gehört zu dieser institutionskritischen Bewegung.
Der akademische Humanismus, mit seinem Motto „Ad Fontes" spielte eine wesentliche Rolle bei der Herabwertung der heiligen
Tradition und forderte die Restitution von Werten der Antike, spezifisch der griechisch-römischen
Kultur. Diese Forderung wurde in der radikalen Reformation in Richtung Neues Testament – Urkirche verlagert, in der Hoffnung, dass es möglich sei, das Ideal der Urgemeinde wiederzugewinnen.
Die schon erwähnten Tendenzen, der Missbrauch kirchlicher
Macht, der Ablasshandel und andere Faktoren mehr taten das ihrige zur Schaffung des persistenten antiklerikalen Klimas in Nordeuropa an der Schwelle zum 16. Jahrhundert Diese zähe Antipathie, zusammen mit der allgemeinen religiösen Intoleranz der Epoche schafften das Szenario für die Feindschaft und Polemik, die der kollektiven Erinnerung ihren Stempel aufgedrückt haben, wie auch in fast sämtlichen Dokumenten die uns aus dieser Zeit überliefert sind.
Die „radikale Reformation" begann mit der Reformation. Alle prominenten Figuren sind anfänglich Sympathisanten von Luther oder Zwingli. „Ad Fontes" war auch ihr Motto. Die Gruppe in Zürich empfand es als große Enttäuschung, als Zwingli mit dem Magistrat dieses Kantons eine Kompromisslösung einwilligte. Die Reformen sollten nicht überstürzt durchgeführt, und vor allem sollte die Kindertaufe vorläufig beibehalten werden. Für die eifrigen Vertreter des Grebelkreises war dies ein Verrat am Evangelium, denn sie waren schon überzeugt davon, dass nach Vorgabe des NT die Kirche vom Staat getrennt sein müsse, dass die Kirche auf der freiwilligen Mitgliedschaft beruhen und folglich nur Erwachsene getauft werden dürften. Die Tatsache, dass sowohl Luther als auch Zwingli mit den politischen Machthabern Kompromisse eingingen, um die Reform durchzuführen, dürfen wir als Hauptursache für den Dissens der Täuferbewegung ansehen. Was ihnen das Evangelium sagte, wollten sie befolgen, nicht was die weltlichen Machthaber als passend erachten würden. Man dürfe von der weltlichen
Macht keine Anweisungen für die Reformation einer Kirche erwarten, die sich ganz der Botschaft des Evangeliums verpflichtet weiß. Ein fieberhaftes Studium des NT, das erst seit Kurzem in Deutsch vorlag, begann 1523-24, zusammen mit begeisterten theologischen Diskussionen. Dieser Prozess legte die Grundlage für die Abspaltung des Grebelkreises, welche durch die erste öffentliche Erwachsenentaufe in Zürich erfolgte.
Vier lehrmässige Überzeugungen dieser Bewegung könnte man wie folgt formulieren:
- Trennung von Kirche und Staat.
- Eine Kirche basiert auf dem freiwilligen Beitritt, wobei sich ein jeder zu einem Leben der Heiligkeit und der gegenseitigen Ermahnung verpflichtet.
- Erwachsenentaufe, um eine solche Kirche zu symbolisieren und auch zu konstituieren.
- Ein Leben der Nachfolge, genährt und orientiert durch die gemeinschaftliche Bibellese. Die Bibel wurde als einzige normative Quelle für Glauben und Leben in der Kirche angesehen. In der Ethik betonte man die Trennung von der korrupten Welt. Die Ablehnung von Gewalt und Eid gegenüber der Obrigkeit waren wesentlicher Bestandteil dieses Lebensprojektes. Die Nächstenliebe, Solidarität, die sich in Diakonie und karitativen Diensten ausdrückt, war im Nachhinein immer ein starkes und positives Element der mennonitischen Tradition.
Andere Eigenschaften der Täuferbewegung, haben wir mehr im liturgisch-sakramentalen Bereich zu suchen. Die harte Konfrontation mit der katholischen und auch mit der protestantischen Kirche mündete in eine Atmosphäre tiefen Mißtrauens gegen all die Elemente, welche man der Entwicklung der
Tradition in nach-apostolischer Zeit zuschrieb. Mehr noch, die
Täufer nahmen eine ablehnende Haltung gegenüber
Tradition und Lehramt der Kirche ein, so wie sie sich seit Kaiser Konstantins Erklärung des Christentums zur Staatsreligion ergeben hatten. Dieses Ereignis vom Jahr 313 wurde zum Schlüssel für die Interpretation der Kirchengeschichte aus täuferischer Perspektive. Daher erscheint es folgerichtig, dass für das Jahr 2000 bei der dritten Dialogrunde zwischen MWK und Vatikan dieses Thema in den Vordergrund gerückt wurde.
Mitte des 17. Jahrhunderts erschien in Holland der sogenannte
Märtyrerspiegel, ein groß angelegtes Werk, von Thielemann van Braght kompiliert, in dem diese Perspektive der Kirchengeschichte den roten Faden bildet. Der Fall der Kirche kam, als sie nicht mehr eine verfolgte Minderheit war, sondern statt dessen,
Macht und Prestige gewann. – Als die Kirche, um sich selbst zu schützen, zu den Waffen griff. – Als sie von Verfolgte zur Verfolgerin wurde. Die wahren Christen sind da zu suchen, wo die Erwachsenentaufe praktiziert wurde, wo man Verfolgung litt, und wo man die Gewalt ablehnte. So etwa lautete die fundamentale Überzeugung des Autors, und die ins Feld geführten Märtyrerbiographien dienten dazu, diese Sicht zu unterstreichen.
Der
Märtyrerspiegel hat eine weitreichende Wirkungsgeschichte im späteren Mennonitentum zu verzeichnen, denn er wurde als devotionales Werk gelesen, oft als direkte Ergänzung zur Bibellese.
Eine solche Neu-Interpretation der Geschichte erklärt, wieso eine solch starke Ablehnung gegenüber Lehren, Hierarchie, Sakramenten und Liturgie der traditionellen Kirche herrschte. Alles was man nicht im NT zu finden glaubte, wurde mit Misstrauen bedacht, in manchen Fällen total verworfen. Einfacher Gottesdienst, ohne Sakramente, ohne strukturierte Liturgie, zentriert auf die Predigt des Wortes, oft von Laien geleitet, war das Produkt dieser Entwicklung. Die Architektur der Kirchengebäude verlor alle Bedeutung, denn man versammelte sich in Privathäusern, im Wald oder in irgendeinem geeigneten Gebäude. Während der Phase der Institutionalisierung des Mennonitentums kristallisierte sich ein Kirchenregiment heraus, das weitgehend auf Laien baute und welches die Autonomie jeder Lokalgemeinde postulierte. Dies ist das typische (obwohl nicht das einzige) Modell unter Mennoniten geblieben.
Bei der Suche nach Beziehungen und Dialog will dies beachtet sein. Allgemein gesprochen gibt es keine Autoritäten die repräsentative Entscheidungen treffen können, wenn sie nicht ausdrücklich im Auftrag ihrer Lokalgemeinde handeln. Jedoch ist diese Gegebenheit nicht immer und überall gültig. Es gibt zuzeiten geistliche Führer mit Charisma, die eine breite Anerkennung finden. Es gibt Konferenzen mit einer gewissen Autorität, und bei den konservativen Gruppen besitzen die Ältesten eine beachtliche Autorität in der
Gemeinde. Trotzdem ist das grundsätzliche Modell des Kirchenregiments der Kongregationalismus.
Dies wirkt sich nachteilig aus, gerade im Bereich der ökumenischen Beziehungen, weil es keine repräsentative Hierarchie gibt. Aber die Münze hat auch eine Kehrseite: Wenn eine „Grass roots"-Bewegung da ist, wenn eine Überzeugung in den Gemeinden heranreift, dann ist keine Hierarchie da, die sie bremsen könnte.
Außer den erwähnten Schwerpunkten der Lehre, welche der Bewegung ihre Identität verliehen, akzeptierte man ohne Vorbehalte die traditionell christlichen Credos, vor allem das Apostolikum, aber auch das Nicäno-Konstantinopolitanum. Die christlich konfessionelle Basis blieb somit ohne Modifikationen, mehr oder weniger selbstverständlich übernommen.
Die Christologie von
Menno Simons und einiger seiner Mitarbeiter ist durch die Jahrhunderte wiederholt kritisch unter die Lupe genommen worden, mit dem Hinweis, dass sie eigentlich doketistisch war. Im 20. Jahrhundert haben mehrere mennonitische Theologen sich mit dem Thema befasst
(4). Da
Menno ein Theologe war, konnte er sich vorsichtig ausdrücken. Er kannte die delikaten Bereiche der Christologie, und man kann aus seinen lehrmäßigen Thesen keinen direkten Doketismus ableiten. Eher könnte man von doketistischen Tendenzen in seinen Schriften sprechen, die von seiner großen Leidenschaft herrühren, die Kirche rein und unbefleckt zu erhalten.
Wie dem auch sei, der Einfluss von Mennos Lehre war bei den späteren mennonitischen Bekenntnissen nicht der einzige Faktor. In den üblichen schriftlichen Bekenntnissen wird meist die Formel von Nicäa (weniger die von Chalcedon) geborgt, um die Natur Jesu Christi zu beschreiben.
Spätere theologische Einflüsse
Wenn wir die unterschiedlichen Gruppen und Untergruppen der Mennoniten heute beobachten, wird offensichtlich, dass es keine einheitliche und lineare Entwicklung gegeben hat. Einflüsse aus dem Bereich der großen
Kirchen und andere Umweltfaktoren hinterließen ihre Spur, aus der sich eine gegenwärtig heterogene Denomination entwickelt hat. Das 19. Jahrhundert war eine Zeit starker Einflüsse aus dem evangelikalen Bereich Europas.
Baptisten aus England oder Deutschland, Pietisten aus Süddeutschland und auch die Erweckungsbewegungen in Amerika übten einen starken Einfluss aus. Das Feindbild des Traditionalismus, während der Reformation mit solcher Leidenschaft abgelehnt, präsentierte sich nach und nach in der eigenen Mitte. Das 17. und 18. Jahrhundert war die Zeitspanne, in der die typische ländliche abgesonderte Eigenidentität geschmiedet wurde, welche viele Mennoniten schließlich als gut, ja als unerlässlich für ihren Glauben erachteten. Parallel dazu nahm allerdings das religiöse Leben starre Formen an, die mit der Zeit dann doch wieder als trockene
Tradition angesehen wurden. Im 19. Jahrhundert, angeregt durch die erwähnten evangelikalen Erweckungsbewegungen, wurden Stimmen im Mennonitentum laut, die ähnliche Erneuerung forderten. Das Phänomen der Massenevangelisationen nach dem Vorbild von Moody, Finney und anderen Amerikanern wurde populär. Zellen mit Erweckungsbestrebungen entstanden, Spannungen nahmen zu und führten in einigen Fällen zur Fragmentierung und zur
Bildung neuer mennonitischer Gemeinden. Eine der bekanntesten davon war die Mennoniten Brüdergemeinde (1860 in Russland entstanden), mit betonter Präsenz in
Paraguay heute.
Dort wo das Mennonitentum unter solchen Einfluss kam, versuchte man die steife Traditionsgebundenheit durch besondere Betonung auf die Bekehrung zu überwinden. Die „Krisenbekehrung", der „Bußkampf" waren im Pietismus psychologisch geladene Begriffe, die dann auch unter Mennoniten zum Kriterium wurden, um in ihrer eigenen Gemeinschaft zu unterscheiden zwischen den „wahren Christen" und den „Traditionellen". Die welche in Erweckungsversammlungen so zu einer neuen Bekehrung gelangt waren, konnten die „Traditionellen" kaum noch als Christen anerkennen. Es hat in der Mennonitengeschichte Perioden bitterer Spannung gegeben, zwischen
Tradition und Erweckung,
Tradition und Restitution. Aggressive missionarische Praktiken haben normalerweise ihren Ursprung in solchen Szenarien.
Es ist hier von Bedeutung, auf die Form des Diskurses zu achten wie sie sich bis in das Vokabular hinein äußert, welche bei diesen Gruppen üblich ist. Mangelndes Verständnis dafür ist der Grund für Missverständnisse, Konfrontation und oft auch Druck auf die Zuhörer, wenn wir die Situation auf dem Missionsfeld beobachten. „Sind Sie ein wirklicher Christ? – Haben Sie eine Bekehrung erlebt? – Haben Sie eine persönliche Begegnung mit dem Herrn gehabt? – Sind Sie sicher, ein Kind Gottes zu sein"? usw. In Gemeinschaften, wo man das Christ-werden mehr als graduellen erzieherischen Prozess ansieht, einen Prozess des Hineinwachsens, des Reifens, stiftet ein solcher Diskurs meist Verwirrung. Ebendies passiert selbst innerhalb der mennonitischen Gemeinschaft. Die mehr traditionellen Gruppen haben ihre eigene Form einer graduellen Einführung ihrer Kinder und Jugendlichen ins Christentum. Es beginnt nicht mit der
Taufe, wohl aber mit der Erziehung im Heim, gefolgt von ausgedehntem katechetischem Unterricht, und erst danach folgt die
Taufe. Es ist eben diese institutionalisierte Form des Prozesses, der von den Erneuerungsgruppen als fehlendes geistliches Leben interpretiert wird, und es passiert nicht selten, dass eine Gruppe von Mennoniten zum Missionsobjekt einer anderen Gruppe erklärt wird. Die Gründe dafür wurzeln, theologisch gesehen, in der erwähnten Dialektik.
Die aufrichtige Motivation bei solchen „Bekehrungsversuchen" will konstatiert und respektiert sein. Die Missionare, oft Jugendliche, die an solchen kurzfristigen missionarischen Kampagnen teilnehmen, haben das aufrichtige Bedürfnis, ihr Bekehrungserlebnis, ihren neu gewonnenen Glauben mit anderen Menschen zu teilen. Es besteht kein Zweifel, dass solche begeisterten Aktivitäten zur Reifung des eigenen Glaubens beitragen. Für die Zielgruppen solcher Aktivitäten ist eine gesunde Identität als Christen ausschlaggebend. Proselytistische Aktionen könnten zu Aktionen der Begegnung und des Dialogs werden, vorausgesetzt, die Menschen würden in ihrem christlichen Selbstbewusstsein nicht schwanken.
Ein Verständnis für das dabei verwendete Vokabular wäre natürlich höchst wünschenswert. Eine Haltung zu kultivieren, die freundlich aber entschieden die Erklärung von Begriffen verlangt, ist in diesem Kontext sehr hilfreich. Sie stimuliert die Reflexion, der missionarische Eifer wird gebremst, und im günstigen Fall können beide, Missionare und Missionierte, durch solche Begegnung wachsen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Same für nachträgliche Spaltungen schon als ein Erbgut der radikalen Reformation mitgegeben war. Grund dafür war das Misstrauen gegenüber der
Tradition und die Zuversicht dass man zu den als authentisch empfundenen Quellen zurückkehren könne. Im 19. Jahrhundert nahmen solche Erneuerungsbemühungen nicht nur die apostolische Zeit, sondern auch das 16. Jahrhundert als Kriterium, als Referenz für den idealen Zustand, den zu restaurieren die Aufgabe lautete. Das angestrebte Ideal wiederherzustellen war die Triebfeder hinter solchen Bemühungen. Mein Geschichtsprofessor
(5) bemerkte wiederholt, dass die aus der radikalen Reformation hervorgehenden Gruppen Schwierigkeiten hatten, die Tatsache zu akzeptieren, dass für die Äste der Weg zu den Wurzeln durch den Stamm geht. Sich davon zu trennen ist letztlich nicht die Lösung, denn der Kreis schließt sich immer wieder, indem solche Gruppen wiederum ihre Institutionen und ihre
Tradition entwickeln, die dann bald wieder als erstarrt und geistlich verarmt empfunden wird – ja vielleicht noch ärmer wird, weil dieser
Tradition von vornherein kein theologischer Wert beigemessen wird. Darauf erfolgt Misstrauen, Unzufriedenheit und erneuter Bruch mit der eigenen
Tradition. Dies einzusehen wäre für mennonitische Gemeinden eine heilsame Lektion die man sich stellenweise bereits angeeignet hat. Im katholischen Lager wird die kritische Auseinandersetzung mit der Lehrtradition auch weiterhin Aufgabe der Theologen sein. Diese im Dialog mit protestantischen
Kirchen zu realisieren, würde mehr Licht auf die Rolle der
Tradition in der christlichen Theologie werfen. Die Perspektive „
Tradition versus Restitution" erscheint mir jedenfalls ein Annäherungspunkt zu sein, über welchen man Anschauungen vergleichen und zu einem Dialog kommen kann. Die Rolle der
Tradition, das ihr innewohnende Potential zur Erneuerung, wird heute zum aktuellen theologischen Thema. Das zu debattieren ist heute unsere Aufgabe. Das positive Potential der Restitutionsbestrebungen mit ihrem starken Anliegen, die Kirche rein und treu zu erhalten, darf dabei nicht übersehen werden.
Kurz gesagt, während der letzten 150 Jahre haben zusätzlich zu strukturierenden Prozessen von innen, verschiedene evangelikale Einflüsse von außen auf das Mennonitentum eingewirkt, so dass die eigene historische Identität stellenweise geschwächt wurde. Die unschlüssige Haltung vieler Gemeinden auf dem Missionsfeld (ob unter Indianern oder nationaler Bevölkerung), wie sie sich nennen wollen, mag von mangelnder konfessioneller Identität der Missionare herrühren. „Wir sind evangelische Christen", ist eine sehr übliche Äußerung. „Evangelische Kirche so und so", oder auch Konferenzen, die sich mit diesem Etikett kennzeichnen, ist das übliche bei uns. In den USA ziehen viele Gemeinden es vor, sich einfach als „
Bibel-Kirche" oder „Kirche Gottes" zu bezeichnen, – alles Hinweise auf eine geschwächte historisch-konfessionelle Identität, die Gefahr läuft, den eklektischen und oft inkohärenten Charakter verschiedener lehrmäßiger Strömungen, Ideologien und Werte zu ignorieren, die heutzutage ihre Zuflucht unter dem breiten Schirm des „Evangelischen" gefunden haben.
Mennoniten weltweit und ökumenische Perspektiven
Die polarisierte und paralysierte Beziehung zwischen Mennoniten und Katholiken bestand praktisch unverändert, bis zur Zeit des II. Vatikanischen Konzils (1963-65). Es war in Kanada und in den USA, wo sich zuerst eine entspanntere Atmosphäre bemerkbar machte, gefolgt von gradueller Annäherung und gegenseitiger Neugier. Die liturgische Erneuerung spielt dabei eine wesentliche Rolle. Die öde Landschaft der eigenen Gottesdienste war ein Thema für manche Mennonitengemeinden. Die erwähnte Bewegung führte zu Kontakten mit katholischen Christen in ihrer Nachbarschaft. Gemischte Hauskreise bildeten sich, man organisierte gemeinsame geistliche Rüstzeiten, und mir sind Fälle bekannt, in denen Mennonitengemeinden mit liturgischer und selbst sakramentaler Neustrukturierung ihrer Gottesdienste tiefgreifende Erfahrungen machten. In Kansas verrichteten meine
Frau und ich einen Sommer lang pastorale Arbeit in einer mennonitischen Kirche, die, ihrem Aussehen nach, der Stolz irgendeiner Pfarrei gewesen wäre. Nur die Jungfrau und die Heiligen fehlten, sonst war alles da, selbst der Altar, die Kerzen und die biblischen Szenen in den farbenfrohen Fenstern.
Ein weiterer Kontaktbereich war die Zivilbewegung und das Friedenszeugnis während der Vietnamperiode. Mennoniten und Katholiken in den USA, beides Minderheiten, stemmten sich gegen die kulturell dominante Denkrichtung und entdeckten dabei eine gute Dosis Gemeinsamkeiten in ihren Ideen und Zielen. Zusammenarbeit in der Förderung ziviler Rechte und karitativer Projekte ermöglichte einen weiteren Schritt der Annäherung. In einem kürzlich erschienenen Aufsatz stützt der Autor
(6) die Forderung nach Pluralismus auf die täuferische Betonung der Gewissensfreiheit und die Ablehnung jeglicher Gewaltmittel – was eine friedliche Koexistenz mit anderen religiösen Überzeugungen voraussetzt.
Bei der Vollversammlung der MWK in Kalkutta, Januar 1997, wurden offizielle Beziehungen zwischen dem Vatikan und den mennonitischen
Kirchen hergestellt. Gegenwärtig wird in einem Zyklus von fünf jährlich stattfindenden Dialogrunden diese Beziehung vertieft
(7).
Ökumene auf lokaler Ebene
Die Frage stellt sich: Wieso bahnen sich anderswo harmonische Beziehungen an, während in unserem Land noch nichts dergleichen zu verzeichnen ist? Dazu lässt sich keine einfache Antwort geben, und es bleibt die Aufgabe beider Seiten, vielleicht nicht so sehr die Antwort selbst, sondern Annäherungspunkte zu suchen. Dabei bleibt (wie schon erwähnt) zu beachten, dass die Entscheidungsstrukturen kongregational sind, auch die MWK kann letztlich keine bindenden Entscheidungen für spezifische Gemeinden und Konferenzen treffen. Sie kann nur Empfehlungen weiterleiten. Aber wie schon erwähnt wurde, beherbergen kongregationale Strukturen auch ihren Teil Hoffnung, denn wo eine Idee heranreift, sind bald die Bedingungen für Veränderung geschaffen, obwohl solche Schritte in nächster Zukunft vielleicht nicht spektakulär sein werden.
Tatsache ist, dass momentan die Vision und der Wille zur Suche nach harmonischen Beziehungen zu anderen
Kirchen weitgehend fehlen. Die Denkweise der älteren Generation ist noch weitgehend vom Antagonismus der präkonziliaren Periode bestimmt. Man sucht Konfrontation statt Dialog. Man nützt die Konfrontation zu proselytistischen Zwecken. Man hebt doktrinelle Unterschiede hervor, um den „Opponenten" möglichst mit Argumenten zu überzeugen.
Auf katholischer Seite wurde bis vor Kurzem die Notwendigkeit ökumenischer Beziehungen zu evangelischen Gemeinden auch kaum registriert. Für beide Seiten ist es von daher gesehen eine Pioniersituation. Wir sind gegenwärtig Zeugen der ersten bescheidenen Schritte und versuchen neues Terrain zu kartographieren. Proselytistische Haltungen sind dabei ein offensichtliches Hindernis. Wo soll man beginnen? Es mag sein, dass sich Resignation bemerkbar
macht, wenn man sich auf fehlenden Willen, Bedingungen und Strukturen fixiert. Aber ich meine, dass es auch die abenteuerliche Erfahrung des ökumenischen Unternehmens ist, zu sehen, wie sich Wege öffnen, wo bisher kein Weg sichtbar war. Wo erst einmal die Bereitschaft da ist, finden sich Annäherungspunkte, die man vorher nicht vermutet hätte. Solche Erfahrungen sind dann wie die Blumen am Wegrand, welche die Gegenwart des Heiligen Geistes in dieser Sache andeuten.
Einige theologische und praktische Winke möchte ich weitergeben, die mir realistisch zu sein scheinen.
1. Es ist ein Mandat des Evangeliums, die harmonischen, geschwisterlichen Beziehungen zwischen den
Kirchen zu suchen. Daher ist es keine Option. Es ist eine Aufgabe, die nicht dem Geschmack und Gutdünken einzelner Personen oder Gemeinden überlassen werden kann.
2. Selbst da, wo es ein unilaterales Bemühen ist, bleibt es die Aufgabe, diese Beziehung zu suchen. Der Heilige Geist führt uns hier auf Durststrecken, es kann eine einsame und undankbare Arbeit sein – es bleibt dennoch Aufgabe.
3. Die volle eucharistische Kommunion ist das schlussendliche Ziel dieser Suche. Bevor man das erreicht, gibt es jedoch eine erstaunliche Vielfalt von Erfahrungen und Aktivitäten, die man mit anderen teilen kann, die man gemeinsam ausleben kann. Dies ist Terrain, welches erforscht werden will.
4. Wir sollten danach trachten, das alte Dekret „Cujus regio, ejus religio
(8)" zu überwinden. Wir leben im Zeitalter der Globalisierung. Die Kirche ist weltweit präsent. Die alte territoriale Denkweise (die immer schon theologisch wacklig war) ist überholt. Es ist Zeit zu kooperieren; es kann nicht ein jeder seinen „claim" abstecken, um ihn dann zu verteidigen.
5. In einer Atmosphäre von Proselytismus müsste die pastorale Arbeit nicht abrupt aufhören, wenn Personen sich „bekehren" und in eine andere Kirche hinüberwechseln. Erlauben Sie mir, ein paar günstige Haltungen anzudeuten, die man fördern könnte. Dies dient nicht dazu, den „modus procedendi" irgendeiner Gruppe zu rechtfertigen oder vorzuziehen, sondern lediglich um Grenzen, Barrieren flüssiger zu machen, damit sie ihren Absolutheitscharakter verlieren und eine ökumenische Brise wehen kann.
a) Aus erster Hand die Kirche kennenlernen, in die z.B. ein Mitglied der
Familie übergetreten ist.
b) Der
Familie dieser Person Beistand leisten, Toleranz wecken, Vorurteilen und Feindschaft vorbeugen.
c) Wo man es wünscht, eine gewisse pastorale Begleitung erwägen. Wo Zweifel herrschen bezüglich des vom Kirchenrecht her Zulässigen, kann das in Arbeitsgruppen erforscht werden. Solches wird besonders notwendig, wenn es sich um eine Kirche handelt, die schon im offiziellen Dialog mit Rom steht.
d) Bei der Ausbildung von Katechisten von vornherein eine ökumenische Orientierung einplanen. Konstruktive Formen des Dialogs sollten erarbeitet werden und fruchtlose Polemik, sowie Angst vor Kontakten sollte überwunden werden.
e) Gemischte Kreise für Studium und Diskussion bilden, in denen man z.B. Enzykliken wie „Unitatis Redintegratio" „Ut Unum Sint" und das Direktorium für Prinzipien und Normen über
Ökumene(9) oder ähnliche Dokumente durcharbeiten würde. Es liegt großer theologischer Reichtum in diesen Dokumenten. Zu begrüßen wäre es, wenn sich Bischöfe und Priester darum bemühen würden, dieses Wissen unter das Volk zu bringen. Solche Initiative gilt natürlich für beide Seiten des Dialogs.
f) Bei der Jugend vor allem sollte man, für Gelegenheiten sorgen, in denen gemeinsame Projekte durchgeführt werden. Das kann
Nachbarschaftshilfe sein, Katastrophenhilfe, Einsätze in Altenheimen, Gefängnissen oder Kinderheimen. Solche Einsätze eignen sich besonders gut für Gemeinsamkeit.
g) Das gegenwärtige Jubeljahr ruft besonders dazu auf, Gebetszellen zu bilden, wo man Gott darum bittet, Hunger und Durst nach Einigkeit in seiner Kirche zu wecken. Nach einem Jahrtausend beschämender Trennungen in der Kirche ist dies ein dringliches Anliegen.
Literaturverzeichnis
– Bender Harold J. ed.: The Mennonite Encyclopedia (4 vols.), The Mennonite Publ. House, Scottdale, PA, 1982.
–
CEMTA, Hrsg.:
Menno Simons. Ein Symposium zu seinem 500. Geburtstag, San Lorenzo, 1996.
– Dyck Cornelius J.: An Introduction to Mennonite History, Herald Press, Scottdale PA, 1981.
– Dyck Cornelius J.: Spiritual Life in Anabaptism, Herald Press, Scottdale PA, 1995.
– Goertz Hans J.: Umstrittenes Täufertum, Vandenhoeck & Ruprecht, 1975.
– Klaassen Walter: Anabaptism: Neither Catholic nor Protestant, Conrad Press, Waterloo, 1981.
– Klaassen Walter: Selecciones Teológicas Anabautistas, Herald Press, Scottdale PA, 1981.
– Kraus Norman C.: Jesus Christ, our Lord, Herald Press, Scottdale PA, 1987.
– Löwen John H.: Mennonite Confessions of Faith, Institute of Mennonite Studies, Elkhart IN, 1985.
– Yoder John H.: Textos Escogidos de la Reforma Radical, Ed. La Aurora, Bs. As. 1976.
Fussnoten:
| Die Frage nach der Beziehung zwischen den christlichen Kirchen ist in Paraguay eine relativ neue Frage. Die isolierte Lage, das weite Feld, jahrzehntelange Missionsarbeit im „eigenen Bereich" ließen diese Fragen bisher nicht akut werden. Wo sich dennoch Problembereiche – Proselytismus, gefolgt von Spaltungen in den Gemeinschaften z. B. – bemerkbar machten, wo Fragen auftauchten, versuchte man durch Beteuerung des eigenen guten Willens, durch Hinweise auf wirtschaftlichen Erfolg oder auch schlicht, indem man das Problem ignorierte, damit fertig zu werden. Eine gewisse Verständigung zwischen den Kirchen, gegenseitige Anerkennung und Kooperation anzustreben, ist nicht nur politische, sondern auch theologische Notwendigkeit. Im Chaco Paraguays realisieren Mennoniten und Katholiken eine parallel laufende Missionsarbeit. Dazu kommt, dass diese beiden Kirchen besondere Verständigungsschwierigkeiten haben, weil sie seit dem Bruch im 16. Jahrhundert kaum miteinander gesprochen haben. Auch bei gutem Willen ist es daher nicht gesagt, dass man sich gegenseitig versteht und anerkennen kann. Eine gezielte Annäherung ist Voraussetzung, wenn dies erreicht werden soll. Von den Oblatenmissionaren im Chaco kam in den letzten 15 Jahren wiederholt der Wunsch, die Mennoniten besser zu verstehen in der Hoffnung, dass ein ähnlicher Wunsch auch bei Mennoniten Echo finden würde. Bei der jährlichen Rüstzeit aller Mitarbeiter des Apostolischen Vikariates des Pilcomayo im Januar dieses Jahres wurde ein Tag reserviert, um besonders über ökumenische Verständigung nachzudenken. Dabei ging es vor allem darum, die Mennoniten als Freikirche zu verstehen, die Problembereiche in der Verständigung zu identifizieren, missionarische Konzepte zu vergleichen und Wege für ein harmonisches Miteinander zu erkunden. Folgender Aufsatz ist einer von zwei Vorträgen, die von mennonitischer Seite bei dieser Gelegenheit gebracht wurden, und deren Themen dann weiter in Arbeitsgruppen diskutiert wurden. |
| Enns, Fernando in: Mennonitisches Jahrbuch 2000, S. 41 |
| Statistiken zu Mennoniten weltweit finden sich unter www.mwc-cmm.org |
| E. g. Kraus, Norman C.: Jesus Christ our Lord, Herald Press, Scottdale PA, 1987 |
| Martin,Dennis 1984 – 1990 Professor für Kirchengeschichte am AMBS, Elkhart. |
| Enns, Fernando in: Mennonitisches Jahrbuch 2000, S. 41ff. |
| Bei der Vollversammlung des Exekutivkomitees der MWK in Guatemala, Juli 2000, wurde eine Zwischenbilanz dieser Bemühungen erstellt. |
| Konkordat zwischen Lutheranern und Katholiken, vom 25. Sept. 1555 in Augsburg. |
| Diese und andere Dokumente sind unter www.vatican.va abrufbar. |
Jacob Harder
Einleitung
"Die Mennoniten im
Chaco haben sich offensichtlich für den Fortschritt entschieden", bemerkte vor einigen Jahren ein aus Deutschland entsandter
GTZ(2)-Experte, als er nach dem Sinn und Zweck seines Einsatzes im
Chaco gefragt wurde. Damit wurde wohl hauptsächlich die Akzeptanz des wirtschaftlichen und technologischen Fortschritts angesprochen. Offen blieb die Frage des sozialen Wandels im Allgemeinen. Dass sich aber auch in der Lebensweise der
Mennonitenkolonien ein relativ rascher Wandel vollzieht, das fällt jedem auf, der die Entwicklung aufmerksam verfolgt.
Sozialer Wandel in der Mennonitengesellschaft im
Chaco, das soll der Gegenstand meiner Ausführungen sein. Was hat sich verändert und warum? Das ist die Kernfrage dieser Darstellung. Ein bisschen Theorie des sozialen Wandels muss dabei auch bedacht werden, um das Thema besser zu verstehen. Es erscheint mir jedoch wichtig, dass wir zunächst ein paar grundlegende Feststellungen machen:
- Die Gesellschaft des Siedlungsmennonitentums wird generell von der sie umgebenden größeren nationalen Gesellschaft, egal ob in der Ukraine, in Kanada oder in Paraguay als eine religiös traditionelle, geschlossene Gemeinschaft gesehen, die dem sozialen Wandel vor allem im Bereich der Werte und Normen skeptisch und ablehnend begegnet.
- Sozialer Wandel im Siedlungsmennonitentum ist sehr häufig das Interesse der sie umgebenden Gesellschaften gewesen. Die Mennonitenkolonien zu öffnen, zu entwickeln, sie zu integrieren war immer das Anliegen derer, die von den Mennoniten als `die Welt’, als die anderen betrachtet wurden.
- Die Spannung zwischen Eigenständigkeit und Andersartigkeit einerseits und der von außen kommende Integrationsdruck, verbunden mit der notwendigen Anpassung andererseits hat bei uns zwei gegensätzliche Haltungen hervorgebracht: Das Gefühl der Minderwertigkeit und das der Überlegenheit. Beide verleiten zu unangepassten und übersteigerten Reaktionen. Früher war es vielleicht stärker das Erste, heute wohl eher das Zweite. Bestimmende Elemente bleiben sie beide wahrscheinlich so lange, bis der Auflösungsprozess des Phänomens ,Mennonitenkolonie` mehr oder weniger abgeschlossen ist. Die beiden genannten verinnerlichten und kollektiven Komplexe äußern sich in Ethnozentrismus, in Überheblichkeit, nach außen gerichteten Verteidigungsmechanismen, fehlender Offenheit auch untereinander, häufiger Verneinung und Geringschätzung der eigenen Kultur oder Lebensweise und in individueller und kollektiver Verkrampfung.
- Die Gesellschaft der Mennonitenkolonien befindet sich in einer Phase des Umbruchs. Das südrussische Modell einer mennonitischen Siedlungsgemeinschaft, das von den Mennoniten gestaltet und von der russischen Regierung gesetzlich verankert wurde, fand dort im 19. Jahrhundert seine besondere Ausprägung und Konsolidierung.(3) So stark, dass auch die fast vier Generationen lange Erfahrung der "Farming community" und des "Home-steading"-Gesetzes im Fall der Siedler der Kolonie Menno und die Entkulakisierung und die Kollektivierung von Seiten der Sowjets bei den heutigen Bewohnern der Kolonie Neuland diese Vorstellung nicht auslöschen konnte. Hier in Paraguay kam das südrussische Siedlungsmodell noch einmal voll zum Zuge. Im Moment, besonders in den letzten 10 – 20 Jahren, gibt es aber Anzeichen für wesentliche Veränderungen.
Zur Theorie des sozialen Wandels
Es geht mir bei diesem Punkt nicht um eine detaillierte Darstellung und Unterscheidung der verschiedenen Theorien oder Erklärungsmodelle
(4) für sozialen Wandel. Diese sollen hier aber doch kurz angesprochen werden um klarzustellen, womit wir uns in dieser Arbeit beschäftigen.
Als erstes Erklärungsmodell wäre die im Zuge des Positivismus des 19. Jahrhunderts entstandene Entwicklungstheorie zu nennen, die sich an die Evolutionstheorie anlehnte. Nach diesem Modell wird sozialer Wandel so erklärt, dass alle Gesellschaften notwendigerweise gewisse Phasen oder Etappen durchlaufen bis hin zum heutigen modernen Stand der
Kultur. Diese Erklärungsweise wurde von der Zyklus-Theorie abgelöst, die zwar die Etappen der Entwicklung beibehält, aber einräumt dass diese sich wiederholen können.
Beide Theorien sind zwar größtenteils überholt, scheinen aber auch Sinn zu machen, wenn wir bedenken, dass nach der Aufklärung auch wieder das Irrationale überwiegen kann, nach demokratischen Ansätzen wieder die Diktatur herrscht usw.
Ein weiteres Modell, die Gleichgewichtstheorie, geht davon aus, dass Gesellschaft und
Kultur aus einer Vielzahl von Einzelsegmenten besteht, unter denen ein Gleichgewicht besteht. Immer dann, wenn in einem Teil, meinetwegen in der Gewerbestruktur oder in der
Familie, eine Veränderung eintritt, führt diese zu einem Ungleichgewicht im ganzen System, und die Folge ist ein Wandel in anderen Bereichen, bis wieder Gleichgewicht herrscht. Auch diese Theorie scheint zunächst logisch zu sein, es ist aber eine allzu mechanistische Erklärung. Menschen sind dynamische Wesen in jeder Hinsicht. Davon geht eine weitere, nämlich die Konflikttheorie aus. Menschen und Gruppen haben Interessen, sie konkurrieren miteinander. Das führt zu Konflikten, bei denen jeder seine Interessen verteidigt. Das wiederum führt zu neuen Formen der
Kultur, Erfindungen, Technologien, Werten usw. Die daraus resultierende Instabilität ist eine starke Triebfeder für ständigen sozialen Wandel.
Vielleicht ist das letzte Erklärungsmodell das beste, aber in den Sozialwissenschaften erklärt man den sozialen Wandel heute eher durch eine Reihe von Einzelerkenntnissen, die auch wissenschaftlich verifizierbar sind. Einige sollen hier kurz genannt werden:
- Sozialer Wandel kann entweder durch innere oder durch äußere Einflüsse in einer Gesellschaft initiiert werden. Ein Großteil der internen Ursachen(5) kommt aus dem Bereich der technischen Erfindungen und aus ideologischen oder religiösen Neuschöpfungen. Eine wichtige Rolle spielt auch die Tatsache, dass die Individuen sich nicht nur der Kultur anpassen, sondern auch von den Normen abweichen. Der Wille zur Abweichung wird häufig in Literatur, Malerei, Musik und Architektur zum Ausdruck gebracht. Innerhalb der Gesellschaft sind es weiter bestimmte Individuen (z.B. M. Luther, A. Einstein oder M. Jackson) oder Gruppen, von denen Impulse ausgehen, die neu und Richtung weisend sind. Natürlich kann sozialer Wandel auch durch eine Veränderung in der natürlichen Umwelt (Steppe in Russland und Kanada, Trockenwald im Chaco) oder durch eine Veränderung in der Bevölkerungszahl (Zuwachs, Struktur) entstehen. Die externen Ursachen sind Impulse, die aus einer anderen, z.B. benachbarten Kultur kommen. Dieser wechselseitige Befruchtungsprozess wird auch Diffusion genannt. Wir Mennoniten sind diesem Prozess trotz Isolierungstendenzen immer stark ausgesetzt gewesen, zum Teil auch deshalb, weil die Kreativität vor allem im Bereich der Ideen, Werte und Normen innerhalb der Gemeinschaft gebremst wurde.
- Sozialer Wandel kann entweder strukturell oder funktional(6) sein. Funktionaler Wandel bezieht sich auf das, was die Menschen in ihrer Lebensweise verändern, struktureller Wandel beinhaltet Veränderungen in der Struktur, der Zusammensetzung, z.B. Familiengröße, soziale Klassen usw.
- Es gibt bestimmte Bedingungen(7), unter denen der soziale Wandel leichter stattfinden kann. Die Bereitschaft, Veränderungen zu akzeptieren, ist immer dann gegeben wenn neue Bedürfnisse auftreten oder wenn eine neue Technologie die bessere Befriedigung der Bedürfnisse mit sich bringt. Sozialer Wandel vollzieht sich relativ leicht,
– wenn neue Einstellungen vorherrschen, z.B. mehr Offenheit,
– wenn mehr Informationen und Kenntnisse vorhanden sind,
– wenn die Innovation mit den Werten der Gesellschaft im Einklang steht,
– wenn die Sozialstruktur schon so differenziert und komplex ist, dass eine zusätzliche Veränderung nicht auffällt,
– wenn die Veränderung als nützlich und brauchbar gesehen wird,
– wenn demonstriert werden kann, wie notwendig die Veränderung ist,
– wenn die `richtigen’ Personen (Meinungsmacher) sich dafür einsetzen. - Die Soziologen sind sich auch darin einig, dass sozialer Wandel nur als multikausal(8) zu verstehen ist. Für jede Veränderung gibt es mehrere Ursachen und eine Reihe von Bedingungen muss stimmen, wenn die Veränderung angenommen werden soll. Wir brauchen nur an die zunehmende mennonitische Partizipation in der nationalen Politik zu denken, um das zu verstehen. Ich komme später auf dieses Thema zurück.
- Im Prozess der Entwicklung und des Wandels(9) gibt es immer pro und contra, stabilisierende oder konservative und progressive Kräfte. Die einen wollen den Status quo, das Bekannte, Vertraute, die anderen den Fortschritt, das Neue.
- Wirtschaft und Technologie gehören zu den stärksten Faktoren des sozialen Wandels. Die Technik ist der größte Veränderer, den wir auf dieser Welt haben. Das erklärt auch die Angst mancher Mennonitensiedlungen vor technologischem Fortschritt.
- Sozialwissenschaftler sprechen von den Artefakten, den geschaffenen Dingen den mentalen Vorstellungen und Konzepten und den Formen des Zusammenlebens. Es ist relativ leicht, eine Veränderung in der materiellen Kultur herbeizuführen, es ist aber weit schwieriger, die andere Bereiche zu beeinflussen. Ein Sommerfelder Mennonit z.B. mag über Internet (Artefakten) an der New Yorker Börse die Preise für Weizen und Soja in Erfahrung bringen, erlaubt aber nicht die geringste Veränderung im Bereich der schulischen Erziehung.
Nach diesem kurzen theoretischen Überblick wollen wir uns unserem eigentlichen Anliegen zuwenden.
Sozialer Wandel in den Mennonitenkolonien
Welche Veränderungen hat es in Gesellschaft und
Kultur der
Mennonitenkolonien in den letzten Jahrzehnten gegeben? Die Vergleiche, die ich jetzt machen möchte, beziehen sich mindestens auf die letzten 50 Jahre und treffen nicht auf jede
Kolonie in gleicher Weise zu. Ich möchte diese Veränderungen hier jetzt in 10 thesenartigen Feststellungen zusammenfassen und sie kurz erläutern.
- Die Mennonitenkolonien haben sich von einer Pioniersiedlung in eine Wohlstandsinsel verwandelt. Armut, Rückständigkeit, relative Subsistenzwirtschaft und wirtschaftlicher Überlebenskampf sind durch rationale Produktionsmethoden, Mechanisierung, Technologie, Weltmarktorientierung und Konsum abgelöst worden. Parallel zu diesem Wandel gibt es bestimmte Haltungen, Einstellungen, eine besondere Mentalität und ein verändertes Selbstverständnis. Bis in die siebziger Jahre hielten wir uns als Mennoniten im nationalen und im internationalen Vergleich und im Vergleich mit unseren Herkunftsländern für arm und rückständig. Ich erinnere mich bis heute an meine kognitiven Dissonanzen, als ich zum erstenmal den Ausdruck "pobre paraguayo" hörte. Für uns waren früher die Paraguayer reich, die Mennoniten arm. Die – wenn auch relative Wohlstandsinsel hat inzwischen eine ganz andere Vorstellung von sich selbst und von den anderen geprägt. Man hält sich heute für stark und fortschrittlich, unsere Dominanz führt uns zu einem guten, verleitet uns aber auch zu einem übersteigerten Selbstbewusstsein, der Ethnozentrismus blüht. Die Armut der uns umgebenden Ethnien und das Scheitern einiger Abenteurer aus Europa bestätigen uns jeden Tag, dass unser "way of life" der Beste ist. Was wollen die andern hier schon sagen? Das ist das neue Lebensgefühl einer Generation, die nicht weiß, wie mühsam das alles von ihren Eltern erwirtschaftet wurde, die auch nicht begreift, wie gut uns ein bissschen mehr Bescheidenheit und Mitmenschlichkeit täte.
- Die Gewerbestruktur hat sich aufgrund der lokalen und nationalen Marktbedürfnissee stark verändert. Die wirtschaftlichen Tätigkeiten beschränkten sich früher fast ausschließlich auf die Primärproduktion, haben sich aber inzwischen stark auf den sekundären Sektor, die Verarbeitung und besonders auf den Tertiär- oder Dienstleistungssektor verlagert. Mehr als 90% der mennonitischen Familien in den ersten Jahrzehnten der Siedlung erwirtschafteten ihr Haupteinkommen aus der Arbeit auf dem Lande und waren dort direkt beschäftigt. Dieser Prozentsatz dürfte heute schätzungsweise bei 30% liegen. Es gibt leider keine statistischen Erhebungen darüber. Das bedeutet nicht, dass die Agrarproduktion in absoluten Zahlen zurückgeht, ganz im Gegenteil. Maschinen, Technologie und "Fremdarbeiter" sorgen hier für Produktion. Das bedeutet aber, dass der größere Anteil der Beschäftigten bei den Mennoniten nicht mehr die gleiche Bindung an Grund und Boden hat, sondern in eine immer differenzierter werdende Berufsstruktur eingesetzt ist. Gesellschaftlich entstehen daraus nicht nur neue Arbeitsabläufe, sondern auch neue Auffassungen, Werte, Ansprüche usw.
- Eine wesentliche Veränderung der mennonitischen Lebensweise liegt in der zunehmenden Auflösung der Dorfkultur. Das Dorf war Ideal und Maßstab für Denken und Handeln. Heute ändert sich dieses Muster zugunsten der Bezirke, der größeren Koloniegemeinschaft und der zentralen Orte. Das Dorf war die Achse des öffentlichen Geschehens. Das einzelne Dorf hatte mehr politisches Gewicht, jedes Dorf hatte seine Schule, viele hatten einen Dorfschor, einen Mädchenverein. Die Jugend traf sich fast nur im Dorf, man suchte seinen Ehepartner im Dorf, Hochzeiten wurden auf dem Hof der Brauteltern im Dorf gefeiert. Im dörflichen Schulgebäude fanden die Gottesdienste statt. Die Dorfs- und Koloniepolitik wurde auf dem "Schultebott" in der Dorfschule gemacht. Heute haben die Bezirke, besonders in Menno, schulisch, kirchlich und politisch an Bedeutung gewonnen. Immer stärkeres Gewicht bekommen die zentralen Orte. Viele lehnen diese Entwicklung ab, aber alle tragen ständig dazu bei, dass diese Tendenz verstärkt wird.
- Das Wachstum der Koloniezentren und ihre Bedeutung für den ganzen Chaco hat eine gewisse Tendenz zur Urbanisierung des Lebens eingeleitet. Das war wohl kaum die Absicht unserer mennonitisch-bäuerlichen Siedlungsgemeinschaft, sondern eher das Ergebnis einer Notwendigkeit. Wo sonst der Staat mit seinen öffentlichen Einrichtungen die bürgerlichen Angelegenheiten regelte, mussten die Kolonien diese selber gestalten. Das gilt nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Post, für Straßen, öffentliche Ordnung usw. Zwar haben unsere städtischen Zentren auch noch einiges an Dorfscharakter beibehalten, aber laut Feststellung des letzten "Censo Nacional" wurde die Bevölkerung der Kolonie Fernheim zu 70% und die der Kolonien Menno und Neuland zu etwas über 40% als "población urbana" bezeichnet. Das heutige Erscheinungsbild unserer kleinen Städte mit ihrer Versorgungsfunktion, mit ihren administrativen, wirtschaftlichen und sozialen Funktionen lässt vermuten, dass die Stadtfunktionen zunehmen werden und dass die heute noch überwiegend agrarische Struktur der Kolonie langsam an Bedeutung verliert. Die Bemühungen der Kolonien um eine bessere Einbindung in das nationale und internationale Verkehrssystem und die Suche nach neuen Märkten bestärken diese Annahme.
- Die Wirtschaftsdynamik der letzten Jahrzehnte hat wie ein Magnet Menschen verschiedener Ethnien und Sprachen in den zentralen Chaco kommen lassen. Die demographischen Veränderungen lassen nicht nur ein anderes Bevölkerungsbild entstehen. Sie werden auch zu einer der größten sozialen Herausforderungen für alle Beteiligten. In den Ansiedlungsjahren gab es in dieser Zone nur Lenguas und Mennoniten. Um 1975 lebten hier Indianer fast aller Stämme, die es im Chaco gibt. Sie kamen und sie wurden geholt, hauptsächlich als Saisonarbeiter. Lateinparaguayer waren noch eine Seltenheit. Am stärksten ist die ethnische Vielfalt in Filadelfia ausgeprägt. Hier leben heute etwa 2.600 Mennoniten, 2.500 Indianer, 1000 Lateinparaguayer, 400 Deutschbrasilianer, insgesamt etwa 6.500 Einwohner. Radio Z.P. 30 sendet in 9 Sprachen, und in der Departamentsschule der Gobernación gibt es Schüler aus 10 verschiedenen Ethnien. Man kann davon ausgehen, dass die Bevölkerungssituation Filadelfias ein Anfang von dem ist, was für den ganzen zentralen Chaco bald typisch sein wird. Bisher wurden die Beziehungen zu diesen Gruppen hauptsächlich über mennonitische Vorstellungen von Mission und durch ein relativ gutes Arbeitsverhältnis geregelt. In Zukunft werden Begriffe wie Gleichberechtigung, soziale Gerechtigkeit, Toleranz und demokratische Rechtsordnung eine immer größere Rolle spielen.
- Eine wichtige Veränderung der letzten 10 Jahre ist die wachsende politische Partizipation der Mennoniten an der nationalen Politik. Im sogenannten, "mennonitischen Reich"(10) haben wir politische Tätigkeiten über Generationen eingeübt. Neu ist allerdings die Teilnahme an der Politik auf nationaler Ebene zusammen mit den anderen. Politik ist die Gestaltung des öffentlichen Lebens. Wenn diese Definition stimmt, dann waren wir als Mennoniten schon immer sehr politisch, erst nur durch die Glaubensgemeinde, dann später stärker durch die Verwaltung der Kolonien. In unseren politischen Einstellungen schwanken wir ständig zwischen autoritären und demokratischen Vorstellungen. In der großen Landespolitik sollte nach unserer Auffassung strenger und autoritärer regiert werden. Innerhalb der mennonitischen Siedlung befürworten wir aber das Mitspracherecht aller Bürger. Aber auch hier schwanken wir hin und her zwischen der direkten Demokratie und einer Scheindemokratie. Insofern könnte die neu begonnene politische Öffnung und Teilnahme an den nationalen politischen Institutionen für uns ein wichtiges Lernfeld werden.
- Erholung und Freizeitgestaltung haben sich in zweifacher Weise gewandelt. Erstens ist die Haltung gegenüber Freizeitaktivitäten grundsätzlich positiver geworden und zweitens gibt es andere Formen der Freizeitbeschäftigung."Sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tage sollst du ruhn!" Das galt früher für Erwachsene. Man arbeitete sechs Tage, am Sonntag ging man zum Gottesdienst, besuchte Verwandte und Freunde und man ruhte aus. "Erst die Arbeit, dann das Spiel", das galt für Kinder. Kindern und Jugendlichen war das Spielen erlaubt. Aber Spielen und Freizeit hatten nicht den Stellenwert wie heute. Das Freizeitangebot war früher relativ beschränkt, es wurde im Dorf kollektiv entschieden, was an einem bestimmten Abend oder an einem Sonntagnachmittag an Freizeitbeschäftigung dran war. Die Auswahl war klein. Heute hat man mehr Möglichkeiten, die Angebote sind vielfach formal organisiert (Sportclub), sie haben häufig mit Konsum (Restaurant, Asados) oder mit Show (Rallyr, Wettspiele, Fernsehen) zu tun, und man entscheidet entweder individuell oder in kleinen Gruppen, welche Wahl man trifft. Das Zentrum der Kolonie ist die Attraktion, das Motorrad und das Auto machen’s möglich. Auch Urlaubs- und Wochenendreisen sind Bestandteil der Erholung. Erwachsene nehmen teil, so weit sie können, die Jugend meint, "action" muss sein.
- Insgesamt hat in der Gesellschaft der Mennoniten im Chaco ein Prozess angefangen, der von der Einförmigkeit der Dorfkultur zu mehr Vielfalt führt. Der Grad der Komplexität und Differenziertheit ist zwar nicht mit der einer modernen pluralistischen Gesellschaft zu vergleichen. Auffallend ist aber die grundsätzliche Bejahung dieser Entwicklung. Unsere Lebensweise wird vielfältiger in ihrer sozialen Organisation (Gruppen, Vereine), in der sozialen Schichtung, im Netz der Institutionen, im kulturellen Ausdruck (Musik, Literatur) in Wirtschaft, Verkehr und Technologie, in ihren Auffassungen, in den Umgangsformen usw. Man könnte hier von einem Prozeß der Öffnung sprechen. Dieser, wenn einmal in Gang gesetzt, erhält eine Eigendynamik, die der modernen Gesellschaft innewohnt.
- Kaum eine Institution wird von der Frage des sozialen Wandels so bewegt wie die Schule. Die Schule steht immer zwischen Tradition und Innovation. Sie muss sich gemäß ihrem gesellschaftlichen Auftrag immer an beiden orientieren, das rechte Maß finden, die Spannung zwischen beiden Polen aushalten und kreativ lösen. Diese Tatsache kennen mennonitische Lehrer nur zu gut. Denn wenn die Schule sich hauptsächlich am kulturellen Erbe orientiert, dann droht ihr die Gefahr, bedeutungslos, irrelevant und lächerlich zu werden. Beschreitet sie aber neue Wege, besonders im ideellen Bereich, dann wird sie als Konkurrent und Gegner der Kirchengemeinden empfunden. Wie hart die Auseinandersetzungen sein können, hat man in Fernheim im Zusammenhang mit der völkischen Zeit und in Menno mit der kolonieinternen Schulreform Ende der fünfziger Jahre erlebt. Aber auch Mädchensport, Volkstänze, Formulierung von Erziehungszielen, Anschaffung von bestimmten Schultexten und Filmen und die Anstellung von Lehrern "von außen" gaben oft Anlass zu Verstimmungen. Was hat sich aber im Schulwesen wirklich geändert? Zu dieser Frage ein paar Anmerkungen.
- Unsere Schule orientiert sich seit 1970 zunehmend an dem nationalen Schulsystem. Früher ,machten wir selber Schule`, jede Kolonie auf ihre Art.
- Die Schule orientiert sich auch zunehmend an international gültigen Vorstellungen von Bildung. Gemäß unserer traditionalen Vorstellung von Schule sollte der junge Mensch die Grundfähigkeiten Lesen, Schreiben und Rechnen erlernen und zu einem ordentlichen, gehorsamen Mitglied der Gesellschaft erzogen werden. Die Bildung der Persönlichkeit gemäß den individuellen Veranlagungen wird heute dagegen stärker vertreten.
- Das Schulsystem hat sich stärker auf das Wirtschaftssystem und auf die Schüler eingestellt, indem es die Berufsausbildung ernst nimmt (Berufsschule in Loma Plata, Bildungszentrum in Neuland, Bachillerato Comercial in Filadelfia). Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass Bildung für das Leben sein soll. Verändert haben sich auch die Schüler und das Umfeld der Schule. So kommen die Schüler heute zu uns in die Schule: Wohl genährt, wohl gekleidet, niemand ist müde, weil er auf dem Acker helfen musste, auf Fahrrädern oder auf Motorrädern, mit Bussen, einige auch mit Autos, manche sind abgespannt wegen eines Sport– oder Kirchenprogramms oder wegen des Videofilms vom Abend davor. Sie sind selbstbewusst, gewohnt, Forderungen zu stellen, Entscheidungen selber zu treffen und sich ein Urteil zu erlauben. Mit dem Gehorsam klappt es nicht mehr so ganz, und mit der Rücksichtnahme noch nicht. Hausaufgaben zu machen, bloß weil es der Lehrer fordert, das ist `ne Tugend von früher. Da soll er doch mal ein schlaues Punktesystem ersinnen, womit er meine Mühe belohnt! Ansonsten ist man ein ganz lockerer, umgänglicher Mensch. Der Erziehungsstil in den Familien wird zwar immer noch von Gehorsam, Pflichterfüllung, Fleiß und Ordnung geprägt, aber neue Kriterien gesellen sich dazu wie elterlicher Respekt vor der Individualität, Verständnis für kindliches bzw. jugendliches Verhalten, relativ leichte Bedürfnisbefriedigung usw. Unseren Kindern soll es besser gehen, heißt es. Hier soll nicht das eine idealisiert und das andere verdammt werden. Die Schule muss aber dieser neuen Situation Rechnung tragen. Das veränderte Umfeld wird die Schule in Zukunft noch oft dazu zwingen, unseren Erziehungsstil, die Rolle und den Bildungsauftrag zu überdenken und anzupassen.
- Die Gemeinde oder Kirche, wenn auch ihre zentrale biblische Botschaft unverändert bleibt, so muss sie sich doch den Umständen und Zwängen der Zeit und den intern auftretenden neuen Erkenntnissen und Bedürfnissen anpassen. Das geschieht im Glaubenstil, in Gottesdienstformen und in der Frage, welche Werte Teil des zentralen Anliegens der Gemeinde als gesellschaftlicher Institution sind. In den Gottesdienstformen und in gemeindlicher Aktivität hat man sich in den letzten Jahrzehnten Mühe gegeben, mehr Gemeindeglieder zu aktivieren, sowohl in der Mitarbeit als auch in der Gestaltung der Gottesdienste und anderer Aktivitäten. Anspiele, Zeugnisstunden, Familienabende, eine Vielzahl von Komitees, Ausflüge, Hauskreise und Auflockerung durch flottere Lieder sind Beispiele dafür. Sie erwecken aber gelegentlich den Eindruck von Überprogrammierung und Show. Stark exponiertes Bekenntnis, Dogmatisierung und Angst vor falschen Lehren beseelen uns heutige rechtgläubige Mennoniten in unserem Glaubensstil. Früher wurden wir unserer Gelassenheit beraubt durch die Angst, etwas Falsches zu tun, durch die Sorge um das Seelenheil, durch die Versuchungen und Verfolgungen von Seiten der „Welt". Heute haben wir andere Stichworte, aber unser Glaubensstil bleibt etwas Mühevolles und Mechanistisches. Das Evangelium primär als Quelle des Zuspruchs, der Freiheit und Dynamik zu erleben, das fällt uns schwer.
Die Gemeinde tritt in der Mennonitenkolonie nicht nur als Verkündigerin des Evangeliums auf, sondern auch als höchste gesellschaftliche Instanz. Als solche möchte sie bei allen wichtigen gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen mitreden. Sie vermeidet zwar gern die konfliktiven Geschäfte der Wirtschaft und der internen Politik, tritt aber in den Strukturen mit ihrer Präsenz und mit ihrem Anspruch als politische Kraft auf. Hier wird wahrscheinlich mit zunehmender politischer Integration auf nationaler Ebene und mit der zunehmenden Säkularisierung der eigenen Gesellschaft ein Wandel eintreten, vielleicht zugunsten der eigentlichen Aufgabe und Funktion der Gemeinde.
Ursachen des sozialen Wandels und Widerstände
Sozialer Wandel geht in allen Gesellschaften relativ langsam voran, in manchen aber langsamer als in anderen und in noch anderen, wie den pluralistischen, industriellen und postindustriellen Gesellschaften ist er zur Norm, wenn nicht gar zur Institution geworden. Niemand darf sich aber wundern, wenn die Veränderung nicht auf Anhieb akzeptiert wird, denn es ging ja bisher auch ganz gut ohne sie.
Die komplexen, dynamischen und offenen Gesellschaften haben ein großes Volumen und einen schnelleren Rhythmus des sozialen Wandels zu bewältigen. In den traditionellen, stabilen und geschlossenen Gesellschaften ist die Häufigkeit und die Geschwindigkeit des Wandels geringer. Oft gehen die Impulse der Innovationen von den ersteren aus und Jahre später erreichen sie die traditionelleren Gesellschaften. Aber sozialer und kultureller Wandel kommt auch von innen, und es gibt keine Gesellschaft ohne Kulturwandel.
Und jetzt zu den Ursachen des sozialen Wandels bei uns:
Als in den siebziger Jahren an der Asphaltierung der Trans-
Chaco-Straße gearbeitet wurde, freuten sich die Vertreter der Wirtschaft, aber viele andere runzelten die Stirn und stellten die bange Frage:"Waut woat ons daut aules brinje?" Zum Teil hatten sie Recht, denn der Einbruch in unsere Isolation durch Verkehrsanbindung an die Hauptstadt, durch Telefonverbindung und Fernsehen haben wirklich einiges verändert, aber es gibt meines Erachtens viel wichtigere Gründe für den sozialen Wandel in den
Mennonitenkolonien.
Eine Ursache sehe ich in dem allgemeinen Bedürfnis, die Armut und Rückständigkeit zu überwinden. Dies war immer eine starke Triebfeder in der Entwicklung der Kolonien. Die Mennoniten der Pionierjahre und darüber hinaus hatten individuell und als Gemeinschaft ein schwaches Selbstbewusstsein. Der Vergleich mit der Ukraine, mit Kanada, mit Deutschland, mit
Asunción, mit den Mennoniten vor allem aus Nordamerika ließ sie als ignorant, arm und rückständig erscheinen. An der Überwindung dieses Defizits ist immer zielstrebig und manchmal auch verkrampft gearbeitet worden.
Die Technik ist der größte Veränderer, den wir auf der Welt haben. Das trifft auch für uns zu, wenn wir an die Mechanisierung der Landwirtschaft in den 60er Jahren denken. Denn diese verbesserte nicht nur unsere Wirtschaftslage, sondern veränderte unseren Lebensrhythmus, den Tagesablauf, das Verhältnis zu den Indianern, und gekoppelt mit Krediten ließ sie auch ein größeres soziales Gefälle innerhalb der Mennonitengesellschaft entstehen.
Die aus der veränderten Technologie resultierende Wirtschaftsdynamik wird getragen von Konkurrenzdenken, Produktion, Rentabilität und den dazu gehörigen Einstellungen und Auffassungen. Der Wirtschaftsfaktor als Veränderer hat viele Kinder. Sie heißen Arm und Reich, Konsumorientierung, Anspruchsdenken, Sonntagsarbeit, verstärkte Integration, ein verändertes Bevölkerungsbild, Erziehungsprobleme und vieles andere mehr.
Die Kontakte mit der Außenwelt, besonders mit
Asunción, Kanada und Deutschland, brachten uns in den letzten Jahren eine Reihe von neuen Verhaltensmustern und Werten. Viele Familien waren dorthin ausgewandert, kehrten zurück und verbreiteten neue Einstellungen und Umgangsformen.
In ähnlicher Weise fängt auch die ethnische Vielfalt an, in den zentralen Orten zu wirken. Hier sind wir allerdings erst am Anfang. Wenn aber in 20 Jahren die Mennoniten zur Minderheit würden, dann könnte sich noch einiges an unserer Lebensweise ändern, und das mit einer ungeahnten Schnelligkeit.
Geographische Abgeschlossenheit hat uns gezwungen, all das, was wir als Mennoniten eher der "Welt" überlassen würden, selber zu gestalten: Ein ausgeprägtes politisches System, eine bürgerliche Verwaltung, Steuern, Sozialdienste, Handel und Industrie, Dienstleistungsangebote, Straßenbau, übrigens auch die Regelung der öffentlichen Ordnung. Die Isolierung hat uns gezwungen, manche Funktionen von Regierung und Staat zu übernehmen. Selbst die „böse Stadt" haben wir aus dieser Not heraus selber geschaffen.
Auch die Konkurrenz zwischen den Kolonien ist eine wichtige Ursache für Fortschritt und Veränderung gewesen. Wetteifer soll bekanntlich ein starker Motivationsfaktor sein. Jeder von uns kennt ein Dutzend Anekdoten und
Witze, die auf irgendeine Weise den Vergleich zwischen den Kolonien zum Ausdruck bringen. Die
Kolonie Menno hat, gemessen an den Beweggründen ihrer Auswanderung aus Kanada, die meisten Veränderungen und Umbrüche erlebt. Eine Studie darüber, welche Rolle dabei die Kolonien
Fernheim und
Neuland spielten, wäre wissenschaftlich interessant. Aufschlussreich im Wetteifer der
Mennonitenkolonien im
Chaco sind auch die Haltungen und Reaktionen um die Frage, wer im Konzert der
Mennonitenkolonien die erste Geige spielen soll. Denn das hängt nicht nur von der Wirtschaftsdynamik, sondern auch von fortschrittlichem Denken und von Weltoffenheit ab.
Auffallend bei uns Mennoniten ist auch die Tendenz zum sozialen Wandel von oben, die geplante Reform. Die besten Beispiele dafür sind die Kulturreform der
Kolonie Menno in den fünfziger Jahren mit ihrem Ältesten Friesen und die Gemeindereform der
Sommerfelder mit ihrem Ältesten Heinrichs. Es sind nicht Revolutionen von unten, vom Volk, bei denen ein autoritäres System überwunden wird, sondern von oben, von einsichtigen und weitsichtigen Führern geplant und durchgeführt. In
Menno wurde sogar ein Teil der Bevölkerung entlassen, und zwar durch Auswanderung nach Bolivien. In abgeschwächter Form funktioniert dieser Mechanismus bei uns überall. Das Volk hat sowohl beim Broterwerb als auch beim religiösen Erbe das Sagen. Die einsichtigen Führer der Gemeinschaft aber, die etwas verändern wollen, haben in Reformfragen immer auch etwas zu befürchten: "Wi tjrieje onse Mensche nich met!", mussten schon manche resigniert zugeben.
„Last not least" hat die paraguayische Verfassungsreform von 1992 bei uns einen Umwandlungsprozess im politischen Denken und Handeln in Gang gesetzt. Nicht etwa, weil diese mehr Demokratie brachte, sondern weil die darin vorgesehene Dezentralisierung mehr Entscheidungsbefugnis und Einflussmöglichkeit in die Hände der Departamentsregierungen und der Munizipalitäten legen sollte. Wir hatten plötzlich zu befürchten, dass die, die bisher unsere Arbeiter waren, zu politischen Machthabern mit Entscheidungsbefugnissen aufsteigen würden. Das unbestrittene Wohl der Mennonitengemeinschaft schien damit in Frage gestellt zu sein. Deshalb waren wir bereit, unsere Haltungen zu ändern.
Hier schließt sich der Kreis. Durch politische Unterdrückungssysteme im 16. Jahrhundert wurden wir Verfolgte, durch die Gesetzgebung der Kaiserin Katharina der Zweiten wurde das "mennonitische Reich" in der
Absonderung besiegelt. Wenn "die Welt" dann diese
Absonderung nicht mehr respektieren wollte, fühlten wir uns wieder verfolgt und suchten noch mehr
Absonderung. Hier im paraguayischen
Chaco in der Isolierung hat die "böse Welt" uns nun eingeholt, und zwar mit einer demokratischen Gesetzgebung. Wir sind wieder bereit, mit ihr zusammenzuarbeiten, auch in der
Politik. Die Welt hat uns wieder.
Und jetzt noch einige Beobachtungen zu den Widerständen: In allen Gesellschaften wird dem sozialen Wandel zunächst auch mit Widerstand begegnet.
(11) Die Gründe dafür liegen auf der Hand und treffen bei uns auch zu. Der stärkste Widerstand liegt in der
Kultur selbst mit ihrem Netz von Institutionen. Die bestehenden Institutionen befriedigen die Bedürfnisse der Menschen. Sicher erleben die Menschen sie auch als hemmend, aber im Allgemeinen erhält der Einzelne durch sie Sicherheit und die
Kultur Beständigkeit. Deshalb sind wir auch oft nicht bereit, das Bestehende in Frage stellen zu lassen und sagen einfach "wie han daut so". Wenn die betreffende Sitte, Einrichtung oder Institution dann noch von der christlichen
Gemeinde abgesegnet wird, ist sie desto stabiler.
Gegenwärtig spielen die Mennoniten im
Chaco die Rolle der dominanten Gesellschaft. Die Schlussfolgerung, dass das etwas mit der Effektivität unserer Institutionen, den Werten und Normen zu tun hat, ist leicht nachvollziehbar. Wenn die andern mal würden, so wie wir, dann ginge es ihnen auch besser. So bestätigen wir unsere Eigenart und sehen keinen Grund, etwas zu ändern.
Wer in einer Mennonitenkolonie versucht, eine neue Idee durchzusetzen, stößt sehr oft auf einen ziemlich starken, aber schwammigen Widerstand, der weder lokalisierbar noch definierbar zu sein scheint. Er treibt manchen Neuankömmling in die Frustration und manchen Insider in das Aus. Ich nenne dieses Phänomen die "stumme öffentliche Meinung". Wer mit ihr nicht konform geht, hat Probleme, wer mit ihr nicht zumindest rechnet, hat keinen Erfolg. An ihr ist schon manch ein
Oberschulze und manch ein Gemeindeleiter in seinem Vorhaben gescheitert. Der Erfolg einer Erneuerung ist aber gut gesichert, wenn der Erneuerer es versteht, sich dieser stillen Übereinkunft zu bedienen.
Was ist denn das Anliegen der stummen öffentlichen Meinung? Ist es etwa die demokratische Beteiligung und das Mitspracherecht der breiten Öffentlichkeit? Kaum, denn das offene Gespräch ist häufig nicht erwünscht. Soll eine Sache durchgesetzt werden, so genügen einige wenige gefühlsorientierte Bemerkungen beim
Tereré. Soll etwas aufgehalten werden, dann auch, manchmal genügt auch betretenes Schweigen. Dieser Widerstand ist stumm, aber zäh. Wer sind die Vertreter dieses Forums? Gute, unbescholtene Bürger, Durchschnittsmenschen. Sie äußern sich allerdings auch manchmal öffentlich, wenn es sein muss, aber eben nur dann.
Als einen letzten Widerstand möchte ich den sehr stark ausgeprägten Gemeinschaftscharakter nennen. Dieser bewirkt nämlich ein intern aufeinander abgestimmtes System von Normen und Werten. Die soziale Kontrolle ist sehr effektiv. Das Netz der Institutionen ist gut ausgebaut. Der Gemeinschaftscharakter wird in unserem Fall verstärkt durch die gemeinsame plattdeutsche Sprache, durch die ethnische Zugehörigkeit, durch den gemeinsamen Glauben, durch wirtschaftliche Kooperation und durch die geographische und soziale Isolierung. Diese Gemeinschaft im soziologischen Sinne ist für uns Mennoniten der höchste Wert. Wird sie durch irgendwelche Veränderungen in Frage gestellt, dann wehren sich meist nicht nur die konservativen Kräfte, sondern die ganze Gemeinschaft.
Zum Schluss: Sozialer Wandel in den
Mennonitenkolonien ist ein Prozess, der im Wesentlichen so abläuft, wie in jeder anderen Gesellschaft. Er vollzieht sich für alle, so sicher wie sich die Erde dreht. Den einen zur Freude, den anderen zum Ärger. Aber alle müssen lernen, damit zu leben.
Fussnoten:
| |
| |
| Urry, James: None but Saints: The Transformation of Mennonite Life in Russia 1789-1889. Hyperion Press Limited, Winnipeg, 1989 |
| Cohen, Bruce J.: Introducción a la Sociología, Mexico: Mc Graw-Hill 1998, S. 221 |
| Barley, Delbert: Grundzüge und Probleme der Soziologie, 8. Aufl. Neuwied Darmstadt: Luchterhand, 1977, S. 188 |
| Fichter, Joseph: Sociología. Barcelona: Editorial Herder, 1977, S. 350 |
| Horton and Hunt: Sociology. Second edition. New York: McGraw-Hill, 1968, S. 460-466 |
| Rocher, Guy: Introducción a la Sociología general. Barcelona: Editorial Herder, 1975, S. 453-454 |
| Foster, George M.: Las culturas tradicionales y los cambios técnicos. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1966, S. 144-146 |
| Dieser Begriff wurde erstmalig von dem Mennonitenforscher E.K. Francis geprägt. |
| Rocher, Guy: Introducción a la sociología general. Barcelona: Editorial Herder, 1975, S. 386 |
Kulturelle Beiträge
Ausgewählte neuere mennonitische Literatur
1. Einleitung
Mennoniten haben viele
Prediger, aber nur wenige Dichter. Wie kommt das? Vielleicht, weil sie als religöse und nicht als kulturelle Bewegung enstanden sind. Seit jeher waren sie bestrebt, Gottes Wort zu verkündigen, ganz gleich, ob in schlichter Ansprache der Laien oder in gebildeter Rede der akademisch gebildeten Pastoren. Dichtung jedoch scheint bei ihnen bis heute eine brotlose Kunst zu sein, die geringen praktischen Nutzwert hat. Hinzu kommt, dass Dichter ihre Personen erfinden und sie mit ihren guten und schlechten Charaktereigenschaften ungefiltert darstellen. Das verleiht ihnen den Ruf, Lügengeschichten zu erzählen und die Jugend zum Schlechten zu verführen.
Die Folge davon ist, dass die Sprache bei den Mennoniten verarmt, da sie der dichterischen Reichhaltigkeit entbehrt. Hinzu kommt, dass das Prinzip der Wahrhaftigkeit arg strapaziert wird, wenn Personen in den Erzählungen vornehmlich Vorbildcharakter haben sollen. Das müsste uns zu denken geben, denn die
Bibel, auf die sich die Mennoniten seit Anbeginn berufen, kennt beides: dichterische Sprache und ungeschminkte Darstellung des Menschen mit all seinen Stärken und Schwächen.
Seit dem 20. Jahrhundert hat es jedoch in zunehmendem Maße mennonitische Dichter gegeben, die in der einen oder anderen Form ihre Sicht des Menschen und der Verhältnisse zu Papier gebracht haben. Oft sind es Lehrer, die ein Literaturstudium absolviert haben, oder Personen, die einfach Freude an der Literatur gefunden haben und nun selber zur Feder greifen. Ich will und kann hier keinen Gesamtüberblick über mennonitische Schriftsteller geben, sondern nur eine kleine Anzahl ausgewählter Werke präsentieren, die den Leser zur Lektüre von Belletristik animieren sollen.
Dichterische Werke gewähren uns Einblicke in die Seele des Menschen, die wir durch die Lektüre von religiösen, psychologischen oder pädagogischen Werken allein nicht gewinnen können. Lesen von Dichtung ist daher nicht nur ein ästhetischer Genuss, sondern zugleich ein Bildungsprozess, der weder durch Video noch durch Fernsehen zu ersetzen ist. Denn mittels der dichterischen Sprache dringen wir ein in das Innerste der menschlichen Persönlichkeit, nehmen teil an ihren Gedanken, ihren inneren Monologen, ihren Ängsten und Freuden, die sie vor der Öffentlichkeit häufig verbergen können.
Kaspar H. Spinner nennt im Blick auf jugendliche Leser drei Zielsetzungen, die das Lesen von Geschichten begründen: Erstens kann sich der Jugendliche aufgrund eigener Lebenserfahrung in den literarischen Texten wiederfinden oder sich von den dort geschilderten Figuren und Situationen abgrenzen. Gleichzeitig kann durch die Lektüre literarischer Texte die eigene Entwicklung antizipiert werden, sei es im persönlichen oder beruflichen Bereich. Zweitens vermitteln literarische Texte fremde Perspektiven und andere Sichtweisen. Drittens fördern Geschichten die Kreativität der Leser, indem sie deren Vorstellungskraft stimulieren und zur produktiven Verarbeitung von Erfahrungen anregen.
(2)
Nun ein paar Bemerkungen zur Begriffsklärung: Das Wort „Literatur" wird in einem weiten und in einem engen Sinn verwandt. Ganz allgemein versteht man unter Literatur alles Schrifttum, das „vom Brief bis zum Wörterbuch und von der juristischen, philosophischen oder religiösen Abhandlung bis zur politischen Zeitungsnotiz" reicht. Demgegenüber verstehen wir unter Literatur im engeren Sinn die sogenannte schöne Literatur, die Belletristik, „die nicht zweckgebundene und vom Gegenstand ausgehende Mitteilung von Gedanken, Erkenntnissen, Wissen und Problemen ist, sondern aus sich heraus besteht und eine eigene Gegenständlichkeit hervorruft, durch besondere gemüthafte und ästhetische Gestaltung des Rohstoffs Sprache zum Sprachkunstwerk wird und in der Dichtung ihre höchste Form erreicht."
(3)
Mancher Leser fragt sich beim Lesen eines Buches, ob denn das Gelesene auch wirklich wahr sei. Diese Frage wird häufig auch direkt an den Dichter gerichtet. Die meisten Autoren wollen diese Frage nicht beantworten, da sie ihrer Meinung nach nicht den Kern der Dichtung berührt. Dichtung verdichtet das im Leben von einzelnen Personen Erlebte in einer vom Dichter künstlich erschaffenen Figur. Diese Figur ist dann natürlich nicht identisch mit einer der Personen, die den Dichter zum Schreiben stimuliert haben. Wenn es sich um ein dichterisches Werk handelt, ist die Figur dennoch echt in dem Sinne, dass ihre Erlebnisse den realen Bedingungen und Gegebenheiten entsprechen. Personen und Geschehnisse in einem Roman können daher wahr sein, ohne jedoch wirklich zu sein. Wir müssen also bei der Dichtung zwischen Wirklichkeit und Wahrheit unterscheiden. Natürlich können Wahrheit und Wirklichkeit sich auch in dichterischen Werken decken, z.B. in einer autobiographischen Darstellung. Der Wert der Dichtung richtet sich aber mehr nach dem Wahrheitsgehalt als nach dem Grad der Wirklichkeit.
Fragen wir nun noch: Wie wird man Dichter bzw. warum schreibt ein Dichter? Wer schreibt, will Eindrücke und Erkenntnisse, die ihn bewegen, in Sprache umsetzen. Er will sich über Personen und Sachen, über Ereignisse und Verhältnisse Klarheit verschaffen. Er sucht Antwort auf die vielen Fragen, die ihn bedrängen und will sie in einer ästhetisch anspruchsvollen Form wiedergeben. Daher experimentiert und spielt er mit der Sprache und nutzt ihre gesamte Bandbreite aus.
Über das Selbstverständnis und die Rolle eines Autors hat sich der Schriftsteller Dumitru Tsepeneag in seinem Roman „Hotel Europa" so geäußert: „Der Autor ist wie der Heilige Geist: voller Ideen, aber unsichtbar, unhörbar. Er zieht alle Fäden, das stimmt, aber wem gehören sie? Will sagen, dass er Figuren braucht, und seien es noch so armselige Marionetten. Umgekehrt brauchen alle diese Kreaturen, die keine menschlichen Wesen sind _ deshalb nennt man sie ja auch Figuren! – , eine Stimme, um existieren, um sich ausdrücken zu können." Der Erzähler „spielt alle Rollen, lenkt Äußerungen, Gedanken. Denn irgendwo in den Kulissen kauernd, denkt er mit lauter Stimme." Er fährt dann fort: „Vielleicht sollte man gar nicht von einem Erzähler sprechen… Sind es nicht sogar mehrere? Sind nicht auch die Leser so etwas wie Erzähler? Denn schließlich lesen wir doch nicht alle den gleichen Text, auch wenn er sich in demselben Buch befindet?"
(4)
Die Erdschwere unserer bäuerlichen Herkunft hindert uns oft daran, den Blick vom Weg oder Acker zu lösen und den Geist einmal ungezügelt schweifen zu lassen, hinauf bis in ungeahnte Höhen oder hinab bis in die tiefsten Tiefen. Hinzu kommt, dass die moralische Bremse uns an unkontrollierten Höhenflügen hindert und das gesellschaftserhaltende Gummiseil uns vor dem plötzlichen Absturz bewahrt. Die Folge davon ist relative Sicherheit, weit verbreitete Mittelmäßigkeit und eine an das Reale gebundene Genussfähigkeit.
Mennonitische Dichter, die sich infolge ihrer Neugierde und Risikobereitschaft an den mennonitischen Tellerrand wagen, stehen in der Gefahr, von der Zentrifugalkraft des rotierenden Tellers wie ein Satellit in die Welt hinausgeschleudert zu werden. Geraten sie dabei in eine Umlaufbahn, so besteht noch die Chance der Rückkehr, haben sie jedoch den Wirkungsbereich der mennonitischen Schwerkraft ganz verlassen, besteht nur wenig Hoffnung auf eine glückliche Wiederkehr.
Nach diesen einführenden Worten wenden wir uns nun einigen Dichtungen zu. Bei der Dichtung unterscheiden wir drei wesentliche Bereiche: Epik, Lyrik und Drama. Ich werde mich hier auf die erste Gattung beschränken. Ich habe die Auswahl meiner Bücher mehreren Themenkreisen zugeordnet und beginne nun mit dem ersten:
2. Verfolgung, Flucht, Wanderschaft
1993 veröffentliche Harry Löwen das Buch
No permanent City. Stories from Mennonite History and Life.
(5) Dieses Buch, das 1995 unter dem Titel
Keine bleibende Stadt(6) in deutscher Sprache erschien, enthält Geschichten über Anabaptisten und Mennoniten aus den letzten fünf Jahrhunderten. Loewens Geschichten handeln von Mennoniten, die wegen der Verfolgung in verschiedene Länder gewandert sind, um endlich einmal sesshaft werden zu können. Er will dem Leser keine moralische Lektion erteilen, wohl aber bei ihm ein Verständnis für die Mennoniten und deren Glauben in Lehre und Praxis wecken. Loewens Geschichten beruhen auf wahren Begebenheiten. Bei einigen Erzählungen überwiegt der historische Aspekt, bei anderen die dichterische Freiheit. Die Geschichten sind kurz, spannend und gut lesbar. Sie sind daher besonders auch der Jugend zu empfehlen und in Schul- und Jugendarbeit einsetzbar.
Auch Peter P. Klassens Buch Und ob schon ich wanderte. Geschichten zur Geschichte der Wanderung und Flucht der Mennoniten von Preußen über Russland nach Amerika, das 1997 erschienen ist, gewährt dem Leser Einblick in das Leben eines Wandervolkes, das vor äußeren und inneren Verfolgern fliehen muss. Klassens Geschichten beruhen auf wahren Erlebnissen, die in dichterischer Freiheit nacherzählt werden. In der Titelgeschichte geht es um Jakob B. Hiebert, der wegen der Übertretung von Gemeinderegeln in Cuauthémoc in Mexico in den Bann getan wurde. Klassen schreibt:
„Die Gemeindezucht hatte Jakob Hiebert in ihrer schärfsten Form getroffen. Es war der strenge Bann, wie er nach altem Brauch und nach neutestamentlicher apostolischer Weisung verhängt wurde. Sein Vergehen war eigentlich ein doppeltes und in den Augen des Ältesten und des ganzen Lehrdienstes ein sehr schwerwiegendes. Er hatte einen Pritschenwagen gekauft, Pick-up, sagte man dort von Kanada her, und das war von der
Gemeinde verboten worden. Doch der andere Fehltritt war noch schwerer. Hiebert hatte viele Bücher gelesen und gelegentlich Zweifel an der ausschließlichen Richtigkeit der Gemeindeordnung geäußert. Nun hatte er noch _ und das hatte dem Faß den Boden ausgeschlagen – seinen Sohn, den vierzehnjährigen Abram, in die Schule von Quinta Lupita geschickt. Diese Schule war von der Allgemeinen
Konferenz in Nordamerika und von der abtrünnigen Blumenaugemeinde aufgebaut worden. Sie war staatlich anerkannt und widersprach in ihrem Wesen vollkommen den traditionellen Gemeindeschulen in den Mennonitendörfern.
Jakob Hiebert war sich bewußt, dass er mit seinem Verhalten den Nerv des Gemeindesystems getroffen hatte, den eigentlichen Grund für die Existenz der Altkolonier Mennoniten in Mexico. Er wusste auch um den Grund für die Heftigkeit der Reaktion des Ältesten Dyck auf diese Übertretungen. Es ging darum, jedem Einbruch zu wehren, die kleinen Füchse zu vertreiben, die den Weinberg verderben, dem Teufel auch nicht den kleinen Finger zu reichen. Diese konsequente Haltung war das Bollwerk der
Gemeinde gegen den Unkrautsamen, den der Feind nicht müde wurde auszustreuen."
(7) 3. Frieden und Wehrlosigkeit
Die Mennoniten gehören zu den historischen Friedenskirchen. Das Glaubensprinzip der
Wehrlosigkeit hat manche Opfer gekostet und hat keineswegs immer dem Frieden gedient. Es führte zu Auseinandersetzungen mit solchen, die bereit waren, ihr eigenes Leben und das der anderen mit der Waffe in der Hand zu verteidigen, aber auch mit solchen, die von innen her kritische Fragen bezüglich der Glaubensüberlieferung stellten.
Dass Frieden auch zerstörerisch sein kann, ist schon in Daniel 8, 23-25 nachzulesen. Dort heißt es: „In der letzten Zeit ihres Königreichs, wenn die Übertreter überhand nehmen, wird aufkommen ein frecher und tückischer König. Der wird mächtig sein, doch nicht durch seine Kraft; er wird greulich verwüsten, und es wird ihm gelingen, dass er´s ausrichte. Er wird die Starken samt dem heiligen Volk verstören. Und durch seine Klugheit wird ihm der Betrug geraten, und er wird sich in seinem Herzen erheben, und mitten im Frieden wird er viele verderben und wird sich auflehnen wider den Fürsten; aber er wird ohne Hand zerbrochen werden."
„Und mitten im Frieden wird er viele verderben" – Dieses Motiv hat der mennonitische Dichter in Kanada Rudy Wiebe aufgegriffen und 1962 in seinem Roman
Peace shall destroy many(8) entfaltet. In dem Roman geht es um die Erlebnisse einiger Mennoniten, die um 1920 aus Russland nach Kanada gekommen sind, um sich hier eine mennonitische heile Welt aufzubauen. Sie müssen jedoch erfahren, dass das letzlich unmöglich ist. Nicht, weil sie von außen zu hart bedrängt werden, nein, sondern weil sich Glaubensprinzipien in den Händen von frommen, aber selbstgerechten Gemeindegliedern in Leben Zerstörende Waffen verwandeln.
Die Handlung spielt in einer fiktiven Mennonitensiedlung in Kanada. Die Hauptfiguren sind der junge kritische Thom, der den mennonitischen Glauben durchaus akzeptiert, aber angesichts seiner Erfahrungen ins Fragen gerät. Sein Gegenspieler ist Mr. Block, der fromme, aber selbstgerechte Gemeindediakon, der für seinen Sohn Peter eine heile mennonitische Welt aufbauen will und dabei seine Tochter opfert. Mit allen Mitteln will Mr. Block seine
Familie und die ganze
Gemeinde auf dem Pfad der Väter halten. Zu seinen Glaubensprinzipien gehört die
Wehrlosigkeit ebenso wie die deutsche Sprache und das Verbot von Heiraten mit Nicht-Mennoniten. Wiebe zeigt in seinem Roman, wie brüchig solche Prinzipien werden, wenn sie formalistisch gehandhabt und nicht inhaltlich aufgefüllt werden. So erfährt der Leser, dass Mr Block in Russland selber zum Totschläger wurde und in Kanada bereit ist, Tochter und
Frau zu verstoßen, als er erfährt, dass seine Tochter ein uneheliches Kind bekommt, das von einem Mischling stammt. Da Kind und Mutter bei der Geburt sterben, kann der Schein nach außen noch einmal gewahrt werden, aber die heile Welt, die Mr. Block in Kanada aufbauen wollte, ist ein für alle Mal zerstört.
Dass die Aufrechterhaltung des Prinzips der
Wehrlosigkeit Mennoniten wie Nicht-Mennoniten in Bedrängnis bringt, zeigt Peter P. Klassens Erzählung „Die Buschinsel" in seinem Buch
Kampbrand, das er 1989 veröffentlicht hat. Darin schildert er das Dilemma eines mennonitischen Oberschulzen angesichts der Klagen über
Viehdiebstahl, gibt aber auch den berechtigten Vorwurf eines paraguayischen Generals wieder, den dieser angesichts eines toten und einiger gefangener Einbrecher gegenüber dem Oberschulzen erhebt. Hier zunächst das Dilemma des Oberschulzen:
„Was soll ein
Oberschulze machen, wenn in seinem Amtssitz Tag für Tag Klagen aus den Dörfern einlaufen? In Rückenau hatten die Viehdiebe eine ganze Herde weggetrieben, mit den besten Milchkühen einiger Bauern. Niemand hatte es gewagt, den Dieben zu folgen. Niemand wollte sein Leben aufs Spiel setzen. Immer wieder waren die Klagen gekommen, aus Heimstätte, aus
Lichtenau, aus Rudnerweide. Die Klagen hatten drohend geklungen. Könnt ihr denn nichts machen? Wann wird endlich etwas unternommen? Wir verlieren all unser Vieh! Wenn hier nicht durchgegriffen wird, müssen wir alle zurück nach Kanada!"
(9)Der General, der über die gefangen genommenen Einbrecher verfügen muss, steht ebenfalls in einem Konflikt und
macht seinem Ärger Luft:
„’Señor Administrador’, sagte der General. Seine Augen funkelten, und Wiebe sah es. `Señor Administrador’, wiederholte der General noch schärfer, ‘wissen Sie, dass Sie schuld sind an dem Tod dieser Knaben? Wissen Sie, dass es keinen Ueberfall gegeben hätte, wenn Ihr Laden bewacht worden wäre, wenn der Wächter eine Waffe gehabt hätte? Ihre wehrlose Haltung ist eine Herausforderung für alles Gesindel im
Chaco, für die Viehdiebe und für die Landstreicher!’
Wiebe schluckte. Sein Gaumen war trocken geworden.
‘Herr General!’, kam es mühsam über seine verbrannten Lippen. Die Zunge widersetzte sich. ‘Herr General, die Regierung hat versprochen, uns zu beschützen.’ Ihm stieg das Blut ins Gesicht, und ihm wurde übel."
(10)Prinzipientreue auf der einen Seite und skrupellose Anpassung an die Denkweise der jeweils Herrschenden, verkörpert durch die beiden Mennoniten David Regier und Jakob Enns, wird in der Geschichte „Der Fahneneid" thematisiert, die Peter P. Klassen in seinem Buch
Die schwarzen Reiter(11) 1999 veröffentlicht hat. Dabei wird die Frage nach der
Gerechtigkeit aufgeworfen, die, so die desillusionierende Feststellung, in den dreißiger und vierziger Jahren in der Ukraine weder von den Sowjets noch von den Nationalsozialisten zur Geltung kam. Im Gegenteil, während die Russen die Mennoniten in die Verbannung schickten, töteten Deutsche Zigeuner und Juden. Aushalten konnten David Regier und seine Mutter die selber erlebten Ungerechtigkeiten nur, indem sie sich an das Bibelwort „Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr" klammerten. Durch ihren Glauben an einen gerechten Gott gewannen sie die Kraft zur Nächstenliebe, die das Prinzip der
Wehrlosigkeit weit übertrifft.
4. Plautdietsche Jeschichten
Uns allen sind wohl die Bühnenstücke und Erzählungen von Arnold Dyck in plattdeutscher Sprache bekannt. Weniger bekannt sein dürften die plattdeutschen Gespräche und Interviews sowie die humorvollen Geschichten von Victor Peters und Jack Thiessen, die sie 1990 in einem Sammelband mit dem Titel
Plautdietsche Jeschichten. Gespräche-Interviews und Erzählungen herausgegeben haben. Peters, ein Historiker, und Thiessen, ein Germanist, kennen nicht nur die mennonitische Sprache, sondern auch die mennonitische Seele sehr genau. Sie verfügen über eine gute Portion Selbstironie, Witz und
Humor. Daher sind ihre Erzählungen leicht lesbar und kurzweilig. Zwei Auszüge bieten ich ihnen hier als Kostprobe an. Hier zunächst die Geschichte von Victor Peters. Sie heißt „Bitte, tjen Wotabad" und beschreibt die Erlebnisse, die er und Karl auf einer Reise in Kanada hatten:
„Nü wull wie en een Western Motel äwanachten, en se hauden uck ´ne Stoaw, oba _ blos eene Stoaw met eenem Bad. Etj froag, auf daut Bad groot wäa, en se säden sea groot. Oba _ daut Bad wäa een Wotabad. Karl tjitjt mie veblefft aun, en etj wißt uck nich. ´Na, waut sajchst?’ säd he. Karl en etj räden emma plautdietsch. Etj säd: ´Waut meenst Du?´He meend, he haud noch nienig opp’m Wotabad jeschloapen. Na, en etj haud uck nich. De Receptionist säd: ´Jie woaren schloapen so aus em Himmel’. Wie nauhmen de Stoaw met´m Wotabad.
Enne Stoaw sach etj mie daut Wotabad aun. Daut sach so aus `ne jewöhnliche Madrautz, blos daut se doa aunstaut Stroh oda Schümgum nenjeprommelt hauden, haude se daut met Wota vollrannen loten, en dann tojeneiht. En groot wäa et uck, ujefäa haulf so groot aus de Tabernakel en Steinbach. Rüm haud wie.
Karl jintj foats no siene Sauna en etj wull noch en bät TV tjitjen. Daut es sondaboa, wo daut met Hotels en Motels es. En Dietschlaund send de TVs irjentwoa hoch boawen, wo eena se meist nich sitt. En Amerikau send de emma opp’m Footenj vom Badd. Dann kaun eena biem liedjen schmock sehnen. Etj läd mie han en wull nü TV tjitjen. Oba donn fung etj üt, wiels etj opp’m Wotabad lach, daut doa aundre Deele von mienem Tjarpa veel schwanda send aus miene Feet. Miene Feet wäaren so hoach, daut se daut TV-Bild vedatjten. Na etj spreed se ütenaunda en sach nü aules. Teschen miene twee groote Teehen sach etj Präsident Bush, Elizabeth Taylor, Charles Bronson en uck Chomeni sien Boat paußt kratjt teschen."
(12)Jack Thiessens Geschichte „De Schwoata opp’em Schepp" ist eine Hochzeitsgeschichte besonderer Art. Darin wird das Eheleben mit einer Schiffsfahrt verglichen, wobei Gott der Kommandant und Jesus der Pilot ist. Doch manchmal kommt auch „de Schwoata", der Teufel, aufs Schiff und bringt alles durcheinander, so wie auf dieser Hochzeit:
„Peeta Reimasch Hauns wea langsom groot. Wann hee em Farjoa nom Besorje manke Jungend `romdwauld, dann sach’et am aus een Hohn. Hee muak een ditjen Koda, am schwoll de Kaum aun, enn wann hee to de junge Benjelns säd; ´Saul etj lud woare?’ dann hewelde see aula foats ut. Zeowents enn aum Sinndach haud Hauns witte Socke aun, enn sien Scholmtje wea mett Brylschmaund faustjebackt. Hauns deed sich uck mau selden – enn nie manki Mensche _ de Näs mett de Meiw wesche. Enn so kaum’et dann uck, daut Hiebats Neta boold to disem jleien Tjedel ´O.K.’säd. Aum Sinnowend sull’et Tjast jäwe. Nu stallt junt väa, Peeta Reimasch Hauns haud Schiz! Nich seea, saj jie? Vleicht nich, oba jenuach, daut am de Lempe flautade. ´Mei goodness’, säd de Reimasche, enn waut hee wea, de oola Reima, de säd: ´Dann woa wie mol seene!" enn gauf Hauns twee doppelde Stiewe.
Enn boold wea Hauns so brow, daut hee ären oolen Boll unjanähme wull. Hee fiehd äaren Hohn eent mett eenem Kluta, daut’a tjrempeld. Dann heiwd’a dän Schrootkauste so lud too, daut sich sogoa de oala Kunta vefead enn hee hassad jeajen daut Schetzel, daut de Speena fluage. Donn dreid hee de Säj den Zoagel drall enn jintj ´nen. Oba Hauns mußt nu doch no Tjoatj. Neta wudd aul wachte; hee mußt nu gohne. Waut hee vehäa to schiz jehaut haud, wea hee nu to brow. So brow enn äwabrestig wea hee, daut de oola Reima nu wada nom Atjschaup jintj enn Pelle väahold: Beruhigungspelle sull Hauns nehme; eene doppelde Portion. Daut deed’a enn nu jintj’et loos. See foare met’te Koa no Tjoatj; nich Hauns foa, nä, de oola Reima sad sich aum Stia enn spinnd loos. Boold weare see bie de Tjoatj _ aula straum enn opjeriemt – aunjekome.
Jo, enn Lied, nu hoolt junt faust, wiels… jo, wiels Hauns wea enjeschlope enn am wea nich wacka to tjriee. Se oakade aun am ´romm, Reima tjneep am aune Laj, oba Hauns wea enn bleef emm Pooselaunt! Na heat, waut wea daut tom bosse: doa stund de Brut utjestraumt enn aupetietlich aus’ne fresche Pastje, doa stunde de Baste-Manna enn tjammde sich enn weare iewrich aus Joalinja aum Diestel, doa tjichade de Brutmejalles enn wulle nu mol wiese, daut se uck enn bät for sale weare enn Hauns, de Brigaum…? Jo, Hauns schleep, enn schnoatjt enn brommd. De Uage weare too enn bleewe too. ´Mei, mei’, säd Taunte Reimasche enn dreid äa Schneppeldoak drall."
(13) Anekdoten, humoristische Erzählungen und Satiren
Mennoniten predigen und unterrichten gern, denn sie wollen andere belehren. In der Öffentlichkeit geben sie sich meistens ernst und wortkarg, in der kleinen Tererérunde hingegen wird geredet, fabuliert und manch einem Zeitgenossen etwas angedichtet. Da wird deutlich, dass sie durchaus ein Organ für unbeschwertes Lachen, für Witz und
Humor haben, vom Niveau einmal abgesehen. Bei Predigern und Missionaren kann man gelegentlich beim
Volksliederabend beobachten, wie sie über das ganze Gesicht strahlen und unbeschwert lachen, bis ihnen plötzlich bewusst wird, dass sie in der Öffentlichkeit sind und ihren Berufsstand würdevoll zu vertreten haben. Urplötzlich verändern sich die entspannten Gesichtszüge und verwandeln sich in die allvertraute Maske. Schade! Auch
Prediger und Missionare und erst recht die Lehrer brauchen Entspannung, unbeschwerte Freude und unkontrolliertes Lachen. Witz,
Humor und Satire besitzen oft mehr Tiefe und Wahrheit als gespielte Ernsthaftigkeit und zur Schau getragene Tiefgründigkeit. Der liebe Gott hat uns mit einem reichhaltigen Repertoire an Emotionalität ausgestattet, und wir sollten m. E. dieses uns anvertraute Pfund nicht vergraben.
Ich bin froh, dass ich Ihnen hier einige dieser im wahrsten Sinne des Wortes erfreulichen Kostproben servieren kann. Doch bevor ich damit beginne, will ich ihnen als guter
Mennonit erst einmal eine theoretische Rechtfertigung für mein Handeln liefern. Ich bin ja auch Lehrer, der normalerweise recht ernst dreinschaut. Wenn ich mal daraufhin angesprochen werde, sage ich sofort – quasi als Selbstverteidigung – dass das nur daran läge, weil ich so viel nachdenken müsse. Hier die etymologische Ableitung des Wortes „Witz" von dem sachkundigen Professor Lutz Röhrig, der da schreibt: „Das Wort ´Witz’ gehört zum Wortfeld ´Wissen’. Mittelhochdeutsch ´
witze‘meint etwas viel Allgemeineres als Witz, nämlich: Verstand, Wissen, Klugheit, Weisheit. ´Mit witzen’ bedeutet: verständig; ´úz den witzen kommen’: den Verstand, die Besinnung verlieren; ´ane
witze‘ ist ein dummer, törichter Mensch."
(14)
Nach diesen Worten aus berufenem Mund können Sie sich unbeschwert und mit gutem Gewissen an den folgenden Ankedoten, Erzählungen und Satiren erfreuen.
Ich beginne mit zwei Anekdoten, die der bekannte Professor und Gemeindeälteste Johannes Harder in seinem Alter gesammelt und zu Papier gebracht hat. Sie befinden sich in dem Büchlein mit dem Titel: Und der Himmel lacht mit. Heiteres von Theologen und Theolunken: Unter der Überschrift „Von Professoren und Konfessoren" befindet sich die folgende Anekdote:
„Sein alter Kampfgenosse Emil Brunner, der Züricher Systematiker, hatte sich überraschenderweise der ´Oxfordgruppenbewegung'(einer ideologischen ´moralischen Aufrüstung’) angeschlossen und soll sich als solcher Barth vorgestellt haben:
´Karl, ich bin ein neuer Mensch geworden!’
Darauf Barth: ´Ja, Emil, wenn das die anderen sagen würden!’"
(15)Unter der Überschrift „Aus dem Munde der Kinder…" findet sich folgende Anekdote:
„In Wuppertal ist ein auch psychologisch geschulter Lehrer darauf aus, bei Aussagen und Antworten der Schüler zu testen, aus welchen Elternhäusern sie kommen.
Thema: ´Unglück’.
´Was meint ihr, wie man einen solchen Fall nennt, wenn einer, der die Straße überquert, dabei unter ein Auto gerät und noch einmal halbwegs davonkommt?’
Die Hände fliegen nur so: ´Schwein gehabt!’
Ein zweiter: ´Dem Teufel von der Schippe gesprungen!’
Der dritte: ´Pech gehabt und noch kein Unglück!’
Einer sagt: ´Schicksal’; der fünfte: ´Es hat so sollen sein.’
Unser Psychologe versucht, daraus den geistigen und geistlichen Status der Familien zu ergründen; das ist schwierig in einer Gesellschaft, wo Worte zu Wörter und Gesinnung zu Redensarten umgemünzt sind.
Da meldet sich im nachhinein ein Sechsjähriger, und bei dem braucht man keine Überlegung: ´Alles falsch, Herr Lehrer! Es muss heißen: ´Das ist die unverdiente Gnade und Barmherzigkeit des himmlischen Vaters!’
´Schau mal an — Pfarrer?’
Der Junge reckt sich auf: ´Superintendent!’"
(16)Von Missverständnissen, die unter Menschen aus verschiedenen Ethnien und mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund aufkommen können, erzählt der bekannte Anthropologe Jash Leewe, der Anfang der sechziger Jahre hier im
Chaco war, aber vorher mehrere Jahre als Missionar in Kolumbien und Panamá gearbeitet hatte. Die Geschichte heißt: „Fonn Hunj, Muttash, en Indiauna doutschloone". Sie ist in seinem Buch
Onze ieaschte Missjounsreiz" 1996 erschienen ist.
Während Missjenoa Leewe seine neue Post durchsah, bemerkte er, dass sich vor dem Haus eine Menge Indianer versammelt hatten, die drohend ihre Flinten, Spieße sowie Pfeil und Bogen in den Händen hielten und aufgeregt hin und her liefen. Als Leewe herauskam, merkte er sofort, dass diese Drohgebärden ihm galten und ihm wurde die Situation sehr schnell klar:
„Mett ee’mol plautste däm fäashtên Indiauna disse Wiead rut, ´Hast du werkjlichj dienên Hunt dout jêshloage?’
´Joo!´shtundt ekj onnshuldichj tou. Ekj haud ferr’ne haulwe Shtund dem Noobash Hunt, dän wie enn’ne Kost jehaudt haude, noo’m Hunjshimmel jêshekjdt.
´Dann woa wie nu mett die Rozmak houle, eea du aul onz Indiauna aufmettsêlst!’
´Ekj zie’je jun Frindt! Wäa haft jünt zounên dommên Jedanke enn jêtrechtjtat, daut ekj dee Indiauna waut Shlachtêt aunddoune wudd?´ schmeet ekj an nu zelwstjêrachjt fäa.
´Du Piepakopp!’ shrieajê’me dee wuttje Indiauna aun. ´Daut ess’je gauns kloa! En Mensh de dän Hunt, dee daut Äte fonn zienêm Desh frat, enn kolldem Blout doutshloone kaun, dee ess’je dann uck emm Shtaund ziene ieajne Mutta äw´rem Humpêl tê halpe. Zounêm Mensch kjemmt’je daut Indiauna ommbringe nich Mool bott aun’ne kolde Kleeda. Nu ess daut kjlieakja wann wie fäabiejênde Medditsien aunwande ên die tê ieasht äw’rem Hupe halpe, dan kau’st du’je kjeene Indiauna auf mettsle.’
´Wacht ên Bätkje’, prachad ekj, ´Ekj woa junt daut aula errkkjläre."
(17)Hans Adolf Hertzler, langjähriger Pfarrer der
Mennonitengemeinde in Krefeld, hat eine spitze Feder, die Menschen wachrüttelt und erfreut. Er gibt im Vorwort zu seiner Sammlung von Glossen, Satiren und Sprüchen, die unter dem Titel
Kirchenspitzen im Jahr 2000 erschienen sind, folgende Begründung für die Herausgabe: „Mit meinen kleinen Texten, gerade mit den Satiren, bewahre ich mir die Utopie einer wahrhaft christlichen Kirche und einer Gesellschaft, die sich an Impulsen des christlichen Ethos orientiert. Indem ich die einzelne Satire entwickle, erinnere ich auf indirektem Weg an gute, überzeugende Lebensformen, die zu erreichen sich lohnen würden. Schreibe ich also, um bei mir oder bei anderen Veränderungen an Einstellungen oder Verhaltensweisen zu erreichen. Vielleicht." Hertzler lässt aber keinen Zweifel daran, dass er sich und andere mit diesen Satiren zum Lachen bringen will.
Hier ein Auszug aus seiner Satire über einen echten Mennoniten, mit der ich meine Ausführungen abschließen will:
„Ab und zu sprech’ ich mal mit ´nem älteren Mann, fast ein Herr eigentlich, der ist sich ganz sicher, dass er ein waschechter
Mennonit ist. In der Wolle gefärbt, sagt er immer und lacht fröhlich…
Mich wundert halt nur, sage ich manchmal ganz vorsichtig, dass ich Sie noch nie in unserer Kirche gesehen habe. Noch nicht einmal zu
Weihnachten. Ach, das wissen Sie doch inzwischen genau, sagt er dann immer, dass ich kein Kirchgänger bin. Halt ich nix von, ehrlich. Ist in meinen Augen alles Kokelores. Gott und so, Jesus, Maria und was weiß ich, also nicht mit mir. Ich bin doch Atheist, sagt er, immer gewesen. Aber Sie sind doch Mitglied hier in der
Gemeinde, wende ich hilflos ein, da müßte man doch erwarten … Ach was, unterbricht er mich, Sie machen sich da was vor. Da würde ich jede Wette mit Ihnen eingehen, dass ich nicht der einzige bin, nicht der einzige mennonitische Atheist.
Aber das ist doch ein Widerspruch in sich, sage ich dann jedesmal, ein
Mennonit ist doch so eine Art Christ, und Christen glauben an Gott und an Jesus Christus und setzen sich ein für ein christliches Leben … Ja, ja, sagt er, mach’ ich ja auch alles, das mit dem christlichen Leben, ich lebe wie ein Christ, wirklich, mehr oder weniger, was man halt so christlich nennt, genau wie meine ganze
Familie seit eh und je, wir sind ja mit allen irgendwie verwandt, wenn auch um sieben Ecken manchmal, aber wirklich mit allen besseren mennonitischen Familien, wie ich schon sagte, wirklich wir sind echte Mennoniten. Schade, dass es da heute so ein Durcheinander gibt, manchmal lese ich Namen im Gemeindebrief, sagt er, Namen von Mitgliedern, von angeblichen Mitgliedern, also, wenn Sie mich fragen, das ist nicht mehr echt. Die sind einfach so dazugestoßen, Namen wie aus dem Telefonbuch, halt irgendwelche Leute, einfach keine
Tradition…"
(18)Zum Schluss bekennt der Autor, dass er das Gespräch mit dem mennonitischen Herrn erfunden habe: „Einfach so. Darum ist es ja so wahr, wenn ich sage: Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen würden mich überraschen, wirklich, besonders in real existierenden mennonitischen Gemeinden."
(19)
Literaturverzeichnis
- Harder, Johannes: Und der Himmel lacht mit. Heiteres von Theologen und Theolunken, Herderbücherei: Freiburg im Breisgau 1982.
- Hertzler, Hans Adolf: Kirchenspitzen, Glossen, Satiren, Sprüche, Kümpers Verlag: Hamburg 2000.
- Klassen, Peter P.: Und ob ich schon wanderte … Geschichten zur Geschichte der Flucht und Wanderung der Mennoniten von Preußen über Rußland nach Amerika. Mennonitischer Geschichtsverein: Weierhof 1997.
- Klassen, Peter P.: Kampbrand und andere Geschichten aus dem paraguayischen Chaco, Asunción 1989.
- Klassen, Peter P.: Die schwarzen Reiter. Geschichten zur Geschichte eines Glaubensprinzips, Sonnentau Verlag: Asunción 1999.
- Leewe, Jash ( Loewen, Jacob A.): Onze ieashte Missjounsreiz ouda Waut je emma fonn´ne Missjoun weete wulle, ooba kjeena junt fêtale deed. Abbotsford, B. C., Canada, 1997.
- Loewen, Harry: No permanent City. Stories fom Mennonite History and Life, Herald Press: Waterloo 1993. Deutsche Fassung: Keine bleibende Stadt. Mennonitische Geschichten aus fünf Jahrhunderten, Kümpers Verlag: Hamburg 1995.
- Peters, Victor/Thiessen, Jack: Plautdietsche Jeschichten. Gespräche-Interviews-Erzählungen, N. G. Elwert Verlag: Marburg 1990.
- Röhrig, Lutz: Der Witz. Seine Formen und Funktionen. Mit tausend Beispielen in Wort und Bild, Deutscher Taschenbuch Verlag: München 1980.
- Spinner, Kaspar H: Vorschläge für einen kreativen Literaturunterricht, Diesterweg Verlag: Frankfurt am Main 1990.
- Tsepeneag, Dumitru: Hotel Europa. aus dem Rumänischen von Ernest Wichner, Alexander Fest Verlag: Berlin 1998.
- Wiebe, Rudy Henry: Peace shall destroy many, WM. B. Eerdmans Publishing Co.: Canada 1962.
- Wilpert, Gero von: Sachwörterbuch der Literatur, 5. Aufl., Alfred Kröner Verlag: Stuttgart 1969.
Fussnoten:
| |
| Spinner, Kaspar H.: Vorschläge für einen kreativen Literaturunterricht, Diesterweg Verlag: Frankfurt am Main, 1990, S. 9 f. |
| Wilpert, Gero von: Sachwörterbuch der Literatur, 5. Aufl., Alfred Kröner Verlag: Stuttgart, 1969, S. 440 |
| Tsepeneag, Dumitru: Hotel Europa. Aus dem Rumänischen von Ernest Wichner, Alexander Fest Verlag: Berlin, 1998, S. 175 f. |
| Loewen, Harry: No permanent City. Stories from Mennonite History and Life, Herald Press: Waterloo, 1993 |
| Ders.: Keine bleibende Stadt. Mennonitische Geschichten aus fünf Jahrhunderten, Kümpers Verlag: Hamburg, 1995 |
| Klassen, Peter P.: Und ob ich schon wanderte… Geschichten zur Geschichte der Flucht und Wanderung der Mennoniten von Preußen über Russland nach Amerika. Mennonitischer Geschichtsverein: Weierhof, 1997, S. 285 f. |
| Wiebe, Rudy Henry: Peace shall destroy many, WM. B. Eerdmans Publishing Co. Grand Rapids, 1962 |
| |
| ebd., S. 27 f. |
| Klassen Peter P.: Die schwarzen Reiter. Geschichten zur Geschichte eines Glaubensprinzips, Sonnentau Verlag: Asunción, 1999 |
| Peters, Victor/Thiessen, Jack: Plautdietsche Jeschichten. Gespräche – Interviews – Erzählungen, N. G. Elwert Verlag: Marburg, 1990, S. 213 f. |
| ebd., S. 266 f. |
| Röhrich, Lutz: Der Witz. Seine Formen und Funktionen. Mit tausend Beispielen in Wort und Bild, Deutscher Taschenbuch Verlag: München, 1980, S. 4 |
| Harder, Johannes: Und der Himmel lacht mit. Heiteres von Theologen und Theolunken, Herderbücherei: Freiburg im Breisgau, 1982, S. 74 |
| ebd., S. 32 |
| Leewe, Jash (Jacob A. Loewen): Onze ieashte Missjounsreiz ouda Waut je emma fonn´ne Missjoun weete wulle, ooba kjeena junt fêtale deed. Abbotsford, B.C., Canada, 1997, S. 72 f. |
| Hertzler, Hans Adolf: Kirchenspitzen. Glossen, Satiren, Sprüche, Kümpers Verlag: Hamburg, 2000, S. 156 f. |
| ebd., S. 158 |
Peter P. Klassen
1. Einführung
Von den Anden strömten ungeheure Wassermassen in die riesige Senke, die man später den Chacotrog genannt hat. Zu Tal flossen die Schmelzwasser der mächtigen Eismassen, die sich hier in den Falten des Gebirges als Eisfelder und Gletscher während der letzten großen Eiszeit, angesammelt hatten. Das war vor etwa zwanzigtausend Jahren.
Eine Warmzeit hatte wieder einmal eingesetzt, und in den Schüben der Jahreszeiten strömten größere oder kleinere Wassermengen zu Tal. In dem starken Gefälle der Hänge des Gebirges rissen sie viel Material mit sich. Das schwere Geröll blieb am Fuß der Anden liegen, und die leichten Sande, Tone und den Löß trugen sie weiter in die Ebene hinein und füllten sie langsam auf.
Hier im Tiefland bildeten sich regelrechte Ströme, in einer Breite von einem oder auch mehr Kilometern. Der Lauf war bei dem geringen Gefälle träge, und die etwas schwereren mitgeführten Sande lagerten sich bei kleineren Stauungen, die schon durch eine Bodenschwelle zustande kommen konnten, ab. Mit den Jahren, staute sich der Wasserlauf auf diese Weise durch seine eigenen Ablagerungen immer stärker nach rückwärts und versperrte sich so seinen eigenen Weg. Diese Stauungen, riesigen Sandbänken gleich, konnten viele Kilometer lang werden, zehn, zwanzig und mehr. Bei dem ständig nachdrängenden Wasser, das dann seitwärts vorbeifließen musste, reihten sie sich nach rückwärts aneinander, oft verbunden durch schmale Schneisen.
Mehrere solcher Urströme flossen gleichzeitig nebeneinander durch die Ebene des so entstehenden
Gran Chaco, in Abständen von zwanzig, dreißig Kilometern, alle von Nordwesten nach Südosten, dem Gefälle folgend. Was wir heute davon sehen sind die Sand- oder Hochkämpe, richtige Parklandschaften, die die mennonitischen Einwanderer suchten, als sie ihre Dörfer anlegen wollten. Langgestreckt wie diese Kämpe waren dann auch ihre Siedlungen, und auf einer Luftaufnahme erscheinen sie wie Ketten, angepasst an jenen geologischen Vorgang nach der letzten Eiszeit.
Zwei dieser großen Urströme sollen für uns hier interessant werden, weil sich gerade hier, nachdem die Menschheitsgeschichte in diesem Raum begann, so viel abgespielt hat.
Auf einem dieser sandigen Landrücken liegen heute die Dörfer Waldesruh, Friedensfeld, Wiesenfeld, Gnadenheim, Schönfeld, Schöntal, Osterwick, Rosental,
Reinfeld, Vollwerk und Neuanlage. Auf einem weiteren Rücken, etwa zwanzig bis dreißig Kilometer weiter südlich, liegt wieder eine Dörferkette: Neuhalbstadt,
Lichtenau, Gnadental, Neuendorf, Landskrone, Hohenau, Blumental,
Yalve Sanga und
Pozo Amarillo.
Um von dem nördlichen Landrücken zum südlichen zu gelangen, mußte man einen breiten Buschstreifen durchqueren, dessen Böden aus schwerem Lehm oder Ton bestehen. Dieser Streifen
macht heute, verglichen mit den Hochkämpen, den Eindruck einer Niederung, obwohl die Höhenunterschiede gering sind. Nach dem vorherrschenden Baumbestand werden sie als Palosanto Niederung oder Paloblanco Niederung bezeichnet.
Diese Lehm-, Ton- und Lössböden sind Ablagerungen von feinkörnigem Material. Zwischen den nun etwas höher liegenden Sandablagerungen war der Lauf der immer noch von den Anden herabfließenden Gewässer sehr langsam, oder sie blieben oft über längere Zeiträume überhaupt stehen. Dabei lagerte sich das feinste Material, das von den Anden mitgeschleppt wurde, schichtenweise ab. So entstanden hier schwere, gelbliche Lehmböden oder auch dunkle bis zu schwarzen Tonböden.
Da diese Landstriche mit schweren Böden etwas tiefer liegen als die Sandkämpe, floss hier auch in späteren Zeitperioden das Wasser eines regenreichen Sommers langsam nach Osten ab. So ist es bis heute geblieben. Eine merkwürdige Erscheinung dabei sind immer wieder Bodensenken, in denen das Wasser zurückbleibt. Der Boden ist hier so undurchlässig, dass diese Wasserstellen, später auch Lagunen genannt, das Wasser oft bis in den späten trockenen Winter hinein behalten.
Die Vegetation in dem nun mehr oder weniger fertigen
Chaco folgte der Periode der alluvialen Ablagerungen, und sie passte sich einmal den klimatischen Verhältnissen an, dann aber auch den Gegebenheiten der Bodenbeschaffenheit. Während sich auf den sandigen Kämpen eine richtige Parklandschaft entwickelte, mit Fluren von
Bittergras, einzelnen Sträuchern und großen Bäumen, bedeckten sich die fruchtbareren Lehm- und Lössböden dazwischen mit dichtem niedrigen Busch, verschiedenen Kakteenarten und einzelnen höheren Bäumen.
Die Senken, in denen das Wasser bis in den Winter stehen blieb, entwickelten ein besonderes Biotop. Das Wasser verhinderte den Wuchs von Bäumen und Sträuchern in der Senke, ließ aber am Rand einen Kranz üppiger Vegetation zu. Beim Rückgang des Wassers in der trockenen Jahreszeit bedeckte sich die Fläche mit Gräsern.
Man hat diese kleinen grünen Auen mitten im dichten Chacobusch später auch Wasserkämpe genannt. Sie haben dann, als die Geschichte der Menschen in diesem Raum begann, eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Das Wasser dieser Lagunen sicherte den Indianern über viele Monate im Jahr die Existenz in ihren Jagdgründen, und sie bauten hier am Ufer der Lagunen ihre Grashütten. Später, als die Paraguayer und Bolivianer den Streit um das unerschlossene Gebiet des
Chaco, in dem es noch keine festgelegten Grenzen gab, begannen, suchten auch sie gerade diese Wasserstellen, um hier ihre militärischen Stützpunkte anzulegen. Auch die eingewanderten Mennoniten erkannten bald den Wert dieser tonigen Senken. Wenn sie tief ausgebaggert wurden, konnte man hier Wasserreserven für das Vieh für ein ganzes Jahr anlegen.
Einige dieser Lagunen haben in der neueren Zeit politische Bedeutung erlangt. Ungefähr auf der Mitte der Strecke zwischen den oben beschriebenen Höhenrücken lag so eine grüne Aue, die, nach einem Indianerhäuptling benannt,
Kazike Carayá hieß. Etwa fünfzig Kilometer weiter nach Osten in der gleichen Bodensenke liegt eine weitere Aue, die den Namen
Kazike Ramón und später Isla Po’i erhielt. Über den Landrücken hinweg, etwa fünfzig Kilometer nach Süden hin, erhielt eine dritte Aue Bedeutung. Sie ist unter dem Namen
Boquerón bekannt geworden. Diese Namen wurden während der kriegerischen Auseinandersetzungen mit Menschenblut geschrieben, und sie waren nur die ersten einer langen Reihe blutiger Namen in dieser über lange Zeiträume so friedlich entstandenen Ebene.
Doch Leben gab es hier schon lange, ehe der Mensch seinen Fuß auf die abgelagerten Schichten des
Chaco setzte. Die Saurier, die über lange Zeitperioden das Leben auf unserem Planeten bestimmten, hatten auch dieses Tiefland erreicht, und sie scheinen sich hier wohlgefühlt zu haben.
Ein häufig auftretendes Tier war das Glyptodon, ein Riesengürteltier. In mehreren Arten von unterschiedlicher Größe und verschiedenem Aussehen bevölkerte es die weite Chacoebene von der südlichen Pampa bis an die Gebirgszüge von Chiquitos im Norden. Sie waren bis zu zwei Meter lang und einen Meter hoch, bewehrt mit einem starken Panzer. Bei manchen endete der Schwanz in einer kugelartigen, stachelbewehrten Keule. Als eines von ihnen in der Senke zwischen den genannten Höhenrücken in der Nähe des späteren
Carayá Nahrung suchend stapfte, wurde es von Wassermassen, die immer noch periodisch von den Anden strömten, überrascht. Es ertrank, und die Lehm- und Lössmassen schwemmten es ein und deckten es zu. Schicht auf Schicht, drei Meter hoch, lagerte sich dann im Lauf der Jahrtausende darüber.
Neben den Gürteltieren trat hier auch eine Elefantenart auf, das Mastodon. Seine Stoßzähne steckten im Unterkiefer und waren nach unten gerichtet. Auch diese schwer bewaffneten Riesen wurden manchmal von Fluten überrascht, eingeschwemmt und luftdicht abgeschlossen, so dass ihre Knochen versteinerten. Eines von ihnen ereilte solch ein Schicksal in der Nähe des heutigen Bahía Negra. Auch riesige Raubtiere soll es hier in jener Zeit gegeben haben. Wissenschaftliche Werke zeigen Bilder vom Säbelzahntiger, dem Smilodon, der mit seinen riesigen Reißzähnen wohl auch einen Riesenelefanten anfallen konnte.
Die Riesen starben aus, und nur wenige Reste von ihnen sind übriggeblieben. Kleinere Verwandte folgten ihnen in späteren Perioden, Gürteltiere und Ameisenbären in mehreren Variationen und in großer Zahl die Pekaris, die Spießhirsche und anderes Wild. Sie wurden die Nahrungsgrundlage sowohl für die Raubtiere wie Jaguar und Puma als auch für die später eingewanderten Menschen.

Eines von den Pekaris, das
Taguá, gab den Wissenschaftlern Fragen auf. Einige der Forscher, die es mit versteinerten Funden verglichen, meinten, in ihm eines der ausgestorben geglaubten Urtiere, das Catagonus wagneri, entdeckt zu haben. Andere widersprachen diesem Forschungsergebnis. Die Indianer, die dann Jagd auf diese Pekariart machten, kümmerte der wissenschaftliche Streit wenig. Für sie war das
Taguá eine beliebte und lohnende Beute.
Ein Rudel Pekaris wühlte wohlig im Uferschlamm der Lagune, die die Lenguas, ein Indianerstamm, dem dieses Jagdgebiet gehörte, Popyit Amyip nannten, was
Kamp der Spießhirsche bedeutet. Der Keiler von enormer Größe, denn es waren Taguás, verschwand fast in der aufgewühlten Brühe, während sich die Frischlinge um einige Bachen drängten.
In dem Moment, als sich der Keiler bis zur halben Höhe aus dem Schlamm hob und heftig schnaufte, warf er sich plötzlich fast kerzengerade in die Höhe und sank rückwärts in den Schlamm zurück. In seiner Seite steckte ein Pfeil, der sein Herz durchbohrt haben musste. Schon schwirrte ein zweiter Pfeil, und eine der Bachen stieß ein fauchendes Bellen aus. Der Pfeil hatte etwas zu weit nach vorn getroffen, auf das harte Blatt, wo er stecken blieb. Das ganze Rudel war im Nu fauchend und quiekend im nahen Busch verschwunden.
Aus dem Dickicht am gegenüberliegenden Ufer wand sich eine braune Gestalt. Sie erhob sich, atmete tief durch, und die Morgensonne ließ den Schweiß auf dem muskulösen Körper glänzen. Es war Hakuk, der Häuptling eines Clans der Lenguas, die unweit auf dem großen Bittergraskamp ihre Grashütten gebaut hatten. Eigentlich hieß er Hakuk Kinik-Piyim. Das heißt, der Waisenknabe, dessen Vater von den
Ayoreos erschlagen wurde. Doch alle nannten ihn einfach Hakuk.

Hakuk führte seit Kurzem einen Doppelnamen. Paraguayische Soldaten, die Volay, die seit einiger Zeit in dieser Gegend auf Patrouille ritten, hatten ihn
Kazike Carayá genannt, vielleicht seiner etwas gedrungenen Gestalt und seiner Wendigkeit wegen. Außerdem war er zu Späßen aufgelegt, wenn man sich mit ihm einließ.
Carayá ist der Guaraniname für den Brüllaffen der dichten Laubwälder Ostparaguays. In den Trockenwäldern des
Chaco kommt er selten vor, und Hakuk kannte die Bedeutung seines neuen Namens sicher nicht.
Der Häuptling ging gemessenen Schrittes zu seiner Beute. Der Keiler rührte sich nicht mehr, und Hakuk zog ihn mit einiger Anstrengung aus dem Schlamm in das saubere Wasser. Eigentlich hätte er ihm gleich die Stinkdrüse aus dem Rücken schneiden müssen, denn das war jedesmal die erste Handlung des Jägers. Ein erlegtes Pekari verbreitet sonst einen penetranten Geruch, der sich auch auf das Fleisch überträgt.
Doch Hakuk horchte gespannt in den Busch, ob die getroffene Bache einen Laut von sich gab. Dann folgte er der Fährte einige Meter weit in das Dickicht, bis die stacheligen Caraguatá ihm den Weg versperrten. Wahrscheinlich hat der zweite Schuss nur leicht getroffen, überlegte er, und das Rudel ist längst im tiefen Dickicht verschwunden. Hakuk trauerte weniger um die verlorene Beute als um seinen Pfeil, der sicher stecken geblieben war und nun unauffindbar irgendwo im dichten Busch liegen bleiben würde.
So ein Pfeil war schwer zu ersetzen. Es war ein ganz modernes Gerät, viel besser als jene Pfeilspitzen aus Hartholz, deren Herstellung allerdings ebenfalls viel Mühe kosteten. Doch die beiden Pfeile, mit denen er auf Pekarijagd gegangen war, hatte er aus den Klingen von Stahlmessern gemacht. Messer aus Stahl konnte man im Tauschhandel erwerben. Indianer anderer Stämme, die näher am großen Fluss wohnten, kamen gelegentlich bis hierher und boten diese schönen Klingen gegen Felle des Ozelot oder auch für ein gutes Bündel Straußenfedern an. In neuerer Zeit, seit die berittenen Soldaten vorbeikamen, boten auch sie feine Messer an, doch sie wollten keine Felle oder Federn dafür haben, sondern eins der Mädchen. Wenn die Volay nicht gewalttätig waren, gingen die Lenguas auch auf solch einen Handel ein.
Wunderschöne Sachen fanden so ihren Weg zu dem Clan an der Spießhirschlagune, Äxte aus Eisen zum Beispiel, mit denen sich so viel besser die Honigwaben aus dem harten, hohlen Stamm des Quebracho hacken ließen. Das war längst nicht so mühsam wie mit dem Steinbeil, das Hakuks Vater ständig in seiner Jagdtasche getragen hatte. Auch das Steinbeil war ein kostbarer Tauschartikel gewesen. Indianer, die weit aus dem Westen gekommen waren, vom Rand des großen Gebirges, brachten diese feingeschliffenen Geräte mit. Dort musste es Steine im Überfluss geben, Steine, die man in der weiten Ebene des
Gran Chaco nicht fand. Manches Schöne und Brauchbare war so ins Grashüttendorf der Lenguas gekommen, auch wunderschöne Glasperlen oder ein Stück feines Tuch oder ein Filzhut. Am Lagerfeuer auf dem Platz im Rund der Hütten drehte sich das Gespräch an den Abenden oft um all diese Kostbarkeiten, und die Jagd auf Ozelote, Pekaris oder Strauße hatte nun auch Handelswert bekommen.
An dem Pfeil, dem Hakuk nun nachtrauerte, hatte er viele Tage mühsam gearbeitet. Er hatte die Klinge aus dem Griff des Messers gelöst und ihr dann eine andere Form gegeben. In mühsamer Schleifarbeit auf einem Stück Sandstein, das schon sein Vater im Tauschhandel erworben und ihm geschenkt hatte, bekam die Klinge allmählich die Form einer Pfeilspitze, etwa zwanzig Zentimeter lang. Die nun lanzettförmige Klinge wurde sorgfältig in ein Bambusrohr eingefasst. Mit Wachs und Garn wurde die Befiederung angebracht, und dann war so ein Pfeil eine Waffe, mit der man nicht nur einen Keiler wie diesen hier erlegen konnte, sondern auch einen Jaguar. Das war am besten möglich, wenn die Hunde das Raubtier auf einen Baum gehetzt hatten. Dann legte sich Hakuk auf den Rücken, stemmte beide Füße gegen den langen Bogen, fasste den Pfeil mit beiden Händen, und der Druck der starken Sehne genügte, um einen Jaguar zu durchbohren.
Der kostbare Pfeil war verloren. Hakuk wandte sich seiner Beute zu. Er wusch ihr den Dreck von der Schwarte und schnitt mit seinem scharfen kleinen Messer, das immer hinter dem Gürtel aus Tapirhaut steckte, die Stinkdrüse aus dem Rücken. Dann weidete er das Tier aus, band ihm die Beine mit einer festen Schnur aus Caraguatáfasern zusammen, und hängte es sich über die rechte Schulter. Hakuk war stark genug, um so eine schwere Jagdbeute die fünf Kilometer durch den Busch bis zu den Grashütten zu tragen.
Die Frauen und Kinder im Dorf stimmten ein Jubelgeschrei an, als sie Hakuk in der Ferne am Rand des Busches auftauchen sahen. Die halbwüchsigen Jungen liefen ihm entgegen und nahmen ihm den Keiler von der Schulter. Sie hängten ihn über einen starken Stecken, und zwei von ihnen trugen die Last bis zu den Hütten.
Dort herrschte frohe Stimmung, weil die Versorgung des Clans wieder für zwei Tage gesichert war. Womöglich brachten die Männer, die sich in den weiten Graskamp auf die Jagd begeben hatten, einen Spießhirsch mit oder doch Gürteltiere oder Leguane, die noch schmackhafter waren als das zähe Fleisch eines alten Keilers.
Die Versorgungslage im Sommer war gut. Der kleine Acker auf dem lockeren Sandboden in der Nähe der Hütten lieferte Süßkartoffeln und Kürbisse, und die Frauen brachten vom Ufer der Lagune reichlich Wasser und die nahrhaften Schoten des Algarrobo, einer Akazienart, die den Wasserkamp wie ein grüner Kranz umgab. Auch die Früchte der verschiedenen Kakteen füllten ihre Taschen. Alles trugen sie auf oder mit dem Kopf, die Tonkrüge mit Wasser und die schweren Tragetaschen an einem breiten Band. Wenn die Frauen dann reich beladen zu den Hütten kamen, herrschte nicht geringere Freude als bei der erfolgreichen Heimkehr der Männer von der Jagd.
Im Winter allerdings, wenn die Lagune allmählich austrocknete, die Pekari Rudel sich weiter nach Osten verzogen und der Boden nichts mehr lieferte, konnte es hart werden. Dann musste sich der Clan auf Wanderschaft begeben, auf die Suche nach den letzten Wasserstellen, die oft noch versteckt im dichten Busch zu finden waren. Dann waren nur noch Kleintiere zu erlegen, Schlangen und Eidechsen, und die Bromeliendickichte bargen in ihren harten Kelchen, die ins Feuer geworfen wurden, einige Vitamine. Es ging dann ums Überleben, und die Lenguas hatten in den weiten Graskämpen und Buschstrecken ihrer Jagd- und Sammelgebiete die entsprechende Strategie entwickelt.
Für die Alten und Kranken konnten diese
Wanderungen der Winterzeit dann allerdings zum Verhängnis werden. Sie mussten, wenn sie zu schwach waren, einfach zurückgelassen werden oder, und das war das gnädigere Verfahren, man tötete sie mit einem Schlag auf den Schädel. Auch die
Familienplanung war ein hartes, aber unverzichtbares Mittel der Überlebensstrategie. Nur zwei Kinder konnte eine Mutter mit auf die Wanderung nehmen, eines in der Tragetasche und eines an der Hand. Der Mann mit den Waffen musste für den Schutz der Wandernden und für die Jagd frei bleiben. Die unerwünscht Geborenen mussten deshalb gleich nach der Geburt getötet werden.
Hakuk saß vor seiner Hütte und war des Lebens zufrieden. Er blickte auf seinen etwa siebenjährigen Sohn, der sich mit einem kleinen Bogen, den er für ihn gemacht hatte, im Zielschießen übte. Die Jahre wurden bei den Lenguas nicht gezählt, und auch einen Namen hatte der Junge noch nicht. Beides war vorerst unwichtig. Die Jahre kamen und gingen, wie die Sommer mit dem reichlichen Wasser und den Algarroboschoten, und einen Namen bekam der Mensch erst dann, wenn ein besonderer Umstand dazu Anlass gab. Sie nannten ihn einfach Sepe, das heißt Junge. Manchmal, wenn man ihn genauer bezeichnen wollte, hieß er auch Apviski Apkitka, das heißt Sohn des Häuptlings. Später, als er schon erwachsen war, hieß er Kintem, weil er sich einmal ein Bein gebrochen hatte. Er war auf einen Baum gestiegen, um Honig aus dem hohlen Stamm zu hacken. Dabei war er abgestürzt.
Das Fleisch des Keilers war am Spieß gebraten worden, lange und langsam, bis es schön weich wurde. Nach der Jagd gab es keine Hast. Die Süßkartoffeln wurden währenddessen in der heißen Asche gebacken, ebenso lange und langsam, und nun zog der Duft der reichlichen Mahlzeit durch die Grashütten. Er lud alle ein, und keiner blieb je hungrig, wenn die Jagdbeute ins Lager gebracht worden war.
Plötzlich schlugen die Hunde an. Die wachsame Meute scharte sich zusammen und stürmte aus dem Lager nach Westen hin. Die Männer erhoben sich und blickten in die Richtung, in die die Hunde immer wütender kläfften. Ganz fern auf dem offenen
Kamp konnte man Reiter ausmachen, die sich langsam näherten. Ein Warnruf des Häuptlings, und alle Frauen und Mädchen verschwanden in den Hütten.
Als die Reiter sich näherten, beschwichtigten die Männer ihre Hunde, und Hakuk trat vor. Es waren keine Volay, das sah er auf den ersten Blick. So große Maultiere hatten die Grünuniformierten nicht. Die graugelbe Kleidung und die Schirmmützen wiesen andere Soldaten aus. Doch eines war gleich, jene wie diese hier trugen Gewehre, Patronengurte und noch andere Waffen.
Es waren vier Reiter, und Hakuk sah, dass fern am Buschrand noch mehr stehen geblieben waren. Der Erste, wohl der Häuptling, wie Hakuk mutmaßte, stieg ab, kam auf ihn zu und reichte ihm die Hand. „
Kazike Carayá", sagte er freundlich und klopfte ihm auf die nackte Schulter. Diese Männer kannten ihn, und das war Freude und Schrecken zugleich.
Kazike Carayá, so hatten ihn die Volay genannt, und nun war sein Name also auch im Westen, bei den andern, bekannt. Doch dann überwog der Schrecken den eben aufgestiegenen Stolz. Was wollten diese fremden und schwerbewaffneten Männer von ihm?
Die Verständigung war nur durch Zeichen möglich, doch Hakuk verstand bald, dass es um ihre Lagune ging, und was noch schlimmer war, dass diese Männer hier bleiben wollten. Ihm blieb nichts anderes übrig, als hilflos zu nicken, wenn der fremde Häuptling eine Frage stellte. Der sprach dann wieder mit seinen Leuten, und alle nickten und lachten und zeigten in Richtung des Wasserkamps, der bis dahin und in all den erdenklichen Zeiten Popyit Amyip geheißen und ihnen, den Lenguas, gehört hatte. Lachend und grüßend bestiegen der Offizier und seine Männer ihre Maultiere. Alle wendeten, und dann galoppierten sie auf den Buschrand zu, wo eine Kompanie bolivianischer Soldaten wartete, bewaffnet mit Karabinern und Maschinengewehren. Alle verschwanden dann in langer Reihe auf dem engen Pfad im Busch, der hinunter zur Lagune führte.
Langsam kamen die Frauen und Kinder wieder aus den Hütten und schauten verstört in die Richtung, aus der der unerwartete Einbruch gekommen war. Die Hunde hörten nicht auf zu kläffen, und die Männern hatten den Appetit verloren. Die Sonne neigte sich langsam in die Richtung, aus der die Soldaten in den Khakiuniformen gekommen waren.
Das war im November 1928.
Der fremde Häuptling, der Hakuk in Verlegenheit gebracht und in Schrecken versetzt hatte, war Hauptmann Abel Florentín aus La Paz. Er hatte nichts weiter getan, als den Befehl ausgeführt, der vom Oberkommando im
Fortín Muñoz erteilt worden war. Er sollte einen Vorposten 40 Kilometer nördlich von
Boquerón und 50 Kilometer westlich von Isla Po’i, zwei paraguayische Befestigungen, anlegen. Die schöne Lagune hatte eine Patrouille ausgemacht. Der schon legendäre Hauptmann Victor Ustarez, ein verwegener Buschläufer im
Chaco seit Jahren, hatte insgeheim alles bis in die Einzelheiten untersucht, und er hatte auch erfahren, dass die Paraguayer den Häuptling Hakuk
Kazike Carayá nannten. Alles war wichtig bei dem langsamen, aber gezielten Vordringen nach Osten. Mit der Besetzung dieser Lagune hatte die bolivianische Heeresleitung eine Faust in die gegnerische Verteidigungslinie geschoben.
Das bolivianische Oberkommando in Muñoz, in der Nähe des Rio Pilcomayo, war dabei, seine militärischen Stützpunkte möglichst unauffällig aber stetig nach Osten in Richtung des Paraguayflusses vorzuschieben, in ein Territorium, auf den es vom historischen Standpunkt aus meinte Anspruch erheben zu können. Der eigentliche Grund waren aber geopolitische Ziele. Der eroberte
Chaco sollte den Zugang zum Rio
Paraguay und damit zum Atlantischen Ozean sichern.
Die Regierung von
Paraguay hatte das gleiche strategische Ziel, nur in entgegengesetzter Richtung. Sie hielt den ganzen
Chaco Boreal, wie man den nördlichen Teil der großen Ebene nannte, bis an den Rio Parapití für ihr historisches Erbe. Die entdeckten Erdölvorkommen am Andenrand spielten dabei auf beiden Seiten eine bedeutende Rolle. Nun verzahnten sich die strategischen Maßnahmen bereits, und die militärischen Stützpunkte, Fortines genannt, rückten einander stellenweise gefährlich nahe.
Hauptmann Florentín, Absolvent der Militärschule in La Paz, hatte einen langen Weg hinter sich, als er auf die Grashütten des
Kazike Carayá, dessen Name bereits in die Strategie eingeplant worden war, traf. Sein Regiment hatte den Auftrag, die Positionen im
Chaco zu verstärken. Vom Fuß der Anden in Villa Montes, wo das Regiment seinen Standort hatte, war Hauptmann Florentín mit seiner Kompanie von Stützpunkt zu Stützpunkt dem Lauf des Rio Pilcomayo gefolgt, überzeugt davon, seinem Vaterland und einer guten Sache zu dienen. Er sah, wie seine Soldaten, meist Hochlandindianer, unter dem herben Klimawechsel litten. Sie kamen aus der dünnen, kühlen Luft des Altiplano unvermittelt in die heiße, dornige Chacoebene. Doch Hauptmann Florentín war ein guter Vorgesetzter. Er verstand es, seine Untergebenen zu ermutigen und sie davon zu überzeugen, dass der
Chaco bolivianisches, von
Paraguay bedrohtes Territorium sei.
Die Tieflandindianer, die in diesem Raum lebten, hatten für die strategische Planung auf beiden sich nun feindlich gegenüber stehenden Seiten keine Bedeutung. Sie waren nicht viel wichtiger als das Wild dieser Gegend. Sie konnten allerdings gelegentlich für die Kundschaft eingespannt werden, denn sie waren die besten Kenner ihrer weiträumigen Jagdgebiete. Die Indianer wussten, wo die dauerhaften Wasserstellen waren, und sie durften sich nicht weigern, die Patrouillen zu führen. So war auch die Begegnung mit
Kazike Carayá, so freundschaftlich Hauptmann Florentín es auch meinte, eine bloße zweckbedingte Formalität.
Hakuk und einige seiner Männer schlichen in der Dämmerung des nächsten Morgens an ihre Lagune Popyit Amyip. Sie blieben im Gebüsch versteckt stehen. Am gegenüberliegenden Ufer stellten sie emsiges Treiben fest. Einige Soldaten hatten als erstes einen schlanken Paloblanco gefällt, ein dreifarbiges Tuch, rot, gelb und grün, daran gebunden und den Mast aufgerichtet. Hakuk erkannte, dass es die gleichen Farben waren, die er an der Schirmmütze des fremden Häuptlings gesehen hatte. Zelte waren am Ufer der Lagune aufgestellt worden. Der Busch hallte wider von Axtschlägen. Dort wurden Bäume gefällt, und am Buschrand wurde ein Graben ausgehoben.
Hier würden keine Pekaris mehr an die Lagune kommen, und keine der Frauen würde sich hierher wagen, um die Tonkrüge mit Wasser zu füllen. Das war die realistische Schlussfolgerung des Häuptlings Hakuk. Schweigend zog er sich mit seinen Männern zurück. Als sie wieder bei den Grashütten waren, fiel eine schnelle Entscheidung.
„Wir müssen hier weg", sagte Hakuk zu seinen Leuten. Zum Aufbruch brauchten Sie nicht mehr als eine halbe Stunde. Im Nu hatten die Frauen ihre Habseligkeiten in den großen Tragetaschen verstaut, die Felle, die als Bodenmatten dienten, eingerollt und die Kinder an sich genommen. Die Männer nahmen ihre Waffen, und die Wanderung konnte beginnen, nach Osten hin, weg aus der Richtung, aus der diese Reiter gekommen waren.
Sie wanderten, wie sie immer gewandert waren, wenn die Not sie trieb, wenn die Lagune leer war, wenn die Jagd nicht mehr lohnte, wenn die Umgebung der Grashütten verschmutzt war oder wenn eine Gefahr drohte. Sie wanderten in langer Reihe auf den engen Pfaden, die sie gut kannten, durch Busch und
Kamp, vornan Hakuk und einige Männer, dann die Frauen, vornüber gebeugt, das Trageband der schweren Taschen mit aller Habe über dem Kopf, obenauf das kleinste Kind, und hinten in der Reihe wieder bewaffnete Männer.
Sepe, Hakuks ältester Sohn, den sie später Kintem nannten, lief vorne neben seinem Vater her. Er war stolz auf seinen Vater, den starken Mann, der den Clan führte, und ehrfurchtsvoll schaute er auf die scharf geschliffenen Pfeile im Gürtel und den langen starken Bogen. Sein Vater hatte ihm eine Bogenschleuder gemacht, einen Bogen mit einer Doppelsehne, in die seine Mutter eine Schlaufe eingeknüpft hatte. Mit Kugeln, aus Ton gedreht, konnte er so auf Täubchen und Eidechsen schießen und damit einen Beitrag für die Ernährung leisten.
Drei Tage dauerte der Marsch, dann erreichten sie wieder eine Lagune, die in derselben Bodensenke lag wie Popyit Amyip, ziemlich weit im Osten, in der Nähe jener großen und wasserreichen Lagune, die die Volay, die Reiter in den grünen Kleidern,
Kazike Ramón genannt hatten, nach dem Lenguahäuptling dieser Gegend. Dass sie inzwischen den Namen Isla Po’i bekommen hatte und ein befestigtes Heerlager geworden war, erfuhren Hakuk und seine Männer erst einige Tage später auf einem Streifzug, auf dem sie den Wildbestand der Gegend untersuchen wollten.
Kazike Carayá wurde in Isla Po’i freundlich begrüßt und mit Fragen überschüttet. Hakuk begriff ungefähr, was die Volay von ihm wissen wollten, und er gab Auskunft, so gut er konnte. So erfuhr das paraguayische Oberkommando, dass die Bolivianer die Lagune
Kazike Carayá, wie sie inzwischen in die Kartenskizzen von diesem Gebiet eingetragen worden war, besetzt hatten und auch, wie stark die Einheit war.
Die Lagune, an der Hakuks Clan wieder seine Grashütten gebaut hatte, war wunderschön. Sie war groß und rund, und in der Mitte lag eine kleine Insel. Die Paraguayer waren bereits da gewesen, und sie hatten ihr den Guaraninamen Curucao gegeben. Doch Hakuk fühlte sich hier vorerst unbehelligt. Noch am Tag der Ankunft hatten die Frauen die Hütten fertiggestellt. Sie lehnten große Äste aneinander und warfen dann Büschel von
Bittergras darüber, so lange, bis ein dichtes Dach entstand. Den Boden bedeckten sie ebenfalls mit Gras, und darauf legten sie die gegerbten Felle vom Spießhirsch. Es war wieder wie bei der Lagune Popyit Amyip, und abends brannte bereits das Lagerfeuer im Rund der Hütten.
Noch war dem Häuptling Hakuk nicht bewusst, dass er vom Regen in die Traufe gezogen war. Noch glaubte er, in dem neuen Revier, das er in Besitz genommen hatte, Herr zu sein. Hier würde die ganze Sippe genug Jagdbeute und Früchte der Natur finden. Die Volay waren immerhin fast eine Tageswanderung weit weg, und die Frauen konnten ungehindert Wasser an der Lagune schöpfen, ohne befürchten zu müssen, von Soldaten belästigt zu werden.
Hakuk wusste nichts von der Strategie der beiden Staaten, die Anspruch auf die Jagdgebiete der
Chacoindianer erhoben, und er hatte keine Ahnung davon, dass er in einem strategischen Niemandsland lagerte. Er wusste auch nicht, dass sein Name bereits eine wichtige Rolle im Ablauf der Ereignisse zu spielen begonnen hatte.
Er sollte bald noch mehr erfahren. Um diese Zeit waren nämlich, vom großen Fluss im Osten her kommend, in langen Karawanen Einwanderer in diese Gegend gelangt. Auf einem Streifzug nach Norden hin blieben Hakuk und seine Männer plötzlich wie angewurzelt am Buschrand eines großen Kampes stehen. In knapp hundert Metern Entfernung sahen sie Wohnungen, wie sie weder die Indianer noch die Volay bauten, Wohnungen mit schwarzen Fenstern und Türen und manche mit glänzenden Dächern. Drumherum sahen sie Männer, Frauen und viele Kinder in merkwürdiger Kleidung und mit großen Hüten auf dem Kopf. Sie konnten die weiße Hautfarbe erkennen, und sie hörten unverständliche Laute und fröhliches Lachen. Sie waren auf das Dorf gestoßen, das die mennonitischen Einwanderer Ebenfeld genannt hatten.
Keiner der Männer sagte ein Wort. Sie blieben eine Weile betroffen stehen. Ihr Weltbild war zu begrenzt, um zu erfassen, was nun um sie herum vor sich ging. Sie hatten keine Ahnung von dem fernen Land Bolivien, nicht einmal von
Asunción, der Hauptstadt des Landes, zu dem sie politisch gehören sollten. Man hätte ihnen schwer klarmachen können, dass diese Menschen hier auf dem schönen
Kamp, auf dem sie gerade Spießhirsche jagen wollten, aus Kanada gekommen waren, schon vor einem Jahr, und dass sie in schwierigen Etappen vom Hafen Casado am Paraguayfluss her in den
Chaco vorgedrungen waren, um hier ihre Dörfer anzulegen und den Boden zu pflügen.
Hakuk gab seinen Männern ein Zeichen, und alle zogen sich lautlos in den dichten Busch zurück. So viel hatten sie begriffen, dass im Westen, im Osten und nun auch im Norden andere Menschen da waren, die sich wenig darum zu kümmern schienen, wo die Lenguas ihr Wasser holen und ihre Pekaris und Spießhirsche jagen sollten.
Hauptmann Florentín war enttäuscht und betroffen, als seine Männer die Grashütten des
Kazike Carayá verlassen vorfanden. Es war unschwer festzustellen, dass der Clan nach Osten abgezogen war, in Richtung Isla Po’i, wo sich der Feind festgesetzt hatte. Die Paraguayer würden über diesen neuen Stützpunkt, der sich tief in das gedachte Niemandsland vorgeschoben hatte, schneller Bescheid wissen als erwartet, und
Kazike Carayá war der Verräter, darüber gab es keinen Zweifel.
Jetzt war Eile geboten. Es mussten doch wenigstens einige Hütten gebaut und Schützengräben ausgehoben werden, damit diese Lagune als besetztes Territorium gelten konnte, und sie musste einen authentischen Namen haben. Hauptmann Florentín nannte die Lagune Huijhay. Das war ein Ketschuaname aus dem Altiplano, und damit sollte die Besitznahme durch Bolivien symbolisiert und legitimiert werden. Stafetten meldeten die Einnahme der Lagune und den neuen Namen im
Fortín Arce und dann bei der nächsten Dienststelle in Saavedra. So wurde das neue Fort nun auch in die Karte des bolivianischen Oberkommandos in Muñoz eingetragen.
Hauptmann Florentín war auf alles gefasst, denn die Feindseligkeiten zwischen den beiden Ländern hatten sich inzwischen solcher Spannung gesteigert, dass scharf geschossen wurde, wenn man sich begegnete. In den Fortines Sorpresa im Süden und Vanguardia im Norden war bereits Blut geflossen.
Die gleiche nervöse Spannung, die sich in dem neuen
Fortín Huijhay gleich nach seiner Gründung breit machte, zeigte sich auch im paraguayischen Oberkommando in Isla Po’i, und beides hatte der
Kazike Carayá verursacht, ohne es zu wollen.
Paraguays Heeresführung durfte es unmöglich dulden, dass der Gegner seinen Fuß so weit nach Osten hin setzte. Der Hauptmann Valentín Morínigo, erst vor einigen Wochen mit seiner Kompanie aus
Asunción eingetroffen, erhielt den Befehl, mit einer Einheit von sechzig Mann auf jenen Stützpunkt Boliviens vorzustoßen und ihn in Besitz zu nehmen, koste es, was es wolle.
In einer langen Reihe, denn es gab nur Indianerpfade, machte sich Morínigo mit seinen Reitern auf den Weg nach Westen. Bei der Lagune Curucao machten sie Halt. Morínigo wusste bereits um das Lager der Lenguas hier, und
Kazike Carayá war im paraguayischen Oberkommando dem Namen nach gut bekannt. Wieder flüchteten die Frauen in die Hütten, als die vielen Reiter auftauchten. Die Soldaten umringten das Lager, lachten und machten wilde Scherze, doch die Lenguas konnten ihr Guaraní nicht verstehen. Morínigo gebot Ordnung, und die Reiter mussten sich in respektvollen Abstand zurückziehen. Dann überreichte er dem Häuptling ein großes Bündel Tabak, ein Messer mit einem buntverzierten Griff und einen Poncho. Hakuk war überwältigt von den Herrlichkeiten.
Dann stellte Morínigo gezielte Fragen, und die beiden konnten sich durch Zeichen und Worte verständigen. Hakuk begriff, dass es um seine Lagune Popyit Amyip ging, und dass der Offizier alles über die Besatzer dort wissen wollte, ihre Zahl, ob sie beritten seien und was für Waffen sie hätten. Hakuk gab gern Auskunft. Warum auch nicht? Auch diese Männer nannten ihn
Kazike Carayá, und er war bereits stolz auf diesen neuen Namen. Sie hatten ihn beschenkt, und der Hauptmann deutete an, dass die anderen Reiter vertrieben werden würden und dass die Lenguas wieder zurück zu ihrer Lagune kommen könnten.
Hauptmann Morínigo hatte jedenfalls feststellen können, dass seine Einheit zahlenmäßig in der Übermacht war. Doch wahrscheinlich musste er beim Gegner mit Maschinengewehren rechnen, und das könnte gefährlich werden. Der Verteidiger im Schützengraben mit einem Maschinengewehr war immer im Vorteil. Doch Eile war geboten; denn je mehr Zeit er dem Gegner ließ, desto besser konnte der seine Verteidigungsstellung ausbauen. Der Vorstoß musste beginnen.
Es war ein mühsamer Ritt. Die engen Indianerpfade führten durch dichtesten Busch, und oft mussten die Reiter ihre Pferde am Zügel führen. Die dornigen Sträucher, die den Pfad versperrten, zerrissen die Uniformen und die Bromelien und Kakteen am Boden das Schuhzeug. Erst am Vormittag des dritten Tages näherten sie sich ihrem Ziel. Sie trafen auf den ersten Vorposten, der völlig überrascht war und beim Anblick der Übermacht keinen Versuch zur Verteidigung machte. Die drei bolivianischen Soldaten waren schnell entwaffnet, und sie gaben ohne Widerstand Auskunft über die Truppenstärke und Bewaffnung. Die Paraguayer erfuhren auch, dass das neue
Fortín von den Bolivianern Huijhay genannt wurde.
Hauptmann Morínigo war ein Mann kühler Überlegungen. Er kannte seine Männer nun schon, und ihr Geschick lag ihm am Herzen. Die meisten waren achtzehnjährige Burschen, die gerade im Zug der steigenden politischen Spannungen eingezogen worden waren, ohne ausreichende Ausbildung, doch verwegen und unvorsichtig. Sie brannten auf einen Angriff. Am Lagerfeuer, an dme immer auch eine Gitarre erklang, hatten sie die alten Lieder aus dem großen Dreibundkrieg vor nun fünfzig Jahren gesungen, in denen der Heldentod des Marschalls López gepriesen wurde. „Sieg oder Tod", das war ihnen von der Schule her in Fleisch und Blut übergegangen, und so stand es nun auch auf dem Koppelschloss ihrer olivgrünen Uniform.
Morínigo versammelte seine Leutnants um sich. „Wir werden dem Gegner freien Abzug anbieten. Vielleicht können wir unnötiges Blutvergießen vermeiden," sagte er, und er rief den Leutnant Dionisio Bareiro nach vorn. „Sie nehmen zehn Mann ihres Zuges. Diese bolivianischen Soldaten werden sie zum
Fortín führen. Dort fordern Sie, mit Hauptmann Abel Florentín sprechen zu wollen. Sie bieten freien Abzug an und geben sechs Stunden Zeit. Nach Ablauf der Frist werden wir angreifen."
„Zu Befehl", sagte Leutnant Bareiro und salutierte. Er war stolz auf diesen ersten Auftrag an der bisher nur gedachten Frontlinie, und er wusste, dass seine Mission nicht ungefährlich war.
Der Stoßtrupp brach auf. Es waren noch fünf Kilometer bis zur Lagune. Sie ritten im Schritt; denn bis an das
Fortín führten nur enge Pfade. Etwa fünfzig Meter vor den Hütten, die inzwischen errichtet worden waren, blieben sie stehen, und der Leutnant gab Zeichen, dass er eine Unterredung wünsche. Zehn bewaffnete Männer kamen heraus und führten Leutnant Bareiro ins Lager. Zwei selbstbewusste Männer standen sich hier zum ersten Mal gegenüber, Leutnant Dionisio Bareiro aus
Asunción und Hauptmann Abel Florentín aus La Paz, Männer aus zwei Welten hier an der Lagune im Chacobusch. Sie wussten nicht, dass sich ihre Wege noch zweimal kreuzen würden, unter ganz anderen Umständen.
Die Information Bareiros war knapp. Die drei bolivianischen Soldaten bestätigten die Truppenstärke des Gegners. Der Hauptmann akzeptierte die Bedenkzeit von sechs Stunden. Beide salutierten, und Leutnant Bareiro trat mit seinem Zug den Rückweg an. Er spürte die Blicke der überraschten Gegner in seinem Rücken, und er wusste, dass diese Situation nicht ungefährlich war. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte Leutnant Rojas Silva ein ähnliches Unternehmen beim
Fortín Sorpresa mit seinem Leben bezahlt. Eine Kugel im Rücken hatte ihn getötet.
Doch Leutnant Dionisio Bareiro wusste damals noch nicht um die ritterliche Gesinnung des Hauptmanns Abel Florentín. Auch er, ebenso wie Hauptmann Valentín Morínigo, verabscheute sinnloses Blutvergießen. Dazu wäre es bei einem Gefecht aber unweigerlich gekommen, und damals hoffte man noch darauf, dass der Grenzkonflikt zwischen
Paraguay und Bolivien am Konferenztisch der Neutralen gelöst werden könnte.
Als Hauptmann Morínigo sich mit seinem Stoßtrupp am späten Nachmittag vorsichtig der Lagune näherte, fanden sie den Stützpunkt verlassen vor. An den umgelegten Fahnenmast befestigten seine Soldaten die rotweißblaue Fahne und richteten ihn auf. Der Hauptmann ließ seine Truppe antreten, lobte sie für ihre Unerschrockenheit und Besonnenheit und erklärte die Lagune für rechtmäßigen paraguayischen Besitz.
„Sie heißt nun nicht mehr Huijhay", verkündete er feierlich, „sondern
Kazike Carayá, zu Ehren jenes Häuptlings, der uns rechtzeitig gewarnt und so gut informiert hat.
Kazike Carayá soll mit seiner Sippe wieder hierher ziehen, und wir wollen ihn, seine Sippe und sein Jagdgebiet respektieren."
Der Hauptmann ließ den Leutnant Bareiro am nächsten Morgen mit dreißig Mann in dem
Fortín, das nun kurz
Carayá genannt wurde, und er kehrte nach Isla Po’i zurück. Bei der Lagune Curucao machte er Halt und versuchte Hakuk verständlich zu machen, dass er mit seinem Clan wieder an seine Lagune zurückkehren könnte. Er sagte ihm auch, dass die Lagune nun
Kazike Carayá heiße, und er klopfte dem Häuptling dabei wieder respektvoll auf die Schulter. Hakuk fühlte sich geehrt, und er war glücklich.
Die ganze Sippe zog nun wieder zu ihrer Lagune zurück. War es der Zug in die vertraute Umgebung, die ihn das Wagnis unternehmen ließ? Die einzelnen Sippen hatten ihre gegenseitig respektierten Jagd- und Sammelgebiete, und Hakuk gehörte in die Gegend von Popyit Amyip. Oder war es die Unsicherheit, die sich nun um ihn herum immer stärker abzuzeichnen schien, im Westen, im Osten und im Norden? Nach einer Woche jedenfalls näherte sich die Sippe wieder ihrer Lagune Popyit Amyip. Allerdings war Hakuk misstrauisch, trotz der Anerkennung und der Zusicherung durch den paraguayischen Hauptmann, und sie zogen nicht mehr in die verlassenen Grashütten, sondern bauten sich neue in weiterer Entfernung.
Das Nebeneinander von Soldaten und Indianern war um diese Zeit noch nicht so spannungsgeladen, wie zwei Jahre später. Dennoch, hier standen sich zwei Kulturen, zwei Lebensweisen, zwei Denkweisen gegenüber.
Hier die Indianer, sozusagen unberührt in ihrem Urzustand, von der Jagd und vom Sammeln lebend, in einer Weise, wie sie es tausend oder mehr Jahre gepflegt hatten. Die Frauen und Mädchen kamen, nur mit einem Lendenschurz bekleidet, ungeniert mit nacktem Oberkörper an das gegenüber liegende Ufer der Wasserstelle, als Hakuk ihnen versichert hatte, dass ihnen keine Gewalt angetan werden würde. So hatte es ihm der Hauptmann Morínigo zugesichert.
Dort die jungen Soldaten voller Lebens- und Abenteuerlust, die schon monatelang ein normales gesellschaftliches Leben entbehrt hatten, und die sich in der Eintönigkeit der Tage hier im fernen dichten Busch langweilten.
Berichte und Informationen
Statistik der Mennonitenkolonien in Paraguay
Gundolf Niebuhr
Die Gründung des „Vereins für Geschichte und
Kultur der
Mennoniten in Paraguay" am 3. Dezember 1999 war das Resultat der Bemühungen einer Interessengruppe, die sich im Laufe der vorhergehenden drei Jahre periodisch getroffen hatte. Sie bestand anfänglich aus den Personen Jakob Warkentin, Jacob Harder, Peter P. Klassen, Gerhard Ratzlaff und Gundolf Niebuhr und befasste sich zunächst mit drei Fragen: Einrichtung eines Dokumentations- und Forschungszentrums
Chaco, Teilnahme an dem von Prof. Harvey Dyck geplanten Symposium in der Ukraine und Herausgabe eines Nachschlagewerkes über die
Mennoniten in Paraguay.
In der Folgezeit legten Gundolf Niebuhr und Gerhard Ratzlaff schriftliche Vorschläge zur Einrichtung eines Dokumentationszentrums und zur Herausgabe eines Nachschlagewerkes vor. In einer erweiterten Sitzung traf sich die Interessengruppe mit den Archivaren der drei
Mennonitenkolonien im
Chaco, um zu beraten, wie eine Zusammenarbeit der mennonitischen Archive und Bibliotheken in
Paraguay effektiver zu gestalten sei.
Da in den informellen Gesprächen der Mitglieder der Interessengruppe der Gedanke zur Gründung eines mennonitischen Geschichtsvereins immer mehr in den Vordergrund rückte, bildete man eine erweiterte Arbeitsgruppe die das Statut für den zu gründenden „Verein für Geschichte und
Kultur der
Mennoniten in Paraguay" ausarbeiten sollte.
Auf Grund dieses Statuts wurde am 3. Dezember 1999 in
Filadelfia der Verein gegründet. Zu den Gründungsmitgliedern gehören: Gundolf Niebuhr, Jakob Warkentin, Peter P. Klassen, Jacob Harder, Gerhard Ratzlaff, Hans Theodor Regier, Heinrich Dyck, Abram J. W. Wiebe, David P. Reimer und Heinrich H. Dyck.
Über die Zielsetzungen des neugegründeten Vereins sowie über die Beitrittsmöglichkeiten geben die Paragraphen 3 und 4 des Statuts Auskunft:
§ 3 Zielsetzung:
Der Verein für Geschichte und
Kultur der
Mennoniten in Paraguay ist eine landesweite, gemeinnützige Vereinigung von Personen, die ohne Gewinnstreben mit folgender Zielsetzung arbeitet:
- Das historische Erbe, das Glaubensgut und das kulturelle Leben der deutschsprachigen Mennoniten in Paraguay beschreiben, analysieren, pflegen und fördern;
- Durch Forschung und Förderung von wissenschaftlichen und künstlerischen Arbeiten dies Erbe darstellen und interpretieren;
- Die wechselseitige Beziehung der verschiedenen Gruppen mennonitischer Einwanderer und ihrer Nachkommen zu ihrer natürlichen, sozialen und kulturellen Umwelt in Paraguay erforschen und im interethnischen Dialog interpretieren;
- Forschungsarbeiten, die in den Interessenbereich der Vereinigung fallen, anregen und beratend begleiten;
- Durch Kooperation mit Archiven und Bibliotheken der Kolonien, Gemeinden und ihren Bildungsinstitutionen eine Datenzentrale einrichten und Material sammeln;
- Kontakte mit ähnlichen Vereinen und Institutionen der Mennoniten in anderen Ländern unterhalten, um Materialien und Forschungsergebnisse auszutauschen.
§ 4 Mitgliedschaft:
Mitglied werden kann, wer den Zielen des Vereins zustimmt, diese aktiv unterstützt, und den Jahresbeitrag zahlt.
Auch Institutionen können als juristische Person Mitglied werden.
Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet die Vollversammlung.
Die Vollversammlung kann auch Personen zu Ehrenmitgliedern ernennen, die durch hervorragenden Einsatz die Ziele des Vereins in besonderer Weise gefördert haben oder gegenwärtig fördern.
Wir erwarten, dass der Verein einen wesentlichen Beitrag zum besseren Verständnis und zur Erhaltung der Geschichte der
Mennoniten in Paraguay liefern wird. Historische Arbeit wird besonders bei den sehr verschiedenen mennonitischen Gruppen in unserem Land von Bedeutung sein, da solche Arbeit informiert und Selbstbewußtsein schafft, oft auch Missverständnisse aus dem Weg räumen kann.
Mennoniten in Paraguay haben wirtschaftlich und kulturell zur Veränderung ihrer Umwelt beigetragen und durch ihre Missionsbemühungen eine breite Bevölkerungsschicht mit ihrem freikirchlichen Glaubensgut konfrontiert.
Die Struktur des Mennonitentums in
Paraguay legt von vornherein eine gewisse Richtung für den Verein fest, bzw. umreißt in groben Zügen seinen Charakter. Geschichtsvereine sind nicht überall aus den gleichen Gründen und mit denselben Zielen entstanden. In Deutschland war es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Verlangen, der Täufergeschichte und -Theologie endlich einen gebührenden Platz in der Kirchengeschichte zu verschaffen. Da diese Geschichte an sämtlichen Fakultäten als Stiefkind behandelt worden war, bedurfte es eines zielgerichteten Aufwandes, eine neue Perspektive zu schaffen und kompetente wissenschaftliche Forschung hierüber zu fördern und zu publizieren. Das Mennonitische Lexikon sowie die periodisch erscheinenden Geschichtsblätter, aber auch das tatsächlich gewandelte Image des Täufertums in der Forschung sind Beleg dafür, dass dies ein lohnendes Projekt war.
In Deutschland, wie auch in Nordamerika, sind Lokalgemeinden und Konferenzen die hauptsächlichen Trägerinstitutionen des Mennonitentums. Das erklärt auch, wieso die Geschichtsvereine in den USA, Kanada und Deutschland eine starke Gemeindebezogenheit haben und dazu neigen, theologisch orientiert zu sein. In Kanada kommt allerdings, auch ein starker kultureller Zug hinzu, der z.B. im Steinbach Museum und in zahlreichen Folkloristischen Aktivitäten, die durch den Geschichtsverein gefördert werden, zum Ausdruck kommt. In Brasilien hat der entsprechende Verein von vornherein eine stärker kulturelle Prägung.
In
Paraguay, ähnlich wie in Brasilien auch, wird das Mennonitentum durch eine Reihe kolonialer, interkolonialer und übergemeindlicher Institutionen getragen und repräsentiert. Somit kommt einem Verein wie diesem vor allem die Aufgabe zu, Aktivitäten im wissenschaftlichen und auch folkloristischen Bereich zu fördern, die zur Erhellung der besonderen Rolle dienen, die dem Mennonitentum in unserem Lande zukommt.