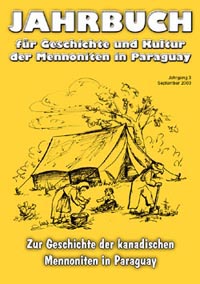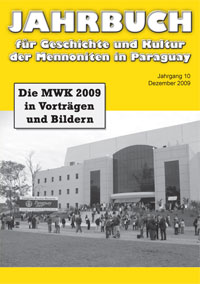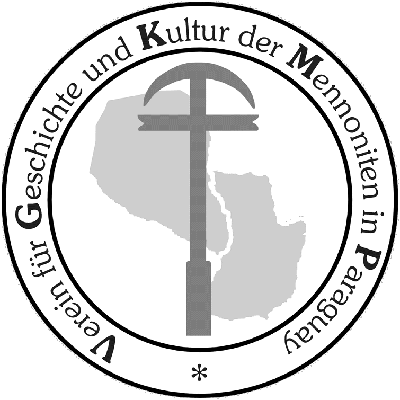Begleitwort zu dieser Nummer
Diese Nummer des Jahrbuchs des Vereins für Geschichte und
Kultur der
Mennoniten in Paraguay, steht unter dem Thema: "Einwanderung kanadischer
Mennoniten in Paraguay". Als Teil der Jubiläumsfeier der
Kolonie Menno wurde vom Geschichtskomitee dem
Schulrat der
Kolonie ein Symposium organisiert, dessen Vorträge hiermit publiziert werden. Der Aufsatz von Herrn Sieghard Schartner wurde auf einer Lehrertagung in
Loma Plata kurz vorher gehalten. Er wurde hier hinzugefügt, um einen kleinen Seitenblick auf die Lage der Mennoniten in Bolivien zu ermöglichen.
75 Jahre sind ein volles Menschenalter. Diese Zeitspanne steht zwischen uns heute und den Pionieren die damals in die Chacowildnis eindrangen. Ihre Perspektiven waren nicht glänzend. Der Blick in die Zukunft war ihnen wie auch uns verhüllt. Sie mussten auf den Glauben bauen, und vielleicht auch auf die eigene erprobte Tüchtigkeit. Aber voraussehen, ob sich im
Chaco etwas entwickeln würde, wie es sich entwickeln würde – das konnten sie nicht. Hinzu kommt, dass sich unsere Welt seit der Aufklärung und der industriellen Revolution immer schneller verändert. Die Zeit hier in
Paraguay hat sicherlich mehr Veränderungen mit sich gebracht als die ersten 75 Jahre in Russland oder die 50 Jahre in Kanada. Und wir können davon ausgehen dass dieser Prozess sich noch beschleunigen wird.
Die Jubiläumsfeier war ein Anlass rückwärts zu schauen. Wir dürfen davon ausgehen, dass die geschichtliche Perspektive auch richtungweisend für die Zukunft ist. Mir gefällt immer wieder das Bild vom "Picada-machen" hier im
Chaco: Ein paar "Fuden" werden gestellt, und dann schaut der Bulldozerfahrer nach hinten um die gerade Linie zu behalten. Historisch gesehen ist das natürlich etwas komplizierter, aber das Prinzip gilt.
Das Geschichtskomitee in
Menno hatte den guten Gedanken, als Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten auch ein Symposium zu organisieren, auf dem es nicht nur um die Feier des Fortschritts oder um Folklore ging, sondern wo die geschichtliche Bilanz etwas ernsthafter gezogen wurde. Dort wo die großen Muster, die Zusammenhänge der Entwicklung erarbeitet werden, ist bessere Orientierung möglich. Dort wo Geschichte auch kritisch betrachtet wird, kann man sie ernst nehmen. Denn etwas zu kritisieren, bedeutet, damit zu sympathisieren. Das was mir nahesteht, das was mich wirklich angeht, das will ich verantwortlich und kritisch erforschen, weil ich damit weiterleben will.
Vom Verein für Geschichte und
Kultur der
Mennoniten in Paraguay haben wir diese Initiative mit Interesse verfolgt. Möglicherweise kann diese Erfahrung auch für andere Kolonien eine Anregung sein, ihre Jubiläen zu einem Anlass gründlicher Beschäftigung mit der Vergangenheit zu machen.
Der kulturelle Teil dieser Ausgabe ist etwas erweitert worden. Durch die Reaktionen mancher Leser haben wir als Redaktionsteam erfahren, dass die Beiträge in diesem Teil gern gelesen werden. Gerade hier möchten wir auch Mut machen, sich zu beteiligen. Manche der Themen, die uns als Gesellschaft wirklich ange-hen, lassen sich in Form literarischer Erzählungen vielleicht besser vermitteln als in wissenschaftlichen Aufsätzen. Kreativität ist hier gefragt. Erstmals ist auch ein plattdeutscher Beitrag eingesandt worden. Um größere Beteiligung zu erreichen, wäre es auch denkbar, dass
Deutschlehrer in den Sekundarschulen diesen Raum nutzen, um besonders ansprechende Arbeiten zu publizieren.
Mehrere Bücher sind von Personen der
Kolonie Menno als Beitrag für das
Jubiläum herausgegeben worden. Es handelt sich teils um recht persönliche Lebenserfahrungen, die jedoch ihren Wert gerade im Kontext der eigenen Siedlungsgeschichte erlangen. Sie, zusammen mit einigen anderen Neuerscheinungen über die Mennoniten in Russland, in
Paraguay, – sowie über die Mission unter den Indianern werden in den Buchbesprechungen kurz vorgestellt.
Im Jahrbuch 2001 war beim Vortrag von Dr. Alfred Neufeld ein Fehler unterlaufen. Durch Missverständnisse bei verschiedenen Versionen war der Teil mit den Schlussfolgerungen nicht hineingekommen. Wir bringen ihn als Nachtrag in dieser Nummer und bitten um Verständnis.
Den Deckel für diese Nummer des Jahrbuches verdanken wir der Künstlerin
Frau Maria Friesen aus
Loma Plata. Vielen Dank! Allen Schreibern, die am Inhalt dieser Nummer mitgewirkt haben, sei an dieser Stelle gedankt. Ich hoffe, dass den Geschichtsfreunden in den deutschsprachigen Kreisen der
Mennoniten in Paraguay und auch den Lesern im Ausland, hiermit wieder eine nützliche Veröffentlichung in die Hände gelegt wird. Zu überlegen wäre, ob wir in Zukunft auch für spanischsprachige Leser/innen eine ähnliche Publikation bereitstellen können.
Gundolf Niebuhr, Schriftleiter
Vorträge gehalten auf dem Symposium am 6. und 7. Juni 2002 in Loma Plata
Abraham S. Wiebe (1)
Einleitung
Nach 75 Jahren Aufenthalt in
Paraguay ist es wohl nicht verfrüht, einmal über die Geschichte unserer
Gemeinde zu schreiben, darüber nachzudenken und uns auszutauschen. So können wir uns unserer Vergangenheit mehr bewusst werden und aus der Geschichte lernen.
Es ist einerseits eine interessante Geschichte, wenn man an die unternehmungsfreudigen und starken sowie begabten Laienführer der mennonitischen „Pilger" denkt.
Andererseits ist es aber auch eine etwas traurige Geschichte im Blick auf die vielen Spaltungen, die oftmals aufgrund von uns heute mehr traditionell erscheinenden Dingen als aufgrund inhaltlich wichtiger Unterschiede entstanden sind. Es hat dadurch viele Schmerzen in der Geschichte unserer Vorfahren gegeben.
Wir sehen im Verlauf der Geschichte den Ernst unserer Vorfahren in Bezug auf ihre Religiosität und ihre Opferbereitschaft, die sie ihrer Kinder halber auf sich nahmen.
Gott hat diese
Gemeinde bis heute in vielfältiger Weise wunderbar gesegnet und erhalten.
Als die Alte
Kolonie in Chortitz, Russland, nicht mehr Land in der Nähe hinzukaufen konnte, entwickelte sich eine landlose Bevölkerung in der
Kolonie.
Die Mutterkolonie, Chortitz, kaufte für ihre jungen Leute ein größeres Landstück, welches etwa 200 km östlich von ihr entfernt lag. Auf diesem Landstück gründeten dann die Landlosen der Mutterkolonie 1836 die
Kolonie Bergthal.
Martin W. Friesen beschreibt die Ansiedlung folgendermaßen:
„Im Jahre 1833 benutzte die Chortitzer Siedlung eine günstige Gelegenheit und kaufte einen Landkomplex, um eine Tochtersiedlung anzulegen. Leider war das Landgut weit von der Mutterkolonie entfernt, nämlich etwa 200 Kilometer. Es lag in der Nähe des Asowschen Meeres in der Gegend der Hafenstadt Mariupol. Heute trägt diese Hafenstadt den Namen Schdanow. Hier entstand drei Jahre später die Ansiedlung `Bergthal‘. Bergthal ist also eine Tochtersiedlung der Chortitzer Ansiedlung und ist auch die erste mennonitische Tochtersiedlung in Russland überhaupt."
(2)Die Chortitzer
Gemeinde gab den neuen Siedlern den erfahrenen
Prediger Jakob Braun mit. Dieser wurde der erste Älteste der neuen
Mennonitengemeinde, die unabhängig von der Muttergemeinde in Chortitz geführt wurde. Martin W. Friesen schreibt:
„Die Mutterkolonie gab ihren jungen Siedlern einen
Prediger Namens Jacob Braun mit, der schon seit 1824 im Dienst stand. Er wurde dann 1840 als Gemeindeältester der neuen Tochtergemeinde eingesetzt."
(3)
Außer diesem
Prediger gab die Muttergemeinde den Ansiedlern noch drei erfahrene, tüchtige Bauern mit, die den unerfahrenen Siedlern als Vorbild und Berater in den wirtschaftlichen Angelegenheiten dienen sollten.
„Es waren dies die Familien Wilhelm Rempel, Jakob Martens und Johann Wiebe. Sie waren erfahren und auch fähig, die junge Ansiedlung zu fördern."
(4)
Zur Zeit der Auswanderung und Ansiedlung 1874 zählte die
Bergthaler Gemeinde 525 Familien.
Im Dorf
Bergthal wurde später eine Kirche erbaut, die 12,19m x 30,48m groß war und etwa tausend Sitzplätze hatte, wie Delbert Plett und Adina Reger in dem Buch „Diese Steine" auf der Seite 335 beschreiben. Die Kirche war einfach gebaut, ohne Kreuz und ohne Glockenturm. Um die weltlichen Angelegenheiten zu verwalten, baute man 1860 in
Bergthal ein Gebietsamt -Kolonieamt-, in dem 15 Ratsmitglieder ihre Beratungen abhielten.
Der Älteste Gerhard Wiebe (1827 – 1900) führte die (seine)
Gemeinde aus Russland nach Kanada, um der vermeintlichen Gefahr durch die Zarenregierung in Russland zu entgehen, obwohl der Zar dem Ältesten ein großes Landgut mit Arbeitern, Leibeigenen und den Erhalt des Adelstitels anbot, wenn er sein Volk überreden würde, in Russland zu bleiben. Reger und Plett schreiben:
„Wie Mose führte Ältester Gerhard Wiebe (1827 – 1900), Heuboden, sein Volk 1874 – 76 von der bevorstehenden Gefahr zu einer neuen Heimat und Zuflucht in Manitoba. 1874 bot der Zar Gerhard Wiebe ein feudales Gut, komplett mit Land, Leibeigenen und für sich und seine Nachkommen den Adelstitel an, wenn er sein Volk überreden würde, in Russland zu bleiben. Obwohl das eine ernste Versuchung war, wählte er den schmerzlichen und opfervollen Weg des Pilgers und blieb Gott treu, obwohl er von Seiner Kaiserlichen Majestät gewarnt worden war, dass Verachtung und Spott seine einzige Belohnung sein würde."
(5)Wie zu hören ist, war die Versuchung wohl groß, doch zog Ältester Wiebe es vor, auf das Angebot zu verzichten und mit der
Gemeinde nach Kanada auszuwandern, weil es ihm vor allem um den Erhalt und Fortbestand der
Gemeinde ging.
Unter den Bergthalern hatten sich bis dahin schon tüchtige und unternehmungsmutige Bürger mit vielseitigem Horizont hervorgetan. Wiewohl jedes Dorf in
Bergthal eine eigene Schule hatte, die mit Lehrern der
Kolonie besetzt war, welche die Gabe und das Interesse für diesen Dienst hatten, wurden auch Lehrer aus der Chortitzer und Molotschnaer
Kolonie angestellt. Die Schulen in
Bergthal wurden nicht direkt von den Reformen des Johann Cornies betroffen, aber dies war wahrscheinlich nicht nur zum Nachteil derselben, sondern vielmehr ein Segen, weil es viele Zuzüge von anderen Kolonien gab, wie eben schon erwähnt, und die waren wiederholt durch die Reformen des Cornies verursacht.
Der Lehrerberuf wurde damals auch manchmal als Sprungbrett für den Gemeindedienst bzw. Leitungsdienst in der
Gemeinde benutzt. Ist diese
Tradition bis heute nicht noch teilweise bei uns erhalten geblieben?
Delbert Plett schreibt zur Situation der Schulen in
Bergthal:
„Diejenigen, welche die Schulen von Bergthal so vollständig und gründlich denunzierten, haben scheinbar niemals die Schriften der Lehrer von Bergthal/Chortitza und sogar gewöhnlicher Laien studiert. Beispielsweise sind die Predigten vom Ältesten Gerhard Wiebe (1827 – 1900) mit Juwelen biblischer Allegorie übersät und zeigen eine gesunde Exegese (Auslegung) und einen wahrhaft inspirierten Glauben, der heute ebenso dauerhaft ist wie in den 1860er Jahren, als sie geschrieben wurden, und die alles überragten, was seine Feinde geschrieben haben. Die Tagebücher des Chortitzer (Bergthaler) Ältesten David Stoesz und des Predigers Heinrich Friesen (1842 – 1921) sind ein konkreter Beweis, dass das Schulsystem von Bergthal Promovierte hervorbrachte, die nicht nur mit einer Liebe zu Jesus erfüllt waren, sondern auch fähige Schriftsteller und begabte Denker waren."
(6)
1. Die Auswanderung nach Kanada
Als 1780 die russische Regierung große Veränderungen durchführte, welche für die Gemeindeschulen der Mennoniten negative Auswirkungen hatten, entschloss sich die
Bergthaler Gemeinde als geschlossene Gruppe nach Kanada auszuwandern. Im Voraus schickte man Kundschafter, um Erkundigungen zu machen und die Bedingungen für eine Ansiedlung mit der Regierung des in Aussicht stehenden Heimatlandes auszuhandeln.
In den Jahren 1874 – 1876 wanderten dann 3000 Personen nach
Manitoba in Kanada aus. Ihre zwei Hauptgründe waren: Die Erhaltung des Gemeindeschulwesens und die Verweigerung des Militärdienstes (auch des Ersatzdienstes).
2. Ansiedlung in Kanada
Die
Bergthaler siedelten an der Ostseite des roten Flusses (Red River) an. Deshalb wurden sie auch „Ost-Reserver" genannt. Diese
Gemeinde war der Bahnbrecher von all den Russlandmennoniten, die nach Kanada auswanderten.
Ihr Anführer, Ältester Gerhard Wiebe, war mit Elisabeth Dyck verheiratet, und sie hatten zusammen zehn Kinder. Ältester Wiebe siedelte in Kanada im Dorf Chortitz an. Hier liegt Herr Wiebe auch begraben.
Schon 1878, ein paar Jahre nach der Ansiedlung auf der
Ostreserve, begannen die Familien auf die
Westreserve umzusiedeln. Der Grund dazu war: Es gab auf der
Westreserve mehr und besseres Farmland. Diese Siedlung befand sich etwa 70 km von der
Ostreserve entfernt. Deshalb bildete man dort aus Gründen der Entfernung eine neue
Gemeinde, die zweite, die aus der von Russland ausgewanderten
Bergthaler Gemeinde hervorging.
3. Die Entwicklung der Gemeinden
Die
Bergthaler, welche sich schon in Russland auf eigene Art entwickelt hatten, versuchten in Kanada ihre besondere Eigenart beizubehalten. So beschloss man, dass die
Gemeinde in Russland in verschiedenen Hinsichten schon zu weit mit der Welt mitgegangen war. Man wollte deshalb begangene Fehler rückgängig machen.
Weil die
Bergthaler auf der
Westreserve nahe mit den Fürstenländern und Chortitzern, die auch aus Russland gekommen waren, zusammen wohnten, wurden sie von den fortschrittlicheren Dingen, die diese aus Russland mitgebracht hatten, angesteckt. Zum Beispiel im Gesang in der Schule und in den Gottesdiensten, wo nach den Melodien des Choralbuches „Ein Singbuch mit Ziffern" gesungen wurde. Manche der Gemeindeglieder der Fürstenländer und der Chortitzer wechselten über zu den Bergthalern, wodurch die
Gemeinde der
Bergthaler von ihnen beeinflusst wurde. Nach einiger Zeit wechselten die
Bergthaler das Singen in den Schulen und
Kirchen von den alten Hausweisen zu den neuen Ziffernmelodien. Besonders der Älteste Johann Funk auf der
Westreserve unterstützte eine Verbesserung in den Schulen. Das führte jedoch zu Konflikten innerhalb der Gemeinden. Als dann die
Bergthaler der
Westreserve im Jahre 1891 eine Fortbildungsschule erbauten und einen Lehrer aus Kansas, USA, namens Heinrich Ewert anstellten, kam es innerhalb der
Gemeinde zu einem Bruch.
Martin W. Friesen schreibt, dass von den 500 Familien, die die
Bergthaler Gemeinde der
Westreserve zählte, 440 Familien nicht mehr mitmachten. Weil Ältester Funk sich zu den Fortschrittlichen hielt, gründeten diese 440 traditionsgebundenen Familien eine neue
Gemeinde. Sie wählten
Prediger Abraham Dörksen, der im Dorf
Sommerfeld wohnte, als ihren Ältesten und nannten sich nach dem Wohnort ihres Ältesten die „
Sommerfelder Mennonitengemeinde". Der kleinere Teil der alten
Gemeinde mit ihrem Ältesten Johann Funk behielt den Namen „
Bergthaler Mennonitengemeide" bei.
Die ganze Gruppe der
Bergthaler Mennonitengemeinde der
Ostreserve wollte sich nun auch nicht mit der fortbildungsbewussten Westreserver
Bergthaler Mennonitengemeinde identifizieren. Deshalb nannten sie sich nicht mehr
Bergthaler Mennonitengemeinde, sondern wechselten den Namen und nannten sich „
Chortitzer Mennonitengemeinde". Diesen Namen haben sie bis heute beibehalten.
So hatten sich in Kanada die
Bergthaler innerhalb von 20 Jahren in drei Gemeinden gespalten. Zusätzlich hatte es unter den Ostreservern durch eine innere Erweckung eine Abspaltung gegeben. Dieser Splitter nannte sich „
Gemeinde Gottes in Christo". Sie ist auch unter dem Namen „Holdemannsgemeinde" bekannt. Auf der
Westreserve entstand zudem noch eine Brüdergemeinde. Nachzulesen bei MWF, Neue Heimat in der Chacowildnis, Seite 49.
Als die Regierung Kanadas der Chortitzer
Gemeinde Geld zur Unterstützung ihrer Schulen anbot, reagierte diese sehr skeptisch. Man sagte diesem Reformunternehmen anfänglich jedoch zu. Als sie aber merkten, dass die Regierung dann doch mitsprechen wollte, lehnten sie weiterhin jegliche Unterstützung ab, wie Ältester Gerhard Wiebe dazu schreibt.
Schon im Jahr 1900 zog eine Gruppe der
Bergthaler nach Saskatchewan und siedelte nahe bei Rosthern an, wo sie eine „
Bergthaler Mennonitengemeinde" gründeten.
Eine weitere Gruppe, die in der Nähe von Herbert, auch in Saskatchewan, siedelte, nannte sich dort „
Sommerfelder Mennonitengemeinde", nach Martin W. Friesen.
So wurde die
Bergthaler Mennonitengemeinde, die von Russland nach Kanada ausgewandert war, in mehrere Gemeinden zerstreut. Alle diese Gemeinden, die ihren Ursprung in der
Kolonie Bergthal in Russland hatten, hielten ganz fest an ihrem privaten Schul- und Gemeindewesen. Teilweise ausgenommen war die schon genannte kleine Gruppe der
Bergthaler auf der
Westreserve.
Wenn wir all die Gruppen zusammenzählen, die in Kanada von den Bergthalern aus Russland entstanden sind, ergibt sich folgendes Bild:
1.
Ostreserve:
a. Chortitzer
b. Holdemanns
Westreserve:
Bergthaler Sommerfelder Brüdergemeinde in
Manitoba Saskatchewan:
Sommerfelder Bergthaler
Insgesamt bestanden nach einigen Jahren des Zusammenlebens in Kanada sieben verschiedene Gemeinden.
5. Neues Schulgesetz und Militärdienst in Kanada
Als 1919 das neue Schulgesetz in Kanada wirksam wurde, versuchten die konservativen Gemeinden die Regierung durch Bittschriften zu überzeugen und umzustimmen. Aber als sie merkten, dass es wohl nicht geschehen werde, entschlossen sich viele Glieder dieser Gemeinden auszuwandern. Ältester Martin C. Friesen beschrieb die Situation, die dadurch in der Chortitzer
Gemeinde der
Ostreserve entstand, folgendermaßen: „Als die Regierung 1919 anfing, die Distriktschulen als Zwangsschulen in unserer
Gemeinde einzuführen, wo bis dahin noch nur Privatschulen waren, gab es große Unruhe unter den Brüdern und eine fast babylonische Verwirrung. Sowohl die Altkolonier wie auch die
Bergthaler Gemeinden machten ganzen Ernst mit der Sache und erwogen einen Ausweg. Einige Brüder liessen sich sogar für diese Sache ins Gefängnis stecken."
„Es ist denkbar, dass es sich die damaligen Regierungsparteien Manitobas und Saskatchewans in den Kopf gesetzt hatten, diesen konservativen Mennoniten ein für allemal zu zeigen, dass sie das letzte Wort hatten und nicht die Mennoniten", schreibt Martin W. Friesen im Buch „Neue Heimat in der Chacowildnis, Seite 69. Und weiter bemerkt er dann: „Viele Altkolonier und auch einige
Altbergthaler wurden ins Gefängnis gesteckt und noch mehr zahlten Geldstrafen, weil sie ihre Kinder nicht in die Regierungsschulen schickten."
Vertreter der Chortitzer
Gemeinde der
Ostreserve, der
Sommerfelder Gemeinde der
Westreserve sowie der
Bergthaler Gemeinde aus Saskatchewan entschlossen sich deshalb, nach
Paraguay auszuwandern. Dort wollten sie dann eine einzige
Gemeinde gründen. Prozentmäßig setzte sich die Gruppe der Auswanderer nach
Paraguay etwa wie folgt zusammen:
70% waren Glieder der
Chortitzer Mennonitengemeinde;
20% waren Glieder der
Sommerfelder Mennonitengemeinde;
10% waren Glieder der
Bergthaler Mennonitengemeinde aus Saskatchewan.
Laut Protokoll einer Beratung am 17. Januar 1923 in Rosthern im Hause des Ältesten Aaron Zacharias wurde beschlossen, in
Paraguay, wenn eben möglich, nur eine
Gemeinde zu bilden. Auf dieser Sitzung waren folgende Personen zugegen:
– Ältester Johann Dück von Schönsee,
–
Prediger Johann Sawatzky und Peter Falk von der
Ostreserve,
–
Prediger Johann Schröder und Bernhard Töws von der
Westreserve Manitoba,
–
Prediger Kornelius Reimer und Diakon Peter Harder von Star City,
–
Prediger Heinrich B. Bergen, Kornelius Hamm, Heinrich Martens, Diakon Heinrich Dück und der schon erwähnte Älteste Aaron Zacharias von Rosthern.
Außerdem wurden auf dieser Sitzung 20 Regeln für die in
Paraguay zu gründende
Gemeinde erarbeitet. Darunter befanden sich auch solche, die heutzutage keinen Einfluss mehr auf das Gemeindeleben haben oder uns sogar manchmal etwas komisch erscheinen, obwohl sie für die damalige Situation ganz ernst gemeint waren. Beispiele sind:
- Es sollte in Paraguay in Dörfern gesiedelt werden.
- Ein Dorf sollte eine Fläche von 3 Quadratmeilen umfassen.
- Jeder Hof sollte 190 Acker (76 ha) umfassen, die Schule 60 Acker.
- Ohne Einwilligung des Lehrdienstes sollte von außen niemand aufgenommen werden.
- Die Geburt eines Kindes sollte bald nach der Geburt beim Lehrdienst angemeldet werden.
- In den Schulen sollten nur die Melodien aus dem 1. Teil des Choralbuches gesungen werden.
- Brautleute sollten eine Verlobung feiern.
- Hochzeiten dürften nicht an einem Feiertag gemacht werden.
- Es müssen ein Waisenamt eingerichtet, Brandältester und Brandschulzen angestellt werden.
- Die Gemeindezucht sollte evangelisch gebraucht werden.
- Gemeindeglieder, die nicht zum Abendmahl kommen, sollten gründlich nach Christi Lehre ermahnt werden.
- Es wurde gänzlich verboten, ein obrigkeitliches Amt zu bekleiden.
- Die Kleider sollten einfach sein und nach Gottes Wort Kopf und Leib bedecken.
- Autos und Telefon seien schädlich und deshalb zu verbieten.
- Den Schnurbart tragen oder irgendeine Bartverschneidung wurde gänzlich verboten.
Im Jahre 1926 war es dann so weit, dass die erste Gruppe Kanada Richtung
Paraguay verließ. Diese erste Gruppe der mennonitischen Auswanderer aus Kanada kam am 31. Dezember des Jahres in Puerto Casado an und ging dort an Land. Es folgten bis zum November 1927 weitere sechs Gruppen, so dass in den insgesamt sieben Einwanderergruppen 1743 Personen in den
Chaco kamen, wovon jedoch 332 noch zurückzogen, bevor die Ansiedlung im
Chaco durchgeführt wurde.
Aus den drei Gemeinden der Chortitzer,
Sommerfelder und
Bergthaler kamen die mennonitischen Einwanderer. Die Ältesten waren Aaron Zacharias aus Saskatchewan und Martin C. Friesen aus
Manitoba von der
Chortitzer Mennonitengemeinde. In
Paraguay sollte nur eine
Gemeinde bestehen. Da der Älteste Aaron Zacharias zu den 171 Verstorbenen in der langen Wartezeit bis zur Ansiedlung auf dem eigenen Land gehörte, ergab es sich, dass Ältester Martin C. Friesen der alleinige Führer der
Gemeinde wurde. Es dauerte jedoch noch Jahre, bis alle einzelnen Gemeindeglieder aus Kanada sich dieser
Gemeinde, die die „
Chortitzer Mennonitengemeinde von
Menno" genannt wurde, unterstellten.
„Mennonitengeschichtlich stellt die Entwicklung der Gemeinden in der
Kolonie Menno, ebenso wie die des Schulwesens, eines der merkwürdigsten Phänomene dar: Die drei Gemeinden vereinigten sich in wenigen Jahren zu einer, und diese
Gemeinde machte wiederum die radikalsten Reformen durch, ohne dass es dadurch zu einer nennenswerten Zersplitterung kam." So schlussfolgert Peter P. Klassen in seinem Buch „Die
Mennoniten in Paraguay"
(7)
Wartezeit
In
Paraguay mussten die aus Kanada eingewanderten Personen fast 1 ½ Jahre warten, bis sie auf ihrem eigenen Land ansiedeln konnten, da das gekaufte Land nicht, wie vorher abgemacht, vermessen war und die
Eisenbahn noch längst nicht ins Siedlungsgebiet reichte. Während dieser langen Wartezeit wurde die
Gemeinde hart geprüft, denn durch Krankheiten starben während dieser Zeit 171 Personen, bevor sie überhaupt ins Siedlungsgebiet kommen konnten.
(8)
Gottesdienste
Schon in den Lagern während der langen Wartezeit wurden an den Sonntagen und Feiertagen Predigtgottesdienste abgehalten. Außerdem galt es, auf den vielen Begräbnissen mit dem Worte Gottes zu dienen und den trauernden und oftmals schier verzweifelnden Pionieren Trost zu spenden.
Als dann die Dörfer im Chacoinneren angelegt wurden, bauten die Siedler Schulhäuser und eine Kirche. Die erste Kirche wurde im Dorf Osterwick, wo auch Ältester Friesen ansiedelte, erbaut, und im September 1932 eingeweiht, während die erbitterte Schlacht um
Boquerón im
Chacokrieg ihren Lauf nahm.
Außer in dieser Kirche wurden in den Schulhäusern der Dörfer Andachten abgehalten. Die
Prediger gingen zu Fuß, ritten mit dem Pferd, falls sie eines hatten, oder fuhren mit dem
Ochsenwagen in die Dörfer, um ihren Predigtdienst zu erfüllen.
Gottesdienstgestaltung
Der Gottesdienst begann pünktlich um 9.00 Uhr. Diese
Tradition hat sich ja bekannterweise bei uns bis heute durchgesetzt. Die Vorsänger, die den Gesang anleiteten, kamen aus dem sogenannten Predigerstübchen, wenn eines vorhanden war, in die Kirche und nahmen vorne Platz. Einer der Vorsänger sagte ein Lied an, das dann von diesem angestimmt wurde. Nach und nach fiel dann die
Gemeinde in den Gesang ein.
Wenn das erste Lied zu Ende war, traten die
Prediger und der Diakon in die Kirche ein.
War der Älteste zugegen – er konnte ja nur auf einer Stelle dabei sein – ging er immer als erster voran hinter die Kanzel. Mitten in der Kirche auf dem Weg zur Kanzel blieb er stehen und grüßte die Versammlung mit den Worten: „Der Friede des Herrn sei mit euch!"
Wenn diese Platz genommen hatten, sagte ein zweiter Vorsänger ein Lied an, das dann gesungen wurde.
Danach trat der diensthabende
Prediger hinter die Kanzel um seine Botschaft zu bringen. Nach einer Einleitung wurde knieend gebetet. Daraufhin wurde die Botschaft, meistens im Leierton, vorgelesen.
Nach der Predigt betete die ganze Versammlung nochmals knieend.
Der dritte Vorsänger sagte ein letztes Lied an, das von der Versammlung gesungen wurde.
Am Schluss sprach der dienende
Prediger den Segen über die Versammlung, womit der Gottesdienst abgeschlossen war.
Still gingen die Gottesdienstbesucher hinaus und fuhren bzw. gingen heim.
Predigten wurden wiederholt verwendet, auch in derselben Kirche. So kam es vor, dass eine einzige Predigt bis zu 45 mal vorgetragen wurde. Eine Predigt wurde in Grüntal, Kanada, von 1884 bis 1923 25 mal in derselben Kirche vorgetragen, so dass der
Prediger sicherlich nicht so viele Predigten auszuarbeiten hatte.
In der Kirche wurde streng getrennt gesessen. Die Frauen an der linken Seite, von der Kanzel aus gesehen, und die Männer an der rechten Seite. Jede Gruppe hatte eine Tür, um ein- bzw. auszutreten. Nach dem Eintritt in die Kirche beteten die älteren Gemeindeglieder ein stilles Gebet. Erzählt werden durfte in der Kirche nicht.
Feste
An
Weihnachten, Ostern und Pfingsten wurden am ersten und zweiten Feiertag Andachten gehalten. Zusätzlich wurde noch der dritte Feiertag gehalten, aber ohne eine offizielle Andacht durchzuführen. Er diente grundsätzlich dazu, Familienfeste durchzuführen.
An Pfingsten gab es immer Tauffeste.
Die Jugendlichen, die „bei
Gemeinde" gehen wollten, das heißt, die sich taufen lassen wollten, mussten in der Zeit davor ab Ostern pünktlich an den Gottesdiensten teilnehmen.
Wer getauft werden wollte, ließ sich am zweiten Sonntag nach Ostern zuerst durch den Vater in der Kirche anmelden, und dann anschließend zusätzlich noch zweimal von einem Zeugen, den er dazu selber befragt hatte. Am Sonntag vor Christi Himmelfahrt und am Himmelfahrtstag musste der
Katechismus in zwei Teilen vor der gesamten
Gemeinde aufgesagt werden.
Das erste Tauffest wurde dann am ersten Pfingstfeiertag in der Hauptkirche durchgeführt. Am Nachmittag und jeweils am Vor- und Nachmittag des zweiten Feiertags wurden in anderen
Kirchen bzw. Schulhäusern Tauffeste abgehalten, wenn die Notwendigkeit bestand. Es ergab sich auch manchmal, dass sogar an Werktagen Tauffeste gefeiert wurden, weil die Pfingstfeiertage nicht ausreichten, um überall die Taufhandlungen zu vollziehen. Bei all diesen Festen wurde dann noch anschließend das Heilige
Abendmahl mit der
Gemeinde gefeiert. Dass heißt, am ersten Sonntag nach Pfingsten wurde eine Vorbereitungspredigt zum
Abendmahl gehalten, und am darauffolgenden Sonntag führte man dann das
Abendmahl durch.
Der Grund dieser Verteilungsform der Tauffeste war, dass nur der Älteste die Tauf- und Abendmahlshandlungen durchführen durfte. Er konnte nicht alles an den Feiertagen bewerkstelligen, weil die Transportmöglichkeiten es nicht ermöglichten oder die Feiertage nicht reichten.
Am Sonntag nach dem
Abendmahl gab es eine Danksagungspredigt für das abgehaltene Heilige
Abendmahl. Erst danach durften dann Verliebte ihre Verlobung feiern und bekanntgeben. Die Verlobungsfeier fand normalerweise am Samstagnachmittag im Heim der Braut statt. Wie uns Mennos bekannt ist, findet heute die Verlobung normalerweise auf dem Hof der Eltern des Bräutigams statt. – Diese Wandlung hat sich wahrscheinlich deshalb vollzogen, weil es Familien gab, wo nur Jungen waren, und so konnten diese auch wenigstens ein Fest vorbereiten. Die Hochzeit läuft ja schon auf Kosten der Brauteltern. – Am Sonntag darauf wurde das Brautpaar dann in der Kirche aufgeboten. Zwölf Tage nach dem Aufgebot in der Kirche, am Freitag, durfte dann die Hochzeit gefeiert werden. Diese Sitte wurde auch strikt eingehalten.
Außerdem gab es im Rahmen der
Gemeinde nur noch Hochzeiten, Begräbnisse und Bruderberatungen. Weitere Programme, zum Beispiel für Teenager, Jugendliche oder sogar die Sonntagsschule gab es keine.
An den normalen Sonntagsgottesdiensten wurden in den
Kirchen keine Kollekten eingesammelt. Diese wurden am Erntedanksonntag und am Abendmahlssonntag eingesammelt. Das geschah, indem die Gemeindeglieder das Geld in den sogenannten Gotteskasten, welcher neben der Kirchentür angebracht war, einlegten.
Erste Reformansätze
In den fünfziger Jahren fing man an einigen Stellen mit Singstunden an. Zuerst wurde in Heimen gesungen, wozu sich zumeist jugendliche Gruppen versammelten, etwas später dann in den
Dorfschulen, weil sehr oft die Lehrer die Dirigenten waren. Erst in den sechziger Jahren begann man mit dem Chorgesang in den Gottesdiensten, obwohl man auch damals noch auf erheblichen Widerstand stieß.
Auch wurden seitdem, zuerst auch nur vereinzelt, Bibelstunden abgehalten. So unternahm man in dieser Zeit auch erstmalig die ersten Schritte zur Organisation der Jugendarbeit.
Dies alles geschah zur Zeit des Ältesten Martin C. Friesen, der sein Ältestenamt, das er 1925 in Chortitz, Kanada, angetreten hatte, im Jahre 1966 in
Menno niederlegte.
Weitere Veränderungen in den Gottesdiensten und im Rahmen der Gemeindearbeit wurden erst in den siebziger Jahren eingeführt.
Als ich – Abraham S. Wiebe – 1973 zum Ältesten gewählt und eingesetzt wurde, hat die
Gemeinde auf einer
Bruderberatung folgendes beschlossen:
Dass jeder ordinierte
Prediger seitdem befugt sei, das Heilige
Abendmahl an die
Gemeinde auszuteilen.
Die Taufhandlung durfte der Ex-Älteste, der amtierende Älteste, der Gehilfe sowie der Missionar (Die
Gemeinde hatte schon seit den fünfziger Jahren jeweils in Nord- und
Südmenno einen Missionaren für die Arbeit unter den Indianern) vollziehen.
Die Aufteilung der Gemeinden in Nordmenno
Als der Gemeindeälteste von Nordmenno 1974 einmal auf einer
Prediger– und Diakonenberatung den Gedanken von einer Aufteilung der großen
Gemeinde in Nordmenno vorlegte, wurde der Gedanke von mehr als 30 Teilnehmern abgelehnt. Nur eine Person unterstützte diese Idee. Langsam reifte jedoch dieser Gedanke, bis man dann in den Jahren 1977 und besonders 1978 Vorbereitungen treffen konnte, um die große
Gemeinde in Nordmenno in kleinere Lokalgemeinden aufzuteilen.
Man hatte den geografischen Aufteilungsplan so gemacht, dass es fünf Lokale geben sollte. Die bis dahin einzige große
Gemeinde Nordmennos hatte schon zehn
Kirchen aufgebaut, wo sonntäglich Gottesdienste gefeiert wurden.
Am Ende des Jahres 1978 wurde die große
Gemeinde dann in fünf Lokalgemeinden aufgeteilt, die ab Januar 1979 selbständig voneinander funktionierten, jedoch in einer
Konferenz zusammengeschlossen blieben:
- Die Schöntal Mennonitengemeinde mit Osterwick und Umgebung. Dazu gehörten die zwei Gotteshäuser in Osterwick und Schöntal.
- Die Mennonitengemeinde von Loma Plata mit einem Gotteshaus in Loma Plata.
- Die F.N.B. Mennonitengemeinde in den südlichen Dörfern von Nordmenno mit den drei Gotteshäusern in Friedensfeld, Neuhof und Buena Vista.
- Die Eigenheim Mennonitengemeinde im Osten von Nordmenno mit den Kirchen in Bergthal und Eigenheim als Versammlungsräumen.
- Die Mennonitengemeinde von Weidenfeld und Umgebung, mit den zwei Gotteshäusern in Weidenfeld und Grüntal. Diese Gemeinde zögerte noch einige Monate, bis sie sich schließlich doch eigenständig organisierte und die fünfte Lokalgemeinde in Nordmenno bildete.
Die Umstrukturierung
Nach der Aufteilung der großen
Gemeinde in Nordmenno in mehrere kleine Lokalgemeinden beendigte die
Mennonitengemeinde in
Menno das Ältestensystem. An Stelle des Ältestenamtes übernahm die
Gemeinde das Gemeindeleitersystem, bei dem ein Leiter auf eine festgelegte Zeit – drei Jahre – von der jeweiligen Lokalgemeinde gewählt wurde. In allen Gemeinden ist dieser Wahlmodus bis heute bestehen geblieben.
Wahlsystem
Bis in die siebziger Jahre wurden die
Prediger und Diakonenkandidaten von der
Gemeinde gewählt. Anschließend wurde dann durch das Los entschieden, wer von den Kandidaten der einzusetzende Gemeindediener würde.
Dieses Lossystem musste dann jedoch dem Wahlsystem, bei dem durch Wahlzettel mit Stimmenmehrheit die Dienstposten besetzt wurden, weichen. Statt durch Losentscheidung musste ein Kandidat 50% plus eine der Wählerstimmen erreichen, um in das jeweilige Amt eingeführt zu werden.
Die neu entstandenen Lokalgemeinden schlossen sich, wie schon erwähnt, zu der „
Nordmennokonferenz" zusammen. Es wurde ein Statut erarbeitet, welches diesem Zusammenschluss als Richtlinie diente.
Aus den ursprünglich fünf Lokalgemeinden in Nordmenno sind bis heute elf geworden. Diese weitere Aufteilung ist Folge des beständigen Wachstums der schon bestehenden Gemeinden.
Im Jahre 1948 wurde südlich der alten
Kolonie von der Verwaltung ein Landstück gekauft, auf dem viele Familien ansiedelten. Zwei Jahre wurde die
Gemeinde der Siedlung von der sogenannten „Alten
Kolonie" (Nordmenno) aus betreut, bis es eine Aufteilung gab, die anfänglich auf Widerstand stieß.
Aus Entfernungsgründen organisierte man dort also eine eigenständige
Gemeinde und wählte bald einen Ältesten, um diese zu leiten. Das Ältestenamt in dieser neuen
Gemeinde wurde
Prediger Martin T. Dück übergeben. Längere Zeit wurde diese
Gemeinde noch teilweise mit bzw. von der Nordmenno
Gemeinde geführt. Zum Beispiel wurde in der
Gemeinde in
Südmenno kein separates Gemeinderegisterbuch und kein Konto für die Missionsgelder nach außen geführt, sondern bis in die siebziger Jahre hinein in Zusammenarbeit mit der schon bestehenden
Gemeinde in Nordmenno.
In den achtziger Jahren teilte sich die schon große
Gemeinde in
Südmenno in drei Lokalgemeinden auf:
Mennonitengemeinde Paratodo,
Mennonitengemeinde Lolita und die
Mennonitengemeinde von
Lichtenau. Äußerlich haben sich diese drei Gemeinden in der „
Südmennokonferenz" zusammengeschlossen.
Schlussgedanken
Die ganze Reformierung und Aufteilung der Gemeinden in
Menno hat bisher zu keinerlei Spaltung geführt, obwohl manches Mal Meinungsverschiedenheiten (meistens verursacht durch Äußerlichkeiten) bestanden, die jedoch zufriedenstellend gelöst werden konnten.
Eine kleine Gruppe, die den Fortschritt bzw. die Erneuerungen der
Gemeinde und Schulen nicht mitmachen wollte, suchte 1958 in Bolivien eine neue Heimat. Andere meinten, dass sie dann auch in Kanada hätten wohnen bleiben können, von wo sie der Reformen halber ausgewandert waren, und zogen in den fünfziger und sechziger Jahren dorthin zurück.
– In den neunziger Jahren hat sich zum ersten Mal ein kleine Gruppe abgespaltet oder unabhängig gemacht und eine eigene
Gemeinde gebildet, weil sie mit der bestehenden Gemeindeform nicht einverstanden war. Diese
Gemeinde nennt sich „Evangelische Missionsgemeinde".
In den siebziger Jahren fingen die Gemeinden mit der Einführung der Sonntagsschule an, um die Kinder bis zum 15. Lebensjahr in der biblischen Unterweisung anzuleiten. Hinzu kamen später die Jungschar und Jugendarbeit, die erheblich erweitert und intensiviert wurde.
Ein Taufunterricht für Personen, die sich zur
Taufe gemeldet hatten, wurde eingeführt, um ihnen die Bedeutung der
Taufe und
Nachfolge bewusster zu machen. Diese Erneuerung wurde schon in den sechziger Jahren eingeführt. Seit den siebziger Jahren wurde auch ein Nachfolgekurs für neugetaufte Gemeindeglieder eingeführt.
Seit den sechziger Jahren haben die Nordmenno-Gemeinden bzw. die
Nordmennokonferenz eine eigene Bibelschule. Hier kann man sich allgemeine Bibelkenntnisse aneignen. Außerdem werden viele spezielle Kurse für Sonntagsschullehrer, Diakone,
Prediger, Jugendarbeiter, Gesangleiter, Missionsarbeiter und andere geboten, um dadurch tüchtige Gemeindearbeiter heranzubilden.
Auf der Ebene der Südamerikanischen
Konferenz (S.A.K.) haben wir Anteil am Bibelseminar „
CEMTA", wo auch schon manche der heutigen
Prediger und Gemeindeleiter eine intensive theologische Ausbildung erhalten haben.
Durch die Aufteilung der großen
Gemeinde in
Menno ist viel Segen geflossen. Besonders auch, weil die Verantwortung und die Aufgaben auf viel mehr Personen verteilt wurden, und somit die Gemeindeglieder viel besser betreut werden konnten.
Bei alledem empfinde ich, dass die Aufteilung einen Mangel aufzuweisen hat: Wir haben nicht einen Lehrer, der danach sieht, dass die
Gemeinden von Menno nicht von den biblischen Wahrheiten und Werten abweichen. Durch die vielseitige Aufteilung besteht leichter die Gefahr, dass eine Lokalgemeinde von den Wahrheiten und Werten der
Bibel abweichen könnte. Gleichzeitig besteht in der Teilung der großen Gemeindegliederzahl Mennos auch ein großer interner Reichtum, der sich segensreich weit über die eigenen Grenzen hinaus bemerkbar machen kann und sollte.
Literaturverzeichnis
- Adina Reger und Delbert Plett, Diese Steine, Die Russlandmennoniten, Crossway Publications Inc. Steinbach, 2001
- Friesen, Martin W., Neue Heimat in der Chacowildnis, 2. Auflage, 1997
- Protokolle der Gemeindevorstandssitzungen
- Klassen, Peter P., Die Mennoniten in Paraguay, Band 1, 2001
- Protokolle und Schriften zur Menno-Geschichte
Fussnoten:
| Gemeindeleiter der Elim Gemeinde in Loma Plata, letzter Ältester der in Nordmenno tätig war, und die Lokalgemeinden organisierte. |
| Friesen Martin W., Neue Heimat in der Chacowildnis, Seite 18. |
| ebd., Seite 20. |
| ebd., Seite 20. |
| Reger Adina und Plett Delbert, Diese Steine Die Russlandmennoniten, Crossway Publications Inc., Steinbach 2001. |
| ebd., Seite 341. |
| |
| Giesbrecht Abram B., Die ersten mennonitischen Einwanderer in Paraguay – 1994. |
Die Verwaltung der Menno-Siedler im Chaco Gegenwart und Zukunftsperspektiven
Gustav T. Sawatzky
Die Auswanderung der Mennoniten aus Preußen wurde von der
Gemeinde organisiert und führte zur Ansiedlung am Dnjepr, konkret am Nebenfluss „Chortiza" in Russland im Jahre 1789.
Erbe von Russland
Die erste Siedlerverwaltung in Russland bestand aus einem Oberschulzen und einem Gebietsleiter.
Die Mennoniten in Russland hatten eine kommunale Selbstverwaltung, die den russischen Behörden unterstellt war. So hatte die russische Regierung 1763 ein Extraorgan zur Überwachung aller ausländlischen Kolonisten gegründet. Dieses Organ erhielt den Namen „Pflegschaftskanzlei". Es überwachte die mennonitischen Siedlungen mit ihrer Selbstverwaltung. Aber nicht nur die Mennoniten wurden von der Pflegschaftskanzlei überwacht, sondern sämtliche Kolonisationen verschiedener Völkergruppen überhaupt.
Im Jahr 1818 hatte dieses Verwaltungsbüro den Namen „
Fürsorgekomitee" erhalten und war für alle ausländische Kolonisten im südlichen Russland zuständig. Das
Fürsorgekomitee in Russland war also keine mennonitische Organisation, auch nicht speziell für die Mennoniten geründet worden, zumal es 1763 noch keine Mennoniten in Russland gab.
Später (1871) wurde es aufgelöst und die mennonitischen Siedlungen wurden direkt den russischen Provinzialregierungen und Autoritäten unterstellt.
Dies hatte zur Folge, dass sich die Mennoniten in ihrer Lebensweise eingeschränkt fühlten, weil mit der Integration der Selbstverwaltung in die Provinzialregierung ihrer Ansicht nach auch ihre Prinzipien (eigenes Schulwesen, Religionsfreiheit, Befreiung vom Militärdienst) in Gefahr standen. Diese Gründe führten unmittelbar zur Vorbereitung der Auswanderung nach Kanada.
Organisation in Kanada
In den Jahren 1874 – 1876 siedelten 7000 Mennoniten aus Russland in
Manitoba Kanada an. Die wirtschaftliche sowie auch die administrative Organisation, die in Russland herrschte, wurde direkt auf ihre neue Heimat in
Manitoba, Kanada, übertragen.
Der
Bergthaler Oberschulze Jacob Peters aus Russland, wurde somit der erste
Oberschulze der Mennoniten in Kanada. Dieser wurde auch von der Kleingemeinde anerkannt und verwaltete ihre Dörfer. Der erste
Oberschulze von Fürstenland (Russland) war Isaak Müller.
In den achtziger Jahren griff die Regierung Manitobas in das Verwaltungswesen der Siedlungen ein. Die Verwaltung wurde mehr und mehr der Provinz- und Föderalregierung angepasst.
Dieser Eingriff traf direkt den empfindlichen Nerv der Mennoniten, weil altgewohnte Lebensweisen geändert wurden (z.B. geschlossene Dorfgemeinschaften 64 ha Landwirtschaften – Dorf).
Das betraf die Mennoniten zutiefst, weil die Verwaltungsformen ja auch ein wesentlicher Grund der Auswanderung aus Russland gewesen waren.
All diese Widerwärtigkeiten führten dazu, dass sich die Mennoniten nach anderen Ländern umsahen und eine Auswanderung in Erwägung zogen. Der Blick war jetzt auf Südamerika gerichtet (1919 – Mc. Roberts).
Als im Jahre 1919 das Zwangsschulgesetz in Kanada eingeführt und die staatlichen Schulen im Distrikt der Chortitzer Mennoniten (
Ostreserve) eingerichtet wurden, wurde die Frage der Auswanderung wieder akut. Am 11. Februar 1921 ging die zweite Delegation (die erste im Jahr 1919 nach Argentinien und Brasilien) nach
Paraguay auf Landsuche.
Nach der Rückkehr dieser Delegation aus
Paraguay wurde ein
Auswanderungskomitee ins Leben gerufen, das sich speziell mit der Auswanderungsfrage zu befassen und Lösungen zu suchen hatte. Zu seiner Aufgabe gehörte u. a. auch die Veräußerung der Besitzgüter und Wirtschaften. Dieses
Auswanderungskomitee war die erste Siedlerverwaltung der Siedler, die sich vorbereiteten, um nach
Paraguay auszuwandern.
Im November 1922 wurde das
Auswanderungskomitee durch das
Fürsorgekomitee abgelöst (zweite Verwaltung der Siedler). Der Name „
Fürsorgekomitee" stammt, wie vorhin erwähnt, aus Russland.
Die Form dieses Fürsorgekomitees, das sich mit dem Verkauf der Wirtschaften in Kanada befasste, nahm man direkt auch in
Paraguay als Verwaltungsmodell.
Die nordamerikanische Zeitung „The Literary Digest" äußerte sich 1927 wie folgt über die Konzession der paraguayischen Regierung den Mennoniten gegenüber.
„Eine ungewöhnliche Konzession ist einer Gruppe kanadischer Mennoniten von der parag. Regierung gemacht worden, eine Konzession, wie sie wohl sonst wo nicht in der Welt zu bekommen wäre, wie jemand sagte, nämlich Freispruch vom Militärdienst, das Recht, ihre eigenen Schulen zu haben und in ihrer eigenen Sprache zu unterrichten, den Eidschwur abzulehnen und eine absolute selbstgeleitete Kontrolle über ihre Siedlung zu haben."
„Das war von der parag. Regierung ein sehr vertrauensvolles Zugeständnis an die Chacosiedler. Es war aber auch eine enorme Zumutung an ihr eigenes Können. Hatten sie doch bis dahin noch niemals eine umfassende Selbstlenkung und Selbstüberwachung geübt. Auf dieser Linie der sozialen und wirtschaftlichen Selbstverwaltung waren sie also absolut unerfahren. Womit sie vertraut waren, das war die Leitung einer traditionell verwurzelten religiösen Gemeinschaft mit Einbeziehung der schulischen Belange ihrer von den Gemeinden geführten Privatschulen".
(2)Tatsächlich wurde die wirtschaftliche Siedlerverwaltung damals als zweitrangig betrachtet. Sie lebten nach dem Motto Matthäus 6, 33: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit, so wird euch solches (das wirtschaftliche Notwendige) alles zufallen". Sie hatten wohl keine konkrete Vorstellung von einer Verwaltung dieser Art und auch keinen grundlegenden Plan dafür, um nicht zu sagen, keine Ahnung von der Handhabung dieses Verwaltungssystems.
Das Schema für die Verwaltungsorganisation in
Paraguay war in groben Zügen von etlichen Männern ausgearbeitet und von einigen Rechtsanwälten in
Asunción bearbeitet worden.
„Am 19. Juni 1928 wurde es dann im Verwaltungsbüro des Friedensrichters in Puerto Casado dem mennonitischen Gremium der Verwaltungsinstitution vorgelegt".
Es bestand darin eine Dreiergruppenvertretung aus folgenden Personen:
Ost Reserve: Martin C. Friesen, und Abram A. Braun.
West Reserve: Isaak K. Fehr und Bernhard F. Penner
Saskatchewan: Peter Peters und Korni H. Wiebe.
Der Vorsitzende war Isaak K. Fehr (erster
Oberschulze in
Paraguay).
Die Aufgaben/Begugnisse des Fürsorgekomitees waren unter anderem:
Im Gebiet des paraguayischen
Chaco zu kolonisieren.
Materielle und moralische Unterstützung zu vermitteln, wo solche nötig ist, sei es Erleichterung für die Einrichtung und Entwicklung der Siedlung zu schaffen oder Kreditoperationen in Form von Darlehen zur Förderung der Siedlung zu vermitteln.
Handelsgeschäfte zu unternehmen im Inland wie im Ausland.
Hypothekenverträge und andere Arten von Garantien abzuschließen.
Alle durch die Gesetzte erlaubten Befugnisse auszuüben, wie sie einer juristischen Person verliehen sind.
Im Allgemeinen alle Handlungen auszuführen, die nützlich sind und dazu dienen, die in
Paraguay ansässigen mennonitischen Siedler zu schützen und zu unterstützen.
Da die Bürger in diesem
Fürsorgekomitee in sehr ungleicher Weise vertreten waren, entstanden einige Schwierigkeiten. Laut Statut war dieses
Fürsorgekomitee mit zwei Drittel Stimmenmehrheit befugt, Beschlüsse zu fassen. D.h. konkret, dass die Vertreter von 20% der Bürger über die Vertreter von 80% der Bürger Entscheidungsbefugnis hatten. (Die beiden kleinen Gruppen waren wirtschaftlich stärker – Geld war auch damals schon
Macht).
Die
Ostreserve (Chortitzer
Gemeinde) wählte zwei weitere Mitglieder ins
Fürsorgekomitee: Jacob A. Braun und Johan R. Dörksen.
Diese konnten aber gesetzlich nur die früheren zwei ersetzen.
Als die Vertreter der
Ostreserve nach mehreren Reformversuchen keine Reform des Verwaltungsrates des Fürsorgekomitees erwirken konnten, sahen sie sich gezwungen, auf das 1927 ins Leben gerufene „
Transportkomitee" zurückzugreifen. Es war zwar ein von den Bürgern gewähltes Komitee, hatte aber keine gesetzlich geltende Vollmacht, sondern tat das Notwendigste für die Siedler. Man kann dieses als eine Parallelverwaltung zum Fürsorgekomite verstehen. Die Gründe der Reform waren lediglich darauf zurückzuführen, dass das
Fürsorgekomitee nicht auf die Bedürfnisse und Notwendigkeiten der Siedler reagierte und die ungleiche Vertretung der Mitglieder im
Fürsorgekomitee, die meines Erachtens als zweitrangig zu betrachten ist.
So gab es in der Zeit von 1932 bis 1935 zwischen dem
Fürsorgekomitee und dem
Transportkomitee viele Spannungen.
Die erste Audienz beim damaligen Landespräsidenten zeigt die Auswegslosigkeit der Siedler und ihrer Verwaltung, sie baten den Präsidenten um Rat.
Als nach mehreren Bittgesuchen bei der damaligen Regierung die Anerkennung einer neuen Verwaltungsform nicht vorwärts kam, die Sache aber in der
Kolonie ausgereift war, stellte der Gemeindevorstand im Juni 1935 die gewählten Mitglieder des neuen Verwaltungsrates
Chortitzer Komitee an, obzwar die gesetzliche Anerkennung des Chortitzer Komitees noch auf sich warten ließ. Man wählte fünf Ratsmitglieder und einen
Vorsteher.
Diese sechs Personen bildeten das Direktorium „
Chortitzer Komitee". Es wurden weitere 33 Personen gewählt, Gesellschafter genannt, die als solche eingetragen waren und das Rückgrad der neuen Verwaltung
Chortitzer Komitee bildeten.
Dieses Direktorium mit den 33 Vertretern musste nun am 30. Juli 1936 in Puerto Casado (bzw.
Pozo Azul) vor dem Richter Hipólito Portillo das neu von der Bürgerversammlung verabschiedete Statut unterschreiben. (Statut der Sociedad Civil
Chortitzer Komitee – 1936). Damit war die Selbstverwaltung der
Kolonie Menno, so wie im Gesetz N°514 formuliert, endgültig legitimiert worden. (Was in Russland und in Kanada in dieser Form nicht der Fall gewesen war).
Das Ziel, das 90% der Bürger unterstützten, nämlich eine gleichmäßige Vertretung in der Verwaltung zu haben, war jetzt erreicht.
Die Mitglieder der Verwaltung wurden jedes Jahr auf der Generalversammlung neu bzw. wieder gewählt. Eine Amtsperiode betrug zwei Jahre für die Mitglieder und anfänglich ein Jahr für den
Vorsteher. Um eine Kontinuität in der Verwaltung zu gewährleisten, durften nicht alle Mitglieder zur gleichen Zeit neu gewählt werden. (In unserem heutigen Wahlstatut ist dieses Prinzip unverändert beibehalten worden).
Das zu verwaltende Vermögen betrug damals 400.000 paraguayische Pesos, 1500 argentinische Pesos und 42.360 ha Land (Land der
Ostreserve/
Westreserve hatte 13.500 ha, das nicht im Statut von 1936 figuriert), das auf den Namen des Fürsorgekomitees stand und gelegentlich auf die Sociedad Civil
Chortitzer Komitee übertragen werden sollte. (Das
Fürsorgekomitee wurde in den fünfziger Jahren aufgelöst und das Land wurde erst in den sechziger Jahren auf das
Chortitzer Komitee übertragen). Außer dieses Vermögen zu verwalten hatte die Verwaltung folgende Aufgaben zu bewältigen:
- Kolonisierung der paraguayischen Erde im Chaco.
- Moralische und materielle Hilfe bei der Gründung oder Entwicklung der Kolonien zu leisten.
- Kredite und Darlehen zur Entwicklung der Kolonie aufzunehmen und zur Hilfe für die Bürger.
- Grundstücke, bewegliches Gut und Vermögen verschiedener Art in und außerhalb der Republik zu besitzen.
- Fabrikmarken, Handelsmarken und Tiermarken zu besitzen und zu registrieren.
- Vertretung, Kommission, Konsignation auszuüben. Agenturen und Vertretungen in und außerhalb der Republik zu gründen.
- Pfand – Kontrakte, Hypotheken und andere Garantieformen zu tätigen
- Alle Vollmachten die durch die Gesetze und besonders durch den Código Civil (Zivilgesetzbuch) der juristischen Person bewilligt worden sind, auszuüben.
Die neue Verwaltung, des
Chortitzer Komitee hatte nun die große Aufgabe, das Siedlungsprojekt der
Kolonie Menno nach diesen Zielsetzungen voranzutreiben. (1928 – 14 Dörfer und in den vierziger Jahren – 33/34 Dörfer).
Ab 1936 funktionierte das
Chortitzer Komitee (3. Verwaltung) ohne weitere Schwierigkeiten. In dem Maße, wie sich die
Kolonie ausdehnte, kamen in der Verwaltung mehr Mitglieder dazu. So zählte der Verwaltungsrat im Jahre 1940 – sechs Mitglieder und einen
Vorsteher.
Im Jahre 1948 machte die
Kolonie Menno wohl ihren größten
Landkauf in der Geschichte. Es waren die 63 Leguas = 118.000 ha. Es kamen zwei weitere Mitglieder in den Verwaltungsrat, was mit der Erweiterung bzw. Gründung der Paratodo-Siedlung 1948 zusammenhing. 1950 waren es elf Mitglieder und 1961 findet man in den Verwaltungsrat-Protokollen erstmalig zwölf Mitglieder im Verwaltungsrat. Im Jahr 1947 wurde ein Geschäftsführer angestellt, zuerst teilzeitig, später vollzeitig.
Eine entscheidende Änderung war die Gründung der Sociedad Cooperativa Colonizadora
Chortitzer Komitee im Jahr 1961 – 62.
Diese
Genossenschaft verfolgte wirtschaftsspezifische Ziele:
- Die wirtschaftliche Entwicklung seiner Mitglieder anzustreben, zu fördern, zu organisieren und zu realisieren.
- Die Intensivierung des landwirtschftlichen Anbaus und deren Mechanisierung zu fördern.
- Die Produktionssteigerung der Molkereien, Ackerbau- und Viehzuchtbetriebe voranzutreiben.
- Die Verarbeitung von Rohstoffen und Fertigprodukte und Industrieerzeugnisse für den internen Bedarf und für den Export vorzubereiten.
- Die Einrichtung von Konsumläden zur Versorgung ihrer Mitglieder.
- Die Anschaffung von Luft-, Land- und Flusstransportmittel für die Beförderung der Produktion.
- Die Schaffung sanitärer, medizinischer und zahnärztlicher Dienstbetriebe sowie kultureller Einrichtungen.
Im Gründungsstatut der Kooperative von 1961 sieht man, dass der Verwaltungsrat sich wieder aus neun Mitgliedern zusammensetzte. Laut den Protokollen der Verwaltungsratsitzungen variert die Zahl aus mir unbekannten Gründen zwischen zehn und elf Personen.
Im Jahr 1977 wurden
Lichtenau und Grünau in zwei Bezirke geteilt. Ab dann führen wir regelrecht zwölf Verwaltungsratmitglieder und einen Oberschulzen im Verwaltungsrat der
Kolonie Menno.
Seit der Gründung der Sociedad Cooperativa Colonizadora
Chortitzer Komitee ist auch der Aufsichtsrat auf den Verwaltungsratsitzungen präsent. 1980 – 82 gab es zwei stellvertretende Aufsichtsratmitglieder, 1983 und 1984 jeweils einen. Später tauchen keine Stellvertreter mehr auf.
Die Verwaltungen der
Kolonie Menno gingen durch Höhen und Tiefen. Die Verwaltungsform der Nachbarkolonie
Fernheim (1930 gegründet) hat wesentlich zur Stabilisierung unserer Verwaltung in
Menno beigetragen. In diesem Aspekt haben die Mennoverwaltungen vieles von den Fernheimern gelernt und übernommen.
Ab 1961 – 62 galt es nun zwei legitime Institutionen zu verwalten; die Sociedad Civil
Chortitzer Komitee und die Sociedad Cooperativa Colonizadora
Chortitzer Komitee.
Die Verwaltung dieser beiden Institutionen ging immer Hand in Hand. Die Verwaltungsform hat sich bis heute nur insofern verändert, als die beiden Institutionen gewachsen sind (Heute 9 Betriebsleiter in der
Asociación Civil und 13 in der
Genossenschaft. Einige sind für beide Institutionen tätig, weil die Betriebe ineinandergreifende Funktionen haben).
In dem großen Verwaltungsapparat der
Kolonie Menno haben sich bis heute 11 Oberschulzen, 137 Verwaltungsratmitglieder und 34 Aufsichtsratmitglieder bedingungslos für unser Gemeinschaftswerk in der
Kolonie Menno eingesetzt.
Oberschulze und Verwaltungsrat – heute
So sieht das Statut der
Genossenschaft, das 1994 neu überarbeitet und dem Kooperativgesetz angepasst wurde, einen Verwaltungsrat mit acht oder mehr Mitgliedern vor. Das Statut der
Asociación Civil Chortitzer Komitee vom 14. September 2000 sieht es genau so vor, mit der einen Ausnahme, dass der stellvertretende
Oberschulze auch auf der ersten regulären Verwaltungsrat-Sitzung von diesem bestimmt wird.
Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass bei der
Asociación Civil Chortitzer Komitee der Vorsitzende bei Stimmengleichheit entscheidet. In der
Genossenschaft ist der Verwaltungsrat in einer ungleichen Zahl vertreten, wo der Vorsitzende bei gleicher Stimmenzahl die Entscheidung trifft. Die Befugnisse und Pflichten des Verwaltungsrates sind in beiden Statuten klar definiert, die in Zweifelsfällen gegebenenfalls interpretiert werden, immer mit der Absicht, dass sie die in den Statuten festgelegten Ziele zum Wohl ihrer Mitglieder im Auge behalten.
Hatten es unsere Vorfahren mit verschiedenen Herausforderungen wie Lebensmittelbeschaffung, Landbeschaffung u.a. zu tun, so ist die Problematik heute ganz anders. Die
Genossenschaft verfügt heute über ein Vermögen von 100.000.000.- US Dollar. Wenn die Verwaltung in den Anfangsjahren es mit drei Gruppen und verschiedener Auffassungen zu tun hatte, so hat sich dieses bis heute in manchen Fällen nicht geändert, nur erscheinen die Meinungsverschiedenheiten und Auffassungen der Bürger in einer anderen Form. Klar definierte Aufgaben für die Verwaltung müssen wahrgenommen und entschieden werden. Die Denkweise, dass der
Oberschulze höchste Autorität ist, auch in der Gerichtsbarkeit, ist bei manchen Bürgern bis heute so geblieben. Wir Mennobürger sind immer noch ein oberschulzengläubiges Volk und meinen, dass der
Oberschulze sich in bestimmten Fällen über alle Verordnungen hinwegsetzen soll, um konfliktive Situationen zu Gunsten einzelner Bürger zu lösen.
Wir erwarten vom Oberschulzen – wohlgemerkt nicht vom Verwaltungsrat, dass er Probleme, die eine gesetzliche Lösung erfordern nach eigenem Gutdünken löst. Die Bürger sehen den Verwaltungsrat immer noch losgelöst vom Oberschulzen. Das Verwaltungsgremium muss aber als ganzes angesehen werden, in dem der
Oberschulze nichts weiteres als ein Koordinator und Teamleiter ist. Persönliche Auffassungen oder Interessen der Verwaltungsratmitglieder spielen in der Glaubwürdigkeit wie auch in der Arbeit der Verwaltung eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Das demokratische Denken scheint sich schwer zu entwickeln. Nicht entsprechendes demokratisches Denken bringt uns allzuoft in Schwierigkeiten. Am stärksten sieht man dies bei Abstimmungen. Mehrheitsbestimmungen werden andiskutiert, kritisiert, in Frage gestellt und mit dem schwachen Argument „ich war nicht dafür" oder „ich war nicht zugegen" untermauert. Das trifft auf allen Ebenen zu, im Verwaltungsrat wie auch in der Bürgerschaft. Ein sehr häufiger Ausspruch, den man oft richtig missbraucht, ist der Bürgerwille oder die Meinung der Bürger. Klargestellt sei hier, dass es überhaupt keine Volks- oder Bürgermeinung gibt, es handelt sich in den allermeisten Fällen um die Meinung einzelner einflussreicher Personen. Diese manipulieren unkritisch denkende Bürger, um ihre Ziele zu erreichen unabhängig davon, ob sie der Gemeinschaft dienlich sind oder nicht.
Was immer wieder auffällt ist, dass unsere früheren Verwaltungen konsequenter Beschlüsse durchführten, als es heute manchmal der Fall ist. Heute identifizieren sich Verwaltungsratmitglieder zu wenig mit ihrer Arbeit und mit ihren eigenen Mehrheitsbeschlüssen, in dem sie im Handumdrehen institutionelle Beschlüsse ändern und zu wenig Wert auf Kontinuität legen. Natürlich hängt viel davon ab, wie die Führungskräfte diesem Druck widerstehen.
Gegenwärtig steckt unser Land in einer tiefen Wirtschaftskrise. Bemerkenswert dabei ist, dass diese nicht einmal unser größtes Problem ist, sondern das sind wir selbst.
Wieviel Zeit und Geld wir dabei verlieren, ist uns wohl noch nicht bewusst. Vielleicht begreifen wir dies, wenn es uns wirtschaftlich noch schlechter geht.
Umstrukturierung des Verwaltungsrates:
Im Jahre 1999 wurde in diesem Rat eine interne Umstrukturierung vorgenommen. Sämtliche Betriebe wurden der
Asociación Civil und der Sociedad Cooperativa Colonizadora
Chortitzer Komitee zugeordnet. Jede der beiden Institutionen erhielt jeweils zwei Abteilungen der die Betriebe nach Zweck und Ziel zugeordnet wurden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates teilten sich in vier Gruppen auf, wobei jede Gruppe für bestimmte Betriebe zuständig ist. Jede Abteilung hat einen Koordinator, der die Sitzungen nach einem festen Terminkalender in den Betrieben durchführt und mit dem Betriebsleiter zusammen leitet.
Gründe für diese Umstrukturierung waren, dass die gesamte Verwaltungsratarbeit und die Verantwortung dafür nicht nur auf dem Oberschulzen lasten sollte, sondern auf dem gesamten Rat. Negativ zu werten bei dieser Umstrukturierung ist, dass die Mitglieder zu viel Zeit in den Betrieben verbringen und zu wenig Zeit für ihre Bezirke haben.
Herausforderungen/Perspektiven der Gegenwart und Zukunft
Die Vergangenheit unserer Vorfahren als abgeschlossenes Kapitel anzusehen, wäre falsch. Die Basis, die sie uns in einer wohlerhaltenden Form zurückgelassen haben, verdient hohe Anerkennung. Nur durch unsere Vorfahren sind und haben wir das, was wir sind und haben.
Abram W. Hiebert schreibt in seinem Memorandum 1988: „Ein Volk, das seine Vergangenheit nicht kennt, kann und wird die Gegenwart nicht verstehen".
Weil manche Mitglieder die Vergangenheit nicht gut genug kennen, stoßen viele einmal getroffenen Entscheidungen in der
Kolonie auf Widerstand.
Aus unserer eigenen Vergangenheit müssen wir Schlüsse ziehen und auf dieser Basis weiter unser Gemeinschaftswerk vorantreiben.
Eine Herausforderung ist die Sozio – kulturelle Integration: Wie werden wir es schaffen, uns hier mit den verschiedenen Volksgruppen in
Paraguay zu integrieren ohne dabei unsere Identität und Struktur zu verlieren? Unsere Nachbarn merken sehr wohl, dass wir immer reicher werden.
Die Gründung einer Munizipalität ist im Moment sehr aktuell. Die Munizipalisierung unserer Kolonien darf an uns nicht leichtfertig vorbeiziehen. Es ist nur eine Frage der Zeit und es wird an uns liegen, ob wir dieses Thema früh genug vorbereiten, um den bestmöglichen Weg für eine ausgewogene Integration zu finden. Auf die Länge können die Kolonien die soziale Last, die auf uns liegt, nicht mehr tragen (z.B. doppelte Beiträge und Auflagen zahlen).
Wenn wir hier nicht die Initiative ergreifen werden, machen das andere. Ob uns das gefällt oder nicht. Wir müssen Vordenker dieser Tatsache sein und nicht alles mit geschlossenen Augen wie einen Film an uns vorbeiziehen lassen, um dann nachträglich zu reagieren, wenn es zu spät ist. Es sind schon einige konkrete Vorschläge erarbeitet worden (1999), die aber noch nicht durchgeführt wurden. Klargestellt werden muss hier, dass unser Verwaltungsrat in der Praxis eine Munizipalitätsverwaltung ersetzt.
2. Herausforderung: Produktion und Vermarktung:
Auf Planung wird in Zukunft mehr Gewicht gelegt werden müssen. 70 Jahre haben wir alles verkauft, was wir produzierten. In den letzten fünf Jahren war das schwieriger. Wie es im Moment aussieht, kann die Vermarktung unserer Produkte noch größere Tiefen erleben, weil die Kaufkraft des paraguayischen Volkes ständig sinkt.
Jetzt ist es Zeit Märkte zu suchen und aufzubauen. Danach wird sich die Produktion in Zukunft ausrichten müssen. Dazu müssen Personen vorbereitet und befähigt werden. Die Frage, die sich hier stellt ist, was wollen wir auf den nationalen Markt und was wollen wir auf den internationalen Markt verkaufen? An dieser Stelle zeigen sich ganz besonders die Schwächen unseres Verwaltungsrat Systems, weil die Entscheidungsprozesse zu langsam sind. Dies kann nur durch einem mit Vollmacht ausgestatteten Ausschuss behoben werden. Dieser muss dann seine Entscheidungen nach den marktüblichen Spielregeln treffen und dafür Verantwortung ablegen.
3. Herausforderung: Werteskala
Die Wertevorstellung und die Ausübung derselben, die über einige hundert Jahre unsere Gemeinschaft durchgetragen haben, ändern sich in den letzten Generationen rasant. Werte wie Arbeitsamkeit, Treue, Aufrichtigkeit, verantwortungsvolles Reden, Moral und Vertrauen verlieren immer mehr an Bedeutung. Das ständige Bemühen von Gemeindevorständen und Kolonieverwaltung sind die Eckpfeiler dieser Werte, zumal die Grundlage derselben nicht in allen Familien gegeben ist. Dieses ist wohl die größte Herausforderung, weil sie nur über die Erziehung und durch Umsetzung in die Praxis erlernt werden können.
4. Herausforderung. Konsumgesellschaft
Die guten Wirtschaftsjahre haben einen Großteil unserer Bürger in eine Konsumgesellschaft verwandelt. Die schwindende Arbeitsamkeit der jüngeren Generationen, verstärkt durch leichte
Kredite für die Tertiärausbildung tragen wesentlich dazu bei. Erstes Ziel mancher Absolventen ist, ein hohes Gehalt zu verdienen, bevor man eine Leistung erbringt.
Bildung und Leistung müssen in ausgewogenem Verhältnis honoriert werden. Luxuswagen, Luxushäuser, Luxuskonsum sind keine Seltenheit mehr, sondern drücken die arme Schicht immer tiefer herab, da sie den ersehnten höheren Lebensstandard nicht erreichen kann. Wie werden wir diese Problematik in Zukunft bewältigen?
5. Herausforderung: Bildungsfeindlichkeit
Klarstellen möchte ich vorweg, dass ich unter
Bildung etwas anderes verstehe als unter Lernen oder zur „Schule gehen". „
Bildung ist nämlich die bewußte, planmäßige Entwicklung der natürlich vorhandenen geistigen und körperlichen Anlagen des Menschen". Auch der durch Entwicklung erreichte Zustand ist als
Bildung zu betrachten.
Unsere Schulen sind zu sehr auf die Erfüllung des staatlichen Lehrprogramms fixiert (besonders die Sekundarschule). Erste Ansätze zur Veränderung sind bereits in unserem Schulprogramm vorhanden. Wenn wir aber die
Bildung und nicht nur unser Schulwesen fördern wollen, muss noch einiges geschehen. Dazu muss die Bildungspolitik ständig revidiert, definiert und unserem Genossenschaftswesen angepaßt werden. Die Genossenschaftserziehung in der Schule kann sich nicht nur auf einige Gelegenheitsdiskussionen, was im Moment läuft, oder was die Verwaltung wieder falsch gemacht hat, beschränken, sondern der gesamte Kontext (Geschichte, Wirtschaft, Sozialleben) muss darin erfasst werden. Nach meinen Erfahrungen sind wir als Mennos wieder neu auf der Suche nach unserer eigenen Identität im Bildungswesen. Es ist aber noch nicht allen klar, dass unsere altbewährte Einstellung „handklug ist effektiver als kopfklug" irgendwann an ihre Grenzen stößt; spätestens jetzt in einer technologisch hoch spezialisierten Arbeitswelt. Wie werden wir dieser Einstellung in Zukunft begegnen?
6. Herausforderung: Fortbildung der Bürger – Erwachsenenbildung
Wenn das Genossenschaftliche Erziehungskomitee (G.E.K.) in diesem Jahr z.B. 1,4 Milliarden Gs. für Ausbildung und Stipendien ausgibt, und nicht mindestens die Hälfte (um nicht zu sagen die gleiche Summe) in die Fortbildung der Bürger, sprich Produzenten investiert, ist ein Ungleichgewicht unserer Wirtschaftsexistenz vorprogrammiert, deren Folgen wir uns heute bewusst werden sollten. Weil die Produzenten unsere Basis für das Gemeinschaftswesen sind und in Zukunft bleiben werden, muss hier mehr geleistet werden.
Die Frage, die sich stellt, ist, wie werden wir die 130
Studenten mit Arbeit ver-sorgen oder wie sollen sie ihr Stipendium abzahlen ohne Arbeit? Unsere Bauernschule (
Berufsschule) ist immer noch nicht gefüllt mit zukünftigen Produzenten und Technikern, die die Produktion fördern und begleiten.
Wann werden wir als Führungskräfte und Eltern endlich begreifen, dass die
Berufsschule unsere wichtigste Bildungsinstitution ist?
7. Herauforderung: Unser Verwaltungssystem
Unser heutiges Verwaltungssystem ist zu schwerfällig in Entscheidungsprozessen und dies ganz besonders im wirtschaftlichen und komerziellen Bereich. Heute haben wir gut ausgebildete Personen, die sich den Herausforderungen unserer Verwaltung stellen können. Verwaltung im weiteren Sinne des Wortes schließt Betriebsleiter und Geschäftsleiter mit ein.
Die Kompetenzen müssten klar definiert werden. Ganz besonders die Entscheidungsbefugnisse der Geschäftsführer und Betriebsleiter müssen so definiert sein, dass sie im Rahmen der Kostenvoranschläge agieren können, und die Verwaltung hat nichts anderes zu tun, als die Beschlüsse der Bürger und des Verwaltungsrates wie auch die Einhaltung der Statuten und Richtlinien zu überwachen und zu reglementieren. Natürlich überwacht sie auch die Betriebe. Damit die Verwaltung diese Herausforderungen in Zukunft schneller und effektiver bewältigen kann, wird eine Umstrukturierung des Verwaltungssystems meines Erachtens unumgänglich sein. Klargestellt sei hier, dass Quantität nicht gleich Qualität in der Mitgliederzahl des Verwaltungssystems ist.
Nachdenken müssen wir hier darüber, ob es sinnvoll wäre, die Wahlen für die Verwaltunsgratmitglieder unabhängig von der Bezirkszugehörigkeit durchzuführen. Die Bezirksleiter könnten im
Bezirk sämtliche Verwaltungsaufgaben wie Schulen, Wirtschaft,
Kultur und
Sport übernehmen, dann könnte die
Chortitzer Komitee-Verwaltung folgendermaßen strukturiert werden:
Der Verwaltungsrat würde sich aus sieben bis neun Mitgliedern zusammensetzen, die aus der ganzen
Kolonie gewählt werden. Begründung: Die Bürger sind sehr ungleichmäßig durch die Verwaltungsratmitglieder vertreten (z.B.
Loma Plata –
Lichtenau).
Diese Mitglieder wählen aus ihrer eigenen Mitte den Oberschulzen, den Sekretär und den Schatzmeister. Die Exekutive wird vom Verwaltungsrat ernannt: Ein Geschäftsleiter, einer für Industrie und Handel, einer für Produktion, einer für Finanzen, einer für Vermarktung, einer für das Gesundheitswesen, einer für das Schulwesen und der
Oberschulze.
Ich habe versucht die Entwicklung der Verwaltung der
Kolonie Menno in geraffter Form darzustellen. Weiter habe ich einige Schlüsse und Herausforderungen/Perspektiven aus der Verwaltungsgeschichte gezogen. Natürlich basieren diese auf meiner persönlichen Erfahrung und Meinung, die hier nur als Diskussionsgrundlage zu verstehen ist.
Angesichts unserer heutigen Lage auf sozialer, wirtschaftlicher, geistiger und geistlicher Ebene scheint mir zum Schluss meines Referats ein Zitat von einem unserer bedeutendsten Führer in der Geschichte der
Kolonie Menno, Herrn Martin C. Friesen, interessant zu sein.
Er schrieb 1928, als er von einem Besuch aus Puerto Casado zurückgekehrt war, an seinen Amtskollegen Abram E. Giesbrecht:
„Ich war vor einer Woche in Puerto Casado. Da sind alte Grossväter, die die Leute bange machen mit ihren zweifelerregenen Reden, die sie schwingen. Ach, wie viele haben’s doch schon vergessen, was wir auf unseren Knien unserm Gott gelobt haben, nämlich treu und beständig auszuharren, bis ans Ende. Auch in dieser Auswanderungssache war es unser Wunsch, der Herr möchte uns doch einen Zufluchtsort anzeigen – und er hat es getan. Wir aber murren anstatt dass wir danken. Blinder Mensch, wann willst Du endlich dankbar werden"!
Zum Abschluss spreche ich meinen innigsten Dank aus an alle alten Bürger der
Kolonie, die sich ganz besonders für das große Gemeinschaftswerk der
Kolonie und Kooperative eingesetzt haben. Sie haben damit eine gesunde Basis für unsere Generation geschaffen.
Auch möchte ich heute unserer verstorbenen Führungskräfte und Bürger, die in außergewöhnlich schwierigen Umständen diese Siedlergemeinschaft, die
Kolonie Menno, aufgebaut haben, gedenken. Ehre ihrem Andenken.
Anhang:
Oberschulzen bzw.
Vorsteher der
Kolonie Menno von 1927 bis 2002:
1927 – 1935 | Isaak K. Fehr |
1936 – 1939 | Jacob A. Braun |
1940 | Jacob H. Hiebert |
1941 – 1948 | Heinrich F. Harder |
1949 | Cornelius R. Funk |
1950 | Johan T. Dyck |
1951 – 1967, 1974 – 1975 | Jacob B. Reimer |
1968 – 1973, 1976 – 1983, 1996 – 1998 | Jacob N. Giesbrecht |
1984 – 1992, 2002 – | Cornelius B. Sawatzky |
1993 – 1995 | Bernhard F. Wiebe |
1999 – 2001 | Gustav T. Sawatzky |
Verwaltungsrat – Mitglieder von 1927 – 2002: 137
Aufsichtsrat – Mitglieder von 1962 – 2002: 34
Quellenverzeichnis:
- Abram W. Hiebert, Entstehung und Entwicklung der Civil – Gesellschaft Chortitzer Komitee, 1988.
- Heinrich Ratzlaff, Die Verwaltungsgeschichte der Kolonie Menno,15.08.2000.
- Jacob N. Giesbrecht, Mündliche Aussagen vom langjährigen Oberschulzen.
- M. W. Friesen, Kanadische Mennoniten bezwingen eine Wildnis, 1977
- M.W. Friesen, Neue Heimat in der Chacowildnis, 1987.
- Statut der Genossenschaft und der Asociación Civil Chortitzer Komitee.
- Verwaltungsrat: Protokolle.
Fussnoten:
| |
| Friesen Martin W. – S. 565. |
Gerhard Ratzlaff
Ein Überblick über die eingewanderten
Mennoniten in Paraguay
In
Paraguay gibt es etwas mehr als 29 000 deutschsprachige Mennoniten, zusätzlich noch etwa 600 amerikanische englischsprachige Mennoniten. Alles zusammen ergibt das fast 30 000 (genau: 29 644) Mennoniten, verteilt auf 18 Siedlungen plus die Mennoniten in
Asunción. Etwas mehr als die Hälfte aller eingewanderten Mennoniten kommen aus Kanada und die andere Hälfte aus Russland, Mexiko und den USA. Die folgende Tabelle möchte diese Verteilung veranschaulichen:
| Gründungsjahr | Einwohner (zum 01.01.2002) |
Kanadische Mennoniten |
| 1927 | 9.039 |
| 1948 | 2.810 |
| 1948 | 2.276 |
| 1966 | 176 |
| 1973 | |
| — | 473 |
Total | 14.954 (50,29%) |
|
Russische Mennoniten |
| 1930 | 4.086 |
| 1937 | 663 |
| 1947 | 1.687 |
| 1947 | 695 |
| — | 850 |
Total | 7.981 (26,84%) |
|
|
| 1969 | 3.220 |
| 1972 | 349 |
Nuevo Durango | 1978 | 1.970 |
| 1983 | 651 |
Total | 6.190 (20,82%) |
|
|
| 1967 | 183 |
| 1969 | 95 |
| 1976 | 80 |
La Montaña | 1982 | 250 |
Total | 608 (2,04%) |
14.954 (50,29%) aller Mennoniten Paraguays haben somit Kanada als ihr Herkunftsland. Die ersten kanadischen Mennoniten wanderten als Siedlungsgruppe vor 75 Jahren nach
Paraguay ein und die letzten vor 54.
Obwohl die ersten kanadischen Mennoniten bereits in der dritten und vierten Generation in
Paraguay leben, besitzt immer noch eine beachtliche Anzahl von ihnen (über 7500 Personen, rund 50%) kanadisches Bürgerrecht, das sie auch behalten und an die Kinder weitergeben möchten. Nach Angaben der Vertretung des kanadischen Konsulats in
Asunción sieht das Bild der kanadischen Bürger in den Kolonien folgendermaßen aus:
| 3.949 Bürger (43,60%), |
| 1.448 (51,53%), |
| 56 (31,11%), |
| 1.448 (51,53%), |
| 212 (16,02%). |
In all den anderen Kolonien gibt es noch einmal 1.085 kanadische Bürger:
| 574 (14,05%) |
| 82 (4,86%), |
| 13 (1,96%),, |
| 9 (1,29%), |
| 18 (5,15%), |
| 426 (13,23%). |
Für die restlichen Kolonien hat das kanadische Konsulat keine Angaben. In den Kolonien
Fernheim,
Friesland,
Neuland und
Volendam sind die kanadischen Bürger meistens russische Mennoniten, die in Kanada Verwandte hatten (bzw. haben), dorthin auswanderten, das Bürgerrecht erwarben und dann nach
Paraguay zurückkehrten. Wir wollen uns nun die Herkunft und Gründe, warum kanadische Mennoniten Kanada verließen und nach
Paraguay einwanderten, näher anschauen. Sie waren nämlich die Bahnbrecher für alle übrigen mennonitischen Kolonien in
Paraguay.
Die Ursache der Auswanderung nach Paraguay: die Schule.
Was war die Ursache, dass vor 75 Jahren viele kanadische Mennoniten ihre Heimat verließen, in der sie seit 50 Jahren gewohnt und beachtliche wirtschaftliche Fortschritte zu verzeichnen hatten, und nach
Paraguay, einem damals unterentwickelten Land, auswanderten? Dieser Ursache soll hier näher nachgegangen werden. Das Grundproblem war eindeutig die Schule, die Erziehung der Kinder. Andere unterschwellige Ursachen wie die Furcht vor einem eventuellen Wehrdienst und „die Verweltlichung" kamen dazu, können hier aber nicht näher erörtert werden.
Die Vorfahren der kanadischen Mennoniten, mit denen wir uns hier befassen, waren in den Jahren 1874-78 von Russland nach Kanada eingewandert. Sie gehörten jener Gruppe Mennoniten an, die in Russland keine Reformen in ihrem traditionellen Schulwesen bzw. Gemeindeleben einführen wollten. Da sie jedoch in Russland gezwungen wurden einige Verbesserungen in ihrem Schulwesen einzuführen, entschlossen sie sich, nach Kanada zu gehen, wo ihnen die gewünschten Freiheiten in der Ausübung ihrer Religion und der Verwaltung eigener Schulen versprochen wurden. Ja, so sagte der Älteste Gerhard Wiebe auf der ersten
Bruderschaft im neuen Lande, nach dem Wortlaut des Ältesten Isaak M. Dyck „dass sie den Schritt, was sie schon in Russland zu weit mit der Welt mitgegangen waren, nun hier in Amerika [Kanada] zurückgehen wollten. Nämlich mit die hohe Gelehrsamkeit in den Schulen, mit das Notengesang und überhaupt mit die große Gleichstellung dieser Welt."
(3) Frank Epp, der Historiker der Mennoniten in Kanada, meint, dass diesen Mennoniten die Verteidigung ihrer Institutionen wichtiger geworden waren als ihre Glaubensprinzipien.
(4)
Doch die ersehnte mennonitische Verwaltungs- und Schulfreiheit in Kanada war von kurzer Dauer. Wie in Russland hatten sich die Mennoniten in Kanada in separaten Kolonien und in Reihendörfern angesiedelt und führten die Verwaltung ihres Gemeinschaftswesens und ihres Gemeindelebens so fort, wie sie es von Russland her kannten. Doch, wie Martin W. Friesen, Historiker der
Kolonie Menno, schreibt, griff die Regierung Manitobas schon in den 1880er Jahren in das Verwaltungswesen der Siedlungen, den „Kernbereich ihrer gewohnten Lebensordnung" ein. Das war ein harter Schlag und eine „zutiefst schmerzliche Erfahrung, schon so früh auch hier wieder in den eigensten Bereichen vom Staate behelligt zu werden…", schreibt Friesen mitfühlend weiter.
(5)
Während sich ein Teil der Mennoniten Kanadas der neuen Situation anpasste, umgaben sich andere Gemeinden in der Sprache Friesens „mit einer festen Mauer" um die schädlichen Einflüsse abzuwehren. Die Folge davon war, im Urteil Friesens, „eine ständiges Absinken der ethischen und geistigen Werte" in ein religiös, erstarrtes und lebloses Formwesen.
(6)
Der eigentliche Kampf der Mennoniten um ihre Schulen begann dann 1890, als die Regierung Manitobas ein neues Schulgesetz erließ, das „
Manitoba Public Schools Act".
(7) Ab sofort sollte in allen Schulen, die von der Regierung finanziell unterstützt wurden, Englisch die offizielle Unterrichtssprache werden. Das betraf nun auch die mennonitischen Schulen, die von der Unterstützung Gebrauch gemacht hatten. Die traditionellsten der Mennoniten meinten hinterher festzustellen, dass die Regierung ihnen mit der finanziellen Unterstützung der Schulen eine Falle gestellt habe, und dass viele sich die „Augen durch’s Geld verblenden" ließen.
(8) Das neue Schulgesetz wurde zwar noch nicht konsequent durchgeführt, und eine Anzahl mennonitischer Gemeinden versuchte der Regierungskontrolle dadurch zu entgehen, dass sie ihre Schulen nun selber finanzierten. Die Regierung übte einstweilen noch Toleranz den Privatschulen gegenüber. Dies geschah besonders im Blick auf die vielen französischsprachigen Katholiken. Davon profitierten nun auch die Mennoniten. 1896 kam es zu einem „pragmatischen Kompromiss", einer „zweisprachen Klausel".
(9) Der Kompromiss sah vor, dass wenn in einer Schulklasse mehr als zehn Schüler wären, die nicht Englisch als ihre Muttersprache hätten, dann dürfe in dieser Klasse neben Englisch auch in der Muttersprache, sowie die jeweilige Religion unterrichtet werden. Von diesem Kompromiss machten nun viele mennonitische Gemeinden Gebrauch und führten die Schulen in der alten Form weiter, ohne irgendwelche Schulreformen durchzuführen.
Andere jedoch sahen die Notwendigkeit einer Schulverbesserung ein. Und um ihre eigenen Lehrer halten und ihre Glaubensprinzipien unterrichten zu können, errichteten sie Schulen zur Ausbildung der eigenen Lehrer, die den staatlichen Anforderungen entsprachen. Damit behielten sie die Kontrolle über die eigenen Schulen, führten sie jedoch in englischer Sprache und im Sinne der mennonitischen Glaubensprinzipien weiter. Deutsch und Religion mussten in zusätzlichen Stunden unterrichtet werden. So begannen sich in den mennonitischen Gemeinden die Geister zu trennen. In Friesens Sprache: die einen gingen vorwärts, die anderen dagegen machten eine „Rückwärtsschaltung". Die traditionellen Mennoniten, die sich jeder
Schulreform widersetzten, betrachteten jene Mennoniten, die sich der staatlichen
Schulreform fügten, als „unsere falschen Brüder, als Verräter [die] mit der Regierung Hand in Hand arbeiteten und so gar den Rat gaben, wie sie es machen sollten um uns je eher, je lieber in ihre Netze zu bekommen." So urteilte der Älteste Isaak M. Dyck, der zu denen gehörte, die der Schule wegen nach Mexiko auswanderten.
(10) Und die Leute, die da sagen: „Wir wünschen unseren Kindern eine bessere
Bildung, ein höheres Studium, als wir es gehabt haben", verglich Ältester Dyck mit Menschen, die das Fundament für den „Babilonischen Turm" legen.
(11) In diesem Zwiespalt wurden die Schulen in vielen Orten viele Jahre geführt. Manche Gemeinden rieben sich in diesem Kampf gegenseitig auf.
Ein weiterer Rückschlag für die traditionellen Mennoniten kam im Jahre 1907, als die Provinzregierung von
Manitoba das Hissen der nationalen Flagge, des „Union Jack", in allen Schulen zur Pflicht machte. Adolf Ens schreibt zu dieser Thematik: „Der lauteste Protest gegen die Flagge (1907) kam von den mit den Regierungsschulen kooperierenden [Schul-] Leitern (so wie H.H. Ewert), nicht von den konservativen Gruppen, denen dieses Gesetz in ihren Schulen nicht galt". Doch auch die traditionellen Mennoniten wehrten sich dagegen. „Aber all unser Dagegenarbeiten half nicht mehr", schreibt Dyck resigniert.
(12) Man hatte der Regierung, im Verständnis der Altkolonier, den kleinen Finger gegeben und nun ergriff sie die ganze Hand. Doch es sollte noch härter kommen. Die Regierung wollte nicht nur die Hand, sie wollte den ganzen Menschen. Sie wollte die Mennoniten – und nicht nur die Mennoniten, sondern alle nationalen Minderheiten – zu einer Nation mit einheitlicher Ausrichtung zusammenschmelzen. Diese nationalistische
Politik wurde ganz bewusst von der Regierung durch die Schulen betrieben. Die Form, wie diese
Politik betrieben wurde, konnten viele Mennoniten einfach nicht akzeptieren. Sie widersprach ihren Glaubensprinzipien. Doch es sollte noch schlimmer kommen.
Mit dem Ausbruch des 1. Weltkrieges, in dem Kanada an der Seite Englands gegen Deutschland kämpfte, war für die kanadische Regierung der geeignete Moment gekommen, die Vielfalt der Nationen in Kanada in einem „melting pot" (Schmelztiegel) zu vermengen. In den Schulen wurden dem Gebrauch der deutschen Sprache weitere Begrenzungen auferlegt. Das Singen der Nationalhymne sowie vieler nationalistischer Lieder wie „God save the King" und das Lesen patriotischer Literatur wurde in den Schulen zur Pflicht erhoben. Weiter mussten die Klassenzimmer mit dem Bild des englischen Monarchen geziert werden.
(13) Der Älteste Dyck schreibt wohl recht zutreffend, die Grundlage der Schule sei nun: „Ein König, ein Gott, eine Flotte, eine Flagge, ein allbritisches Reich. Sympathie, Selbstaufopferung fürs Vaterland"
(14). Das ging vielen Mennoniten nun doch entschieden zu weit – und nicht nur den traditionellen. Unter diesen Umständen schickten viele Eltern ihre Kinder nicht mehr in die Schule.
Der Schulkonflikt erreichte seinen Höhepunkt, als die Regierung daraufhin am 10. März 1916, mitten im 1. Weltkrieg, die allgemeine Schulpflicht
(15) einführte. Nun verhärteten sich die Fronten. Die Reinländer in der
Westreserve, die Chortitzer in der
Ostreserve und einige
Sommerfelder widersetzten sich entschieden den neuen Forderungen. Für sie standen nicht nur Institutionen, sondern vor allem altüberlieferte Glaubensprinzipien und Werte auf dem Spiel. Und zu ihren Glaubensprinzipien gehörte die deutsche Sprache und der Unterricht der Religion in eigenen Schulen. Das, was die Schule ist, das wird mit der Zeit die
Gemeinde, verteidigten sich mit gewissem Recht diese Gemeinden.
(16) Doch trotz vieler Bittgesuche von Seiten der Gemeinden, ließ sich die Provinzregierung nicht erweichen und hielt zielbewusst an ihren Forderungen fest.
Das eigentliche Problem der Mennoniten mit der Regierung Manitobas war die mangelnde Qualität ihrer Schulen. Privatschulen waren immer noch erlaubt, wenn sie den Forderungen des Erziehungsministeriums entsprachen. Die Schulen vieler Mennoniten entsprachen in keiner Weise den Anforderungen der Zeit. Das wiederum konnten die betroffenen Gemeinden nicht sehen. Für sie war es genug, wenn ihre Kinder lesen, schreiben und etwas rechnen konnten. Wenn Paulus die Römer (12,16) ermahnt: „Trachtet nicht nach hohen Dingen,…", dann bedeutete das für Ältesten Dyck, nicht nach „hoher Gelehrsamkeit" zu trachten. Auf die Schulen angewandt hieß es, sie so zu belassen, wie sie waren. In die neuen „Distriktschulen", von der Regierung errichtet, würden sie ihre Kinder nicht schicken. Die „gelehrten" Schulen entsprachen nicht ihrer Religion.
Trotz heftigen Widerstandes richtete die Regierung nun unter Zwang („Zwangsschulen") doch „Distriktschulen" im Bereich der Mennoniten ein und schickte Lehrer den Unterricht zu erteilen. Doch zur großen Überraschung der Lehrer – keine Kinder erschienen. Der Lehrer hisste zur gegebenen Stunde die Flagge und wartete auf die Schüler – aber vergebens. Wenige oder sogar keine Kinder erschienen. In dieser Art protestierten die Mennoniten gegen die
Schulreform und die neuen „hohen" Schulen. In einer Schule soll dies ein ganzes Jahr so gegangen sein. Einer der betroffenen Lehrer berichtete folgendermaßen über seine Erfahrung:
Als ich am 1. September die Flagge hisste, war kein Kind in der Schule. Die alten Leute taten sich zusammen, erbauten ein Holzhaus (log cabin) und heuerten einen Privatlehrer für die 45 Kinder des Distrikts. Sie zahlten ihm das Gehalt, das ich bezog – $80 monatlich. Trotzdem blieb ich dabei und hisste die Flagge an jedem der 202 Tage, aber ich hatte nicht einen Schüler.
(17)
Solches Verhalten von Seiten der Mennoniten konnte die Regierung keineswegs billigen. Sie fühlte sich herausgefordert und griff hart zu. Ab Ende 1918 und während des Jahres 1919 wurden in den Provinzen Saskatchewan und
Manitoba hunderte Mennoniten vor Gericht geladen, um sich zu verantworten. Die Gerichtsprozesse wurden von der Presse aufgegriffen und veröffentlicht, und sie verliefen nicht zu Gunsten der Mennoniten. Dadurch wurde dem guten Ruf der Mennoniten viel Schaden zugefügt, schreibt Epp.
(18) Andererseits meint Epp aber auch, dass die Regierung zu nationalistisch vorgegangen sei und besser getan hätte, toleranter mit den Mennoniten zu verfahren. Auch der katholische Mennonitenforscher E. K. Francis sympathisiert mit den Mennoniten und meint, dass es der Regierung nicht nur um die Qualität der Schule ging, so wichtig diese auch war, sondern darum, alle nationale Minderheiten zu einer Nation und
Kultur zu verschmelzen.
(19) Selbst der ausgewanderte Älteste Isaak M. Dyck schreibt im Rückblick auf diesen Druck: „Hätte die Regierung nicht damals den großen Schritt genommen und gesagt, dass sie hundert Prozent Canadier [aus uns] machen wollte, so wäre der größte Teil unserer Gemeindeglieder dort geblieben".
(20)
So kam es schließlich von Seiten der Regierung zu einer „virtuell epidemischen Verfolgung" („a virtual epidemic of prosecution") der traditionellen Mennoniten, stellt Epp mit Bedauern fest.
(21) Es gab kein Mitleid mit ihnen. Harte Geldstrafen wurden ihnen auferlegt und eine Anzahl von ihnen wurde ganz arm und etliche kamen sogar für kurze Zeit ins Gefängnis.
(22) „Die Strafgelder und Gefängnis wurden uns immer härter aufgelegt. Es schien auch wirklich so, je mehr wir nach eine Ausflucht suchten, je ernstlicher wir auswandern wollten, je mehr Lasten und Beschwerden wurden uns auferlegt".
(23)
In dem Widerstand gegen die Schulreformen beriefen sich die Mennoniten auf ihr
Privilegium, das ihnen am 23. Juli 1873 (A. Ens gibt den 26. Juli an) vom Landwirtschaftsminister John M. Lowe ausgehändigt worden war und in dem es in Artikel 10 heißt:
„Die völligste Freiheit in der Ausübung ihrer religiösen Grundsätze wird den Mennoniten ohne irgendwelche Belästigung oder Einschränkung durch das Gesetz gewährt; und dasselbe Vorrecht erstreckt sich auch auf die Erziehung ihrer Kinder in den Schulen."
(24)
Zu ihrer Überraschung stellten die Mennoniten fest, dass der Text ihres Privilgiums nicht mit dem der Regierung übereinstimmte. Dort hieß der betreffende Abschnitt folgendermaßen:
„Dass die Mennoniten die völligste Freiheit haben werden in der Ausübung ihrer religiösen Grundsätze und das Vorrecht, ihre Kinder in den Schulen zu erziehen, wie das Gesetz es vorsieht ohne irgendwelche Belästigung oder Einschränkung".
(25)
Jetzt erfuhren die Mennoniten, dass der Text, den ihre Abgeordneten 1873 erhalten und mit nach Russland genommen hatten, nicht vom „Order in-Council" angenommen war und damit keine Rechtsgültigkeit besaß. Die rechtsgültige Annahme geschah erst am 13. August 1873, als die mennonitische Delegation das Land bereits verlassen hatte. Diese letzte Version war den Mennoniten nie zugeschickt worden.
Den Unterschied zwischen den zwei Texten machte der kleine Zusatz „wie das Gesetz es vorsieht". Und das kanadische Gesetz „sah vor", dass die Schulen den Gesetzen der Provinzen untergeordnet sind und dass die Bundesregierung keine Gewalt habe, über Schulfragen in den Provinzen zu verfügen. Adolf Ens, der die Schulfrage der Mennoniten und die des Privilegiums in seiner Doktorarbeit studiert hat, behauptet, dass die Mennoniten das
Privilegium falsch verstanden und ausgelegt hätten. Was der 10. Artikel, mit oder ohne Zusatz, sagen möchte, ist folgendes: Die Mennoniten haben das uneingeschränkte Recht, ihre Kinder in eigenen Schulen den Gesetzen des Landes entsprechend zu erziehen. Artikel 10 war also kein
Privilegium speziell für die Mennoniten, sondern galt allen Nationalitäten und Religionen im Lande.
(26) Ein Teil der Mennoniten war jedoch nicht bereit, ihre Schule den Gesetzen des Landes entsprechend zu führen. Dieser Auslegung zufolge konnte die Bundesregierung den bittenden Mennoniten in ihrem Anliegen nicht helfen.
Die Mennoniten sahen die Dinge anders. Einer der Minister in der Regierung, schreibt Ältester Dyck, habe ihnen in sehr „ernsten, entschiedenen Tone" erklärt, dass die Regierung den Irrtum von damals eingesehen habe, aber nicht verpflichtet sei, in dem Irrtum zu beharren. Und um den Mennoniten die Sachlage klar zu machen, habe er folgendes Beispiel gebraucht: „Wenn ich mir den Rock des Morgens auch unrecht oder umgekehrt angezogen, so bin ich doch nicht schuldig, ihn den ganzen Tag so zu tragen". Diese Auslegung konnten die betroffenen Mennoniten weder verstehen noch akzeptieren. Ältester Dyck schreibt weiter: „Dieses war für unsere Delegaten eine traurige und niederdrü-ckende Antwort, dass sie jede Hoffnung noch länger in Canada zu bleiben, gänzlich aufgeben mußten".
(27) Für sie war die kanadische Regierung eindeutig wortbrüchig geworden. Auch der oberste Gerichtshof Kanadas sprach sich gegen den Einspruch der Mennoniten aus. Nun hieß es, im Verständnis der mennonitischen Gemeindeältesten, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Sie sahen keinen anderen Ausweg als den der Auswanderung. Der Älteste Isaak M Dyck schreibt mit Wehmut:
„Viele Brüder waren so gesonnen, wenn wir bloß noch einmal wieder einen Ort finden konnten, wo wir unsere Freiheit mit Kirchen und Schulen haben konnten, … dann wollten wir schon zufrieden sein, wenn wir auch nicht mehr so viele Reichtümer und irdische Schätze uns sammeln könnten, wie es besonders in den letzten Jahren in Canada der Fall gewesen".
(28)So kam es in den folgenden Jahren zu einer großen Auswanderung nach Mexiko und einer kleineren nach
Paraguay. In den Jahren 1922-26 wanderten 5950 Mennoniten aus Kanada nach Mexiko aus.
(29) Und in den Jahren 1926-30 wanderten nach Epp 1785 Mennoniten nach
Paraguay aus. Die Auswanderer verteilten sich auf die folgenden Gemeinden:
Martin W. Friesen gibt die Zahl der nach
Paraguay eingewanderten Mennoniten mit 266 Familien und 1763 Personen an.
(31)
In Puerto Casado starben 121 und in den Siedungslagern auf dem Weg zur Ansiedlung noch einmal 47 Personen, insgesamt also 168.
(32) 335 Personen gingen zurück nach Kanada.
(33) Letztendlich siedelten nur 1260 kanadische Mennoniten im
Chaco an. Sie hielten mit eisernem Wille trotz ungeheurer Schwierigkeiten durch. Heute (01.01.2002) hat die
Kolonie 9039 Einwohner.
Die Einwanderung kanadischer Mennoniten von 1948: Sommerfeld und Bergthal.
Die meisten der in Kanada zurückgebliebenen Mennoniten hatten sich ab 1928 in die neue Lage geschickt. Doch nach 20 Jahren kam es zu einer erneuten Auswanderung und es entstanden zwei neue Kolonien in Ostparaguay:
Sommerfeld und
Bergthal. Und aus der letzten wiederum zwei kleinere:
Reinfeld und
Tres Palmas
Warum verließen diese Leute nun Kanada, wo sie zu beachtlichem Wohlstand gelangt waren und wo sie als treue und arbeitsame Bürger des Landes geschätzt wurden? Diesmal wird nicht die Schule, sondern das „Eindringen der Welt in die
Gemeinde", das „moderne Leben" als Hauptgrund angegeben. Die kanadische Zeitschrift „The Canadian Forum" formulierte die Ursachen folgendermaßen:
„Sie meinen, dass als Resultat des modernen Lebens die junge Generation `weltlich’ geworden ist. Etliche ihrer Mädchen tragen moderne Kleider, brauchen Schminke, lassen sich die Haare schneiden und Dauerwellen drehen und stellen sich nicht gegen Parties und Tanz. Viele der jungen Männer sind in die Stadt gezogen und haben sich Frauen anderen Glaubens genommen. Hier können die Alten unter ihnen nicht mitgehen, auch wenn ihre Söhne tüchtige Geschäftsmänner werden. Schlimmer in den Augen der Mennoniten ist die Tatsache, dass während des Krieges [2. Weltkrieges] fast 50% ihrer jungen Männer in einer oder anderer Form im Krieg mitgemacht haben".
(34)Hier stand nun schon nicht mehr die Schulfrage an erster Stelle, sondern die „Verweltlichung". Doch in
Paraguay wurde das alte von Russland nach Kanada gebrachte Schulsystem neu eingeführt und bis heute weitgehend weitergeführt, denn die Schule wurde als Eingangstor der Weltlichkeit gewertet.
Die kanadischen Mennoniten in Paraguay im Wandel der Zeit.
Die Geschichte bleibt nicht stehen. Sie nimmt ihren unabänderlichen Lauf. Ein Blick auf die Entwicklung der kanadischen
Mennoniten in Paraguay und ein Vergleich mit den Ursachen der Auswanderung aus Kanada fördert einige Überraschungen zu Tage. Es fand Wandel und Differenzierung zwischen den kanadischen
Mennoniten in Paraguay statt. Die
Kolonie Menno in ihrer Gesamtheit hat, in der Sprache Martin W. Friesens, vorwärts geschaltet. Die Mennos, die in Kanada zu denen gehörten, die sich jeglichen Änderungen in Schule und
Gemeinde widersetzten, haben einen nahezu, von außen gesehen, reibungslosen Wandel planmäßig durchgeführt, der bewundernswert ist. Peter P. Klassen äußert sich zu der Entwicklung der
Kolonie Menno mit den folgenden anerkennenden Worten:
„Mennonitengeschichtlich stellt die Entwicklung der Gemeinden in der
Kolonie Menno, ebenso wie die des Schulwesens, eines der merkwürdigsten Phänomene dar: Die drei Gemeinden vereinigten sich in wenigen Jahren zu einer, und diese
Gemeinde machte wiederum die radikalsten Reformen durch, ohne dass es dadurch zu einer nennenswerten Zersplitterung kam".
(35)
Wer heute in die
Kolonie Menno kommt, ihre Schulen besucht und an ihren Gottesdiensten teilnimmt und diese mit der Pionierzeit vergleicht, der wird von ihrem Wandel überwältigt. Ihr Schulsystem gehört zu den besten im Lande, das Gemeindeleben ist aktiv und vielseitig organisiert. Der Kinder- und Jugendarbeit wird großer Wert beigemessen, die musikalische Förderung wird groß geschrieben, wo doch in Kanada der Gebrauch von Ziffern als weltlich angeprangert wurde. Die missionarische Tätigkeit unter der Landesbevölkerung wird als eine wesentliche Aufgabe der
Gemeinde mit viel Hingabe betrieben. Auf den Arbeitsfeldern des Christlichen Dienstes sind Jugendliche aus der
Kolonie Menno bei weitem in der Mehrheit.
(36)
Aus dem wirtschaftlichen Bereich wären kurz zu erwähnen: Die sehr geschätzten Milchprodukte Mennos, „Productos Lacteos Trebol", sind im ganzen Land bekannt und werden mit Vorliebe gekauft.
Menno hat die größte Molkerei im Lande und produziert bei weitem die meiste Milch unter allen Milchbetrieben im Lande. Noch viele andere Beispiele könnte man anführen um den Wandel, den die kanadischen Mennoniten der
Kolonie Menno gemacht haben, zu unterstreichen.
Sommerfeld ist ein weiteres Beispiel, wo sich der Trend zu einer gesunden Öffnung der Gemeinden bemerkbar
macht. Doch anders als in
Menno. Hier war eine Teilung der
Gemeinde nicht zu vermeiden.
Sommerfeld mit seinen 2810 Einwohnern ist eine sehr reiche
Kolonie. Per capita sind die
Sommerfelder die reichsten aller
Mennoniten in Paraguay. Sie beherrschen und bestimmen den gesamten Holzhandel Paraguays. Viele Bürger besitzen außerhalb der
Kolonie viel Land, Betriebe und Geschäfte verschiedener Art. In der
Kolonie selbst haben sie zwei Weizenmühlen, eine als Gemeinschaftsunternehmen, die andere ist ein Privatbetrieb mehrerer Geschäftsleute. Eine dritte Mühle wird erbaut. Sie besitzen die zweitgrößte Molkerei im Lande und ihre Milchprodukte „Lactolanda" sind ebenfalls im ganzen Lande bekannt und werden gerne gekauft. Bei alledem steht ihre Schule auf einem erschreckend niedrigen Niveau. So wie in Kanada und früher in Russland. Man kann daraus schließen, dass Schulbildung zum Reichwerden nicht erforderlich ist.
Sommerfeld ist ein Beispiel dafür.
Doch in dieser wohlhabenden
Kolonie kam es Anfang 1994 zu einem Bruch wegen der Frage der Schule und Gemeindereform. Die umstrittenen Fragen in der
Gemeinde seit über 150 Jahren. Der Älteste der
Gemeinde, Jakob J. Heinrichs, war der Überzeugung, dass das geistliche Leben der
Gemeinde unter dem „starren Formwesen und den alten Ordnungen" leide. Seine Vorschläge für eine Verbesserung des geistlichen und kulturellen Lebens der
Gemeinde und der
Kolonie legte er der
Gemeinde in einem „Acht-Punkte-Plan" vor. Doch die gut gemeinten Reformvorschläge wurden von der Mehrzahl der Gemeindeglieder abgelehnt. Die
Gemeinde entschied mit 80% dagegen und nur 20% dafür. Auf der Jahresbruderschaft am 8. Februar 1994 legte Ältester Heinrichs den versammelten Brüdern das Resultat vor und zitierte dabei Offenbarung 3, 17: „Du sprichst: Ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts! Und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß…." . Er gestand der
Gemeinde das Recht zu, seine Reformvorschläge abzulehnen, betonte aber auch das Recht der Minderheit, den neuen Weg zu gehen. So kam es zur Trennung der
Gemeinde in
Sommerfeld. Es wiederholte sich hier, was schon so oft in der Geschichte der Mennoniten geschehen ist. Aus Russland könnte man ähnliche Fälle anführen. Die „Evangelische
Mennonitengemeinde Sommerfeld" – so der Name der neuen
Gemeinde – die mit 140 Gliedern begann, geht heute bereits auf die 300 Glieder zu. In dieser kurzen Zeit haben sie sachlich und zielbewusst sehr entscheidende Reformen durchgeführt. Sie führen eine staatliche anerkannte Schule vom 1. bis zum 12. Schuljahr. Missionarisch und karitativ engagieren sie sich überaus stark. Das beweisen die folgenden Felder: eine
Kindertagesstätte und ein christlicher Buchladen auf Campo 9, Unterstützung des Radiosenders „El Mensajero" in
Tres Palmas,
Gefängnismission in Coronel Oviedo und Villarrica, Beteiligung am Aufbau einer Mandiokastärkefabrik für arme Campesinos in der Nachbarschaft, der Bau eines eigenen Krankenhauses. Es ist zu erwarten, dass nach und nach die ganze
Kolonie von diesem Geist des Fortschritts ergriffen wird. Anzeichen dafür sind da.
(37)
Anders verhalten sich die Dinge in der
Kolonie Bergthal mit 2276 Einwohnern. Hier haben die Reformbestrebungen, die von einigen wenigen begonnen wurden, noch nicht zu einer entscheidenden Wende geführt, obwohl auch hier eine
kleine Gemeinde (etwa 30 Glieder) entstand, die eine staatlich anerkannte Schule führt. Doch zu einer durchgreifenden Wende ist es hier noch nicht gekommen.
(38)
Die
Kolonie Reinfeld, die 1966 aus Bürgern der
Kolonie Bergthal im Süden Paraguays gegründet wurde und die nur 176 Bewohner hat, machte eine „Rückschaltung". Für sie war die Modernisierung in
Bergthal mit dem Einsatz von modernen Maschinen ein Schritt zu weit auf dem Weg in die Verweltlichung. Aus diesem Grunde lehnen sie Traktoren für die Bearbeitung ihrer Felder und Autos als Fahrzeuge ab und beschränken sich ausschließlich auf Pferde, Pflug und Buggy. Ihre Zukunft ist unsicher.
(39)
Die
Kolonie Tres Palmas, gegründet 1973, hat ihren Ursprung in den Reformbestrebungen einiger Bürger der
Kolonie Bergthal. Da sich diese aber innerhalb der
Kolonie nicht durchführen ließen, kam es zur Gründung einer neuen
Kolonie, der sich Mennoniten auch aus anderen Kolonien anschlossen.
Tres Palmas ist daher eine gemischte, nicht ausschließlich kanadische
Kolonie. Sie hat eine staatlich anerkannte Schule, ein Indianersiedlungsprojekt, den Radiosender ZP -19, „
Radio Mensajero", und ein Freizeitgelände, wo jährlich Jugendfreizeiten abgehalten werden, an denen sich Jugendliche aus allen mennonitischen Kolonien beteiligen. Die
Kolonie ist nur klein (180 Einwohner) und führt einen harten Kampf um ihre Existenz.
Zusammenfassung:
Die kanadischen Mennoniten sind zahlenmäßig die stärkste aller mennonitischen Gruppen in
Paraguay. Von ihrem Ursprungsland Kanada her waren sie alle traditionell und konservativ eingestellt. Sie kamen nach
Paraguay, um hier ihr Leben nach den alten Formen zu führen. Sie waren hartnäckig. „Een Mennist lat sich nich bemotte". Sie hatten sich fest vorgenommen keine Erneuerungen in ihrer Schul- und Gemeindestruktur einzuführen. Doch in
Paraguay geschah das Unerwartete. Was die kanadische Regierung mit allem Druck und mit Gewalt nicht fähig war, bei diesen Mennoniten durchzuführen, das ist nun bei nahezu 70% aller kanadischen
Mennoniten in Paraguay geschehen. In
Paraguay haben sie ihre Schulen auf den neuesten Stand gebracht und die Gemeindeordnung von Grund auf renoviert. Demnach ist äußerer Druck nicht die entsprechende Methode bei den Mennoniten Änderungen durchzuführen. Der Wille zur Erneuerung muss von innen kommen, wenn auch ein gewisser Anstoß von außen hilfreich ist. Bei den Mennos waren es die Kolonien
Fernheim und
Neuland, in
Bergthal Radio HCJB aus Quito, Ecuador, und die Leprastation. Die kanadischen
Mennoniten in Paraguay liefern dafür den Beweis und die 75-jährige Jubiläumsfeier der
Kolonie Menno stellt diese Tatsache auf den Leuchter.
Eine weiterer Umstand muss hervorgehoben werden. Wo Erneuerung mit Erfolg durchgeführt wurde, ging diese von der Gemeindeleitung aus. In
Menno war es Martin C. Friesen, der Moses der Mennos, der den Weg in die Erneuerung bahnte und mit Erfolg durchführte. In
Sommerfeld ist es der Älteste Jakob J. Heinrichs, der durch seine Einsicht und Sanftmut die neue
Gemeinde mit Erfolg den Weg der Erneuerung führt. Die positive Auswirkung auf die ganze
Kolonie ist bereits sichtbar. Anders verhalten sich die Dinge in der
Kolonie Bergthal. Hier haben sich die Leiter der
Gemeinde einer Reform, die von einigen Gemeindegliedern ausging, widersetzt. Zwar sind infolge dieser Bestrebungen zwei neue Gemeinden entstanden, eine außerhalb (in
Tres Palmas), die andere innerhalb der
Kolonie. Aber ein positiver, umfassender Einfluss auf die
Gemeinde und
Kolonie ist bis heute ausgeblieben. Die Fronten haben sich verhärtet. Doch auch das mag sich in Zukunft ändern.
Alles in allem, die kanadischen Mennoniten haben in der Geschichte der
Mennoniten in Paraguay eine bedeutungsvolle Rolle gespielt und aller Wahrscheinlichkeit nach wird ihr Einfluss auch in Zukunft ein bedeutungsvoller bleiben.
Ich gratuliere der
Kolonie Menno zu ihrer 75-jährigen Jubiläumsfeier und ihrem Erfolg und wünsche den kanadischen
Mennoniten in Paraguay für die Zukunft eine gesunde Weiterentwicklung zum Wohle der eigenen Bürger und des ganzen Landes.
Literaturverzeichnis
- Dyck 1970 = Dyck, Isaak M. Auswanderung der Reinländer Mennonitengemeinde von Kanada nach Mexiko. Cuauhtemoc, Mexiko, 1970.
- Epp 1990 = Epp, Frank H. Mennonites in Canada 1786-1920: The History of a Separate People. Mennonite Historical Society of Canada, Winnipeg, 1990.
- Epp 1982 = Epp, Frank H. Mennonites in Canada 1920-1940: A people’s Struggle for Survival. Toronto 1982.
- Francis 1953 = Francis, E.K. „The Mennonite School Problem in Manitoba 1874-1919". The Mennonite Quarterly Review. 27. Jahrg., Juli 1953, S. 204-237.
- Friesen 1987 = Friesen, Martin W. Neue Heimat in der Chacowildnis. Chortitzer Komitee, Asunción, 1987.
- Geschichtsbildband 1998 = Geschichtsbildband zum 50jährigen Bestehen der Kolonie Sommerfeld, 1948-1998. Sommerfeld, Paraguay, 1998.
- Klassen 1988 = Klassen, Peter P. Die Mennoniten in Paraguay: Reich Gottes und Reich dieser Welt. Mennonitischer Geschichtsverein, Weierhof 1988.
- Ratzlaff 1977 = Ratzlaff, Gerhard. Die mennonitischen Siedlungen in Ostparaguay. o. O.
- Dieselbe Studie erschien im Mennoblatt vom 1. Februar – 1. Juli 1977.
- Ratzlaff 2001 = Ratzlaff, Gerhard. Ein Leib – viele Glieder: Die mennonitischen Gemeinden in Paraguay. Asunción 2001.
- Wiebe 1997 = Wiebe, Gerhard. Ursachen und Geschichte der Auswanderung der Mennoniten aus Russland nach Amerika. Chihuahua, Mexico, 1997.
Fussnoten:
| |
| Auch eine Anzahl russischer Mennoniten vertreten. |
| Dyck 1970, S. 21, wortgetreue Wiedergabe hier wie auch in den folgenden Zitaten. |
| Epp 1982, S. 94. |
| Friesen 1987, S. 18. |
| ebd, S. 21. |
| Epp, 1982, S. 96 und Epp 1990, S. 340. |
| Wiebe, 1900, S. 51-52. |
| nach Adolf Ens, Winnipeg, eMail vom 17. Mai 2002. |
| Dyck 1970, S. 43. |
| ebd, S. 47-48. |
| ebd, S. 45. |
| Epp 1982, S. 97. |
| Dyck 1970, S. 43; Epp 1990, S. 346. |
| „School Attendance Act" Francis 1953, S. 230. |
| Dyck 1970, S. 45; Epp 1982, S. 100. |
| Epp 1990, S. 348. |
| ebd, S. 354-357) |
| Francis 1953, S. 233. |
| Dyck 1970, S. 52. |
| Epp, 1982, S. 102. |
| ebd, S. 103-105. |
| Dyck, 1970, S. 70. |
| Epp 1982, S. 106. |
| Epp 1982, S. 106; Friesen 1989, S. 32. |
| Email vom 25. Mai 2002. |
| Dyck 1970, 56. |
| ebd, S. 52. |
| Epp 1982, S. 122. |
| ebd, S. 122. |
| Friesen 1987, S. 174, vgl. S. 130, wo 1742 Personen angegeben werden. |
| ebd, S. 168-270. |
| ebd, S. 277) |
| Ratzlaff 1977, S. 10. |
| Klassen, 1988, S. 318. |
| Ratzlaff, 2001, S. 58. |
| Ratzlaff 2001, S. 169-172. |
| ebd, S. 172. |
| ebd, S. 172-73. |
Der Einfluss der Schulen im internen Wandel der Kolonie Menno in den fünfziger und sechziger Jahren
Andreas F. Sawatzky
Zur Vorgeschichte:
Jede gesellschaftliche Entwicklung hat seine Vorgeschichte und so auch das Schulwesen und der Wandel in der
Kolonie Menno. Obwohl die Gemeinden und deren Mitglieder, die damals in den Jahren 1926 – 28 von Kanada nach
Paraguay auswanderten, sich scheinbar alle darin einig waren, dass es bei ihnen allen um das Schulwesen ginge, liegt der Gedanke nahe, dass sie auch in Bildungsangelegenheiten nicht alle derselben Meinung waren, wenn man diese Gruppen rückblickend betrachtet.
Einige Eltern dieser Auswanderer hatten ihre Kinder schon in Kanada pflichtgemäß in Staatsschulen geschickt – in einzelnen Fällen wohl schon bis zum zwölften Schuljahr. Andere Väter zahlten Strafgelder oder gingen sogar ins Gefängnis, weil sie ihre Kinder nicht in die Regierungsschulen schicken wollten. Die allgemeine Schlussfolgerung unserer Vorfahren war: „Was die Schule ist, das wird später die
Gemeinde". Und da es in den Staatsschulen keinen Religionsunterricht bzw. Bibelunterricht gab, waren sie fest davon überzeugt, dass auch die
Gemeinde verweltlichen würde, wenn die Kinder in `weltlichen’ Schulen ihren Unterricht bekämen.
Es ist ganz logisch anzunehmen, dass Jugendliche, die in Kanada schon bessere und höhere Schulen besucht hatten und nachher hier in
Paraguay ihre Familien gründeten, über das Schulwesen anders dachten als solche, die nur die zurückgebliebenen, konservativen Schulen in der mennonitischen Gemeinschaft besucht hatten; denn
Bildung beeinflusst das Denken und die Haltung eines Menschen. Da hatten unsere Vorfahren mit ihrer Ansicht ganz recht, dass der Einfluss der Schulen auf die Gesellschaft und die Gemeinden nicht zu unterschätzen sei.
Dass der Keim zur Verbesserung unseres Schulwesens in
Menno schon von Kanada mitgebracht worden ist, geht aus oben Gesagtem hervor und ist auch schon öfters erwähnt worden. Aber bei der Planung zur Auswanderung erhoben auch führende Persönlichkeiten den Finger und warnten, dass sie in Kanada schon zu weit mit der Welt mitgegangen seien und in
Paraguay wieder zurückstecken müssten; ja zurück zum „wahren biblischen Boden", den sie in Kanada schon teilweise verlassen hätten, weil sie den Verlockungen der Welt nicht genug Widerstand geleistet hätten. (z.B. im Gebrauch von Autos,
Telefon etc). Hierfür liegen Beschlüsse vor, die auf einer Predigerkonferenz am 17. Januar 1923 in Kanada gefasst wurden. Diese wurden in
Menno Informiert, Ausgabe August 2001, veröffentlicht. Es liegen in unserm Geschichtsarchiv diesbezüglich auch noch andere Schriften vor.
Heinrich Ratzlaff zitiert hierzu
Im Dienste der Gemeinschaft, von August 1991, aus einem Schreiben von Peter B. Funk (langjähriger Lehrer und
Prediger in der
Kolonie Menno): „Es muß aber noch gesagt werden, dass unter den Auswanderern auch solche waren, die etwas tiefer schauten und die Notwendigkeit einer Verbesserung des Schulwesens erkannten. Einer von ihnen hat gesagt: „Wenn die Erziehung in Haus und Schule nicht verbessert werden wird, wird die Auswanderung nichts helfen’". Aus seinen Beobachtungen und seinem Miterleben in der späteren Siedlungszeit schreibt Funk: „Die Nichtzufuhr neuer, unterrichtsbelebender Stoffe und Anregungen führte (oder hatte schon lange geführt) zu einer Erstarrung des Schulwesens. Das wurde auch immer von dem einen oder andern eingesehen, aber nicht von der `bestimmenden’ Masse der Gemeinschaft, die in dem Beschreiten neuer Wege in schulischer Beziehung immer nur den Untergang ihrer Glaubensgemeinschaft witterten. Und daran scheiterte dann auch jeder Versuch, der dann und wann zur Aufbesserung und Belebung des Schulwesens gemacht wurde."
Der mitgebrachte Keim zur Verbesserung des Schulwesens in
Menno fing schon in den dreißiger und vierziger Jahren an zu wachsen.
M. W. Friesen schreibt in: „
Kanadische Mennoniten bezwingen eine Wildnis":
(2)
„Der Gemeindeälteste und einige schulverbesserungsbeflissene Brüder (darunter auch Lehrer) sannen auf einige Verbesserungsvorschläge. Ein Schritt, der unternommen wurde, war die Bestellung von Schulbüchern für den Deutschunterricht. Der Gemeindeälteste machte es einfach auf eigene Faust. Er bestellte eine kleine Sendung Bücher (R. Lange) von Deutschland. Er hatte weder die Mehrheit des Gemeindevorstandes noch die Gemeinde hinter sich. Als die Sendung angekommen war, nahm er sie mit zu einer der drei im Schuljahr stattfindenden Lehrerversammlungen, die diesmal im Dorf Halbstadt war. Das war im Jahre 1933. In der Lehrerversammlung war man soviel aufgebracht: Ältester Friesen mußte unverrichteter Sache die Schulhefte mit nach Hause nehmen. Bald kamen dann einzelne Lehrer und holten sich von diesen Büchern und benutzten sie in der Schule. Die Sprachverbesserungsangelegenheit ging langsam, aber sie ist nie mehr zum Abbruch gekommen."
Zu dieser Zeit wurde in den Schulen auch schon darum gestritten, ob man zu `A’ `Au’ oder richtig `A’ sagen sollte. So hat mir meine älteste Schwester, aus ihrer Schulzeit, zu Beginn der dreißiger Jahre erzählt. Sie besuchte die Dorfsschule in Halbstadt. Ihr Lehrer lehrte ‘A’ , andere aus dem Dorf wollten nicht mitmachen mit dieser `Verweltlichung’.
Auch ich habe dies am Anfang der vierziger Jahre miterlebt, als ich zur Grundschule in Ebenfeld ging. Unser Lehrer lehrte `A’ und auch meine Eltern unterstützten dies. Die Kinder einer
Familie hatten von zu Hause strengstens mitbekommen, dass sie beim `Au’ bleiben sollten. Als eine Schülerin aus dieser
Familie dran war zu lesen, sagte sie Au, obzwar der Lehrer es mit der Aussprache schon vorher klargestellt hatte. Der Lehrer: `A!’ Wieder: `Au’. Da nahm der Lehrer seinen Riemen, ging zur Stelle, gab ihr einen Hieb und wiederholte: `A!’ Die Schülerin: `Au’. Als bei einer weiteren Wiederholung dieses Prozesses die Schülerin nicht beigab, gab der Lehrer es auf und ließ andere Schüler weiter lesen.
Dies scheint heute eine unbedeutende Kleinigkeit zu sein; aber es war ein wichtiger Ausgangspunkt für die Erneuerung bzw. Verbesserung in der Sprachlehre oder des Schulwesens in
Menno überhaupt. Die Position bei der Mehrheit war: Man darf auch nicht in Kleinigkeiten nachgeben oder etwas ändern; denn wenn man hierin nachgibt, dann geht die `Verweltlichung’ unaufhaltsam weiter.
(3)
In den vierziger Jahren schon kamen interessierte Lehrer an den Abenden zusammen und haben sich gegenseitig im Gebrauch der genannten Sprachbücher (und auch anderer) unterrichtet. Denn kaum jemand aus der Zeit hatte eine Ahnung von grammatischen und orthographischen Regeln.
Ausser R. Lange hatten einige Lehrer auch noch: „Erstes, Zweites und Drittes Übungsbuch für den Unterricht in der deutschen Sprache", bearbeitet von Professor R. Rechsin, herausgegeben im Namen der
Lehrerkonferenz von Cleveland.
Lehrer Martin W. Friesen hat sich durch Selbststudium und auch durch Anleitung von Fernheimer Lehrern eine Grundlage in grammatischen und orthographischen Regeln verschafft und dieses Wissen an interessierte Lehrer (und später auch in der `
Knabenschule‘) weitergegeben. Hier gab es auch schon Bücher für die Schüler. Aus meiner eigenen Schulzeit weiß ich, dass einige Lehrer schon 1946 etwas Sprachlehrunterricht nach Richard Lange in den oberen Klassen der Grundschule (Bibler) erteilten. Dieser erweiterte Unterricht wurde in den Dörfern geboten, wo der Lehrer und die Mehrheit des betreffenden Dorfes dafür oder zumindest nicht dagegen waren. In unserem Dorf Ebenfeld war die Mehrheit dafür oder nicht dagegen.
Diese Kurse und Verbesserungsbestrebungen einiger Lehrer in den Schulen können wohl als die direkten Vorläufer unserer Fortbildungsschule, die in Ebenfeld ihren Anfang nahm, angesehen werden. Ebenfeld liegt 10 km südlich von
Loma Plata.
Durch dieses Sich-Weiterbilden wie auch durch spätere regelrechte Lehrerkurse, die in Zusammenhang mit der Fortbildungsschule schon 1952 auf freiwilliger Basis eingeführt wurden, hatten die Lehrer selber neue Erkenntnisse und neue Überzeugungen gewonnen, wodurch sie mit vielen anderen zusammen das Schulwesen der
Kolonie Menno mit Überzeugung und Hingabe noch über Jahrzehnte vorantreiben konnten. Der Übergang vom alten, traditionellen Grundschulwesen zum neuen vollzog sich in
Menno in einem Zeitraum von etwa 25 Jahren (von Ende der vierziger bis Anfang der siebziger Jahre) und lief parallel mit der Entwicklung der Fortbildungsschule bis zum vollständigen und staatlich anerkannten Colegio Secundario im Jahr 1973.
Kurze Beschreibung der früheren Schulen, wie unsere Vorfahren sie von Kanada mitgebracht hatten
Vollständigkeitshalber gebe ich hier einen kurzen Überblick über unser früheres Schulprogramm:
Damals waren die Schüler nicht im heutigen Sinne in Klassen aufgeteilt.
Es war aber festgelegt, wie lange die Kinder zur Schule gehen sollten: Die Mädchen vom 6. bis zum 12. Lebensjahr und die Knaben vom 6. bis zum 14. Lebensjahr. Die vier Schülergruppen (anstatt Klassen) waren folgende:
Die Fibler (Anfänger): Sie lernten das ABC, leichtes Lesen und schreiben und mussten die Zahlen kennen und schreiben können.
Die Katechismer (diese konnten schon etwas lesen und der
Katechismus diente als Lese-Übungsbuch) – Der
Katechismus hat 202 Fragen und Antworten + 10 Gebote = 212 insgesamt.
Die Testamenter (diese konnten schon einen Teil des
Katechismus auswendig nach Fragen und Antworten aufsagen – natürlich auch schon besser lesen) und das Einmaleins beherrschten, letzteres wohl nicht immer.
Die Bibler: Der Maßstab, um vom Testament in die
Bibel zu kommen, so nannte man es damals (oder die
Bibel zu bringen) war, dass der Schüler den
Katechismus nach Abfragen ganz auswendig aufsagen konnte. Etwa drei Fehler wurden geduldet. Gleichzeitig konnten solche Schüler auch meistens besser lesen. Es gab öfters Schüler, die den
Katechismus schon vor Vollendung des 9. Lebensjahres ganz auswendig hersagen konnten. Dann waren sie für den Rest ihrer Schulpflicht eben `Bibler’. Auf Schönschreiben wurde großes Gewicht gelegt: Jeden Tag eine Stunde Schönschreiben und jeden Monat wurde eine Probeschrift geschrieben, die bei Schulprüfungen den Predigern vorgelegt wurde.
Gute Schüler mussten oder durften sich auch manchmal zu den kleineren gesellen und ihnen im Schreiben und Lesen helfen, was sie sehr gerne taten, zumal dies eine angenehme Abwechselung für sie bedeutete. Während der ganzen Schulpflichtzeit musste Folgendes unbedingt auswendieg gelernt werden: Die Schulregeln, der
Katechismus, bis Hundert zählen hin und zurück, das Einmaleins, Münzen, Gewichte und Maße, einige Gedichte, Lieder (besonders zu
Weihnachten und Neujahr) und eine Menge von Bibelversen.
Hausaufgaben gab es nur im Lesen der biblischen Geschichten,
Katechismus und Lieder oder Gedichte auswendig lernen.
Allgemein wurde viel Wert darauf gelegt, dass die Schüler auch vom Zuhören lernten. So mussten die kleineren Schüler, Fibler und Katechismer, während die biblischen Geschichten `verhandelt’ wurden oder wenn die Testamenter und Bibler am Freitag den
Katechismus aufsagten, mit gefalteten Händen auf dem Tisch, zuhören. Wenn sie Antworten wussten, durften sie auch die Hand heben und antworten, wenn der Lehrer eine Frage gestellt hatte.
Mit dem Sprachlehrunterricht am Ende der vierziger Jahre kamen in den fünfziger und sechziger Jahren nach und nach auch andere Fächer hinzu, so dass der traditionelle Tages- und Stoffplan in den Schulen sich auch dementsprechend mit der Zeit veränderte, aber immer nur in den Dörfern, wo der Lehrer es konnte und wollte und wo zumindest ein Teil der Dorfbewohner solches unterstützte.
So wurden z. B. am Anfang der fünfziger Jahre auch die nach Klassen eingeteilten Kempinski-Rechenbücher eingeführt. Mit der Einführung neuer Fächer ging die differenzierte Klasseneinteilung Hand in Hand.
Der Einfluss der Schulen auf den internen Wandel der Kolonie in den fünfziger und sechziger Jahren.
In allen Bereichen der Gesellschaft von
Menno ging der Wandel hauptsächlich von der Fortbildungsschule und von den Männern, die diese förderten und vorantrieben, aus.
Vorbereitung von Dorfsschullehrern: Zu allererst ist hier die Vorbereitung von Dorfsschullehrern zu nennen. Die Gemeindeleitung und die Kolonieverwaltung waren zu der Einsicht gekommen, dass in Sachen
Bildung etwas mehr getan werden müsste, wenn wir als mennonitische Gemeinschaft in dieser Weltabgeschiedenheit uns weiter behaupten und selbst verwalten wollten, und da musste man bei der Grundschule anfangen.
Mit unseren Schulen war es in
Paraguay schon bergab gegangen und es wurde immer schwieriger, auch nur halbwegs geeignete Männer für die Führung einer Schule im Dorf zu finden und sie als Lehrer anzustellen. So wurde als Hauptbegründung dafür, dass am 16. Januar 1951 die
Knabenschule in Ebenfeld,
Kolonie Menno, ins Leben gerufen wurde, ins Feld geführt, dass die
Kolonie besser vorbereitete Lehrer bräuchte. Denn „Stille stehen heisst zurückegehen", wurde von den führenden Männern betont, welches sich auch schon stark bemerkbar machte.
Bei einigen fand diese Begründung Anklang. Und es wurde aufgefordert, dass besonders solche Jünglinge sich zu diesem Unterricht anmelden sollten, die sich auch für den Lehrerberuf interessierten. Das war aber nicht Bedingung; denn irgendwelche interessierten Jungen wurden in diese Kurse aufgenommen. Viele von diesen Jünglingen, die in den sechs Jahren (1951 – 56) in Ebenfeld (1 Jahr in der Dorfsschule und 5 Jahre in einem Nebenhaus von Cornelius T. Sawatzky) und auch später in
Loma Plata diese Schule besuchten, sind bald darauf als Lehrer angestellt und oftmals auch als
Prediger gewählt geworden. Diese haben in ihrer Arbeit auch großen Einfluss auf die Gemeinschaft ausgeübt. Viele Bürger sahen dass die Schulen, die mit etwas besser gebildeten Lehrern besetzt waren, meistens mehr leisteten und für die Schüler auch interessanter waren. Und so schlugen die Wellen mit der Entwicklung der Fortbildungsschule auch in den Volksschulen immer mehr um sich.
Die
Schulreform: Die traditionellen Schulen verloren immer mehr an Boden. Der
Lehrdienst und der Schulverein bzw. der
Schulrat gingen in Sachen der
Schulreform langsam und vorsichtig vor. Die
Schulreform setzte nicht gleichzeitig in der ganzen
Kolonie ein und wurde auch keinem Dorf aufgezwungen; denn dazu hätte die
Kolonie auch nicht genügend Lehrer gehabt um solches durchzuführen. Andererseits gab es ja auch unter den führenden Persönlichkeiten keine ausgebildeten Fachkräfte, die genau wussten, wo es entlang gehen sollte. Nur, dass es vorwärts gehen müsste und dass der Bildungsstand zu niedrig sei, war ihnen klar. „Werden wir weiter beim `Alten’ bleiben, wie die Mehrheit es wollte, so wird die Gesellschaft noch weiter absacken und schliesslich ohne Lehrer und Führungskräfte bleiben. Dann würde wahrscheinlich auch hier die Regierung eingreifen, und wir wären wieder da, wo in Kanada, wo sich auch die Regierung einmischte und weshalb wir ausgewandert sind", waren wichtige Argumente um die Schulen zu verbessern, zu reformieren.
Auch im Verwaltungsbereich der
Kolonie bräuchte man Männer, die Spanisch sprechen könnten. Und auch hier taten sich einige Angestellte zusammen, um gemeinsam die spanische Sprache zu erlernen: Durch Selbststudium, durch Anleitung anderer, die schon etwas weiter hierin waren (ähnlich wie beim Deutsch lernen der Lehrer). Durch die Praxis hatten sich einige mehr Kenntnisse in der spanischen Sprache angeeignet, und konnten Geschäftssachen für die Gemeinschaft abwickeln und Beziehungen zu der Regierung pflegen. Die Gemeinschaft von
Menno hatte das Glück, dass Gemeindeleitung und Kolonieleitung in Sachen Weiterbildung gemeinsam vorgingen.
Die Ausbildung von Lehrern in Menno
Als erster Kandidat der
Kolonie bekam ich, Andreas F. Sawatzky, im Dezember 1954 durch Lehrer Martin W. Friesen die Gelegenheit zum Spanisch lernen für ein paar Monate nach
Asunción zu fahren. Lehrer Friesen wusste, dass ich gerne mehr lernen wollte, und in
Menno gab es zu der Zeit nicht viele Kandidaten (vielleicht auch sonst keine) für so eine Weiterbildung. Ich hatte 1952 die `
Knabenschule‘ bei M. W. Friesen in Ebenfeld besucht und war ab 1953 Dorfsschullehrer, wie man es damals nannte.
Dieses Angebot kam über unseren damaligen Oberschulzen, Herrn Jacob B. Reimer, vom
MCC-Vertreter aus
Asunción. Es handelte sich dabei um ein Stipendium vom
MCC für
Menno, wie mir später mitgeteilt wurde. Alle Unkosten für diesen Kursus würde die
Kolonie bzw. das
MCC übernehmen. Es ging hauptsächlich um Kost und Quartier; denn in einer Staatsschule brauchte man kein Schulgeld zu zahlen.
Natürlich interessierte mich das, denn ich hatte schon öfters überlegt, wie ich dazu kommen könnte, Spanisch zu lernen. Es gab zu der Zeit dazu kaum eine Gelegenheit. Unser Vater hatte für uns Jungen ein oder mehrere Büchlein mit Sätzen in Spanisch und Deutsch gekauft, woraus wir dann etwas auswendig lernten.
Ich fuhr dann Anfang des Jahres 1955 nach
Asunción, nichts ahnend, was mir dort begegnen würde. Die Situation dort war dann auch ganz anders als ich sie mir vorgestellt hatte: Der Unterricht hatte schon Anfang Dezember angefangen. Es gab dort keinen „Spanischkursus", auf den ich mich eingestellt hatte, sondern Kurse für Lehrer aus dem Landesinneren („Campaña"), die überall im Lande ohne Titel und mit sehr schwacher Allgemeinbildung in den `Primarias’ unterrichteten. Natürlich wurden die Kurse in Spanisch gegeben, von Lehrern, die kein Deutsch verstanden. Nach vier Sommerkursen konnten die `Lehrer’ sich dann den Titel „MAESTRO NORMAL DE CUARTA CATEGORIA" erwerben.
Ich ließ mich zur Schule bringen von solchen, die die Stadt kannten und auch Spanisch sprachen. Hierbei waren mir die folgenden Personen behilflich: Die Arbeiter von unserer Vertretung in
Asunción wie Jacob J.
Hiebert, Abram W. Hiebert und Jacob A. Braun sowie auch Lehrer David Boschmann, Ex-Fernheimer, bei dem ich wohnte.
Da ich nicht von Anfang an da gewesen war, nahm man mich nur als `Oyente’ (= Zuhörer) in der Schule auf. Ich setzte mich in die erste Klasse und machte mit, so gut ich konnte. Meine Spanischkenntnisse aber waren so schwach, dass ich nicht einmal die Fachbenennungen verstand. Worte wie Pedagogía, Didáctica, Historia, Ciencias Naturales etc. waren mir völlig fremde Begriffe. Wenn das Fach `Aritmética’ dran war, dann wusste ich, um welches Fach es sich handelte; denn dabei wurden Zahlen an die Wandtafel geschrieben, aber das Wort `Aritmética’ verstand ich bis dahin auch noch nicht. Auch das Wörterbuch -Diccionario- verstand ich nur zum Teil zu benutzen. Auf diese Art, dachte ich, könnte ich nicht Spanisch lernen und schrieb dann an Martin W. Friesen, teilte ihm meine Mutlosigkeit mit und meinte, es wäre wohl besser, wenn ich aufgeben und zurückkehren würde.
In einem Brief vom 8.1.55 schrieb Lehrer Friesen mir dann zurück: „
Vorsteher Reimer und ich besprachen Deine Angelegenheit – die auch unsere ist – u. entschlossen uns Br. A. W. Hiebert zu beauftragen, Dir eine Spanischstunde am Nachmittag jeden Tages zu ermöglichen, welches Dich ermutigen und auch praktisch vielleicht noch mehr befähigen dürfte. Das bereits Angefangene aber sollst Du so weiter mitmachen." Weiter zeigte Herr Friesen Verständnis für meine Lage und sprach mir im Brief Mut zu, nur durchzuhalten.
Ich beteiligte mich zusammen mit Herrn Jacob J. Hiebert am Zusatzunterricht an den Abenden und nahm weiter als `Oyente’ am Lehrerkursus teil.
An vielen Nachmittagen ging ich meine Lektionen aus der Schule dann mit Erwin Boschmann (ca. 16), Sohn von David Boschmann, durch und schrieb mir die unbekannten Wörter (fast alle waren unbekannt) zwischen die Linien oder machte mir Listen davon und paukte sie ein. Viele Wörter habe ich mit dem Zettel in der Hand auf dem Schulweg gelernt.
Als am 20. Februar 1955 der Kursus abschloss, konnte ich dem Unterricht schon folgen, wenn ich auch noch nicht alles verstand.
Nun hatte ich Mut gefasst und fuhr 1955 schon zum Dezember (zum Beginn des Kursus) hin, ließ mich einschreiben (was auch noch seine Schwierigkeiten hatte, weil ich kein Abgangszeugnis aus der Primaria vorlegen konnte) und schloss jeden Sommer einen Kursus ab (1956/57/58/59), womit ich den o.g. Titel erworben hatte.
Anschließend studierte ich noch zwei volle Jahre, 1959 und 1960, in einer `Escuela Normal’ – Lehrerausbildung -, die ich mit dem Titel „MAESTRO NORMAL SUPERIOR, PRIMERA CATEGORIA" abschloss. Seitdem, wie auch in den Jahren 1957 und 1958, habe ich in unserer `Secundaria’ unterrichtet, wenn ich nicht studierte.
1963 war ich ein Jahr als erster Austauschlehrer von
Menno (
PAD) in Worms, Deutschland.
In den Jahren 1968 – 71 habe ich an der Katholischen Universität in
Asunción meinen „LICENCIADO EN MATEMATICAS" gemacht.
Jacob W. Hiebert schloss in den sechziger Jahren den
Bachillerato in
Asunción ab, studierte anschließend vier Jahre Philosophie und schloss sein Studium 1970 mit „LICENCIADO EN FILOSOFIA" ab.
Lehrerausbildung in Filadelfia, Fernheim
In den Jahren von 1957 – 1963 wuchs unsere Fortbildungsschule – Bibelschule – nach und nach in das Programm der Zentralschulen der anderen
Mennonitenkolonien hinein und wurde per Resolución vom 14. Februar 1963 mit den Zentralschulen von
Fernheim,
Neuland,
Friesland und
Volendam zusammen vom Erziehungs- und Kultusministerium als `Ciclo Básico’ anerkannt (vier Zentralschuljahre gegen drei Jahre). Damit wurde auch die Lehrerausbildung aufgestockt und reformiert. Sie dauerte im Anschluss an den Ciclo Básico noch drei Jahre, wie das auch beim
Bachillerato der Fall war.
Vor 1963, als unsere Fortbildungsschule noch nicht nach den Programmen der anderen Zentralschulen arbeitete, gingen einige von unseren Schülern nach
Filadelfia, um dort die letzten zwei Jahre der
Zentralschule abzuschließen und anschließend die zwei pädagogischen Klassen zu beendigen, womit sie dann ihr Lehrerzeugnis als Grundschullehrer (Primaria) erworben hatten.
Erster Lehramtskandidat aus der
Kolonie Menno war hier Heinrich W. Reimer, Sohn des langjährigen Oberschulzen Jacob B. Reimer. Er schloss seine Lehrerausbildung 1964 ab. 1965 haben seine beiden Schwestern Tina und Maria so wie Isbrand K. Hiebert auf demselben Wege diese Lehrerbildung abgeschlossen. Außer Maria haben diese Junglehrer anschließend in der
Kolonie als Lehrer gearbeitet. Martin H. Sawatzky und Wilhelm F. Günther schlossen 1962 ebenfalls die
Zentralschule in
Filadelfia auf dieselbe Weise ab.
Von dieser Zeit an nahm die Lehrerausbildung in
Menno mehr oder weniger seinen normalen Lauf: Zuerst Ciclo Básico in
Loma Plata, dann weiter zur Lehrerausbildung nach
Filadelfia oder
Asunción.
Der erste Schüler aus
Menno in
Filadelfia war Jacob T. Fehr, Sohn von Jacob S. Fehr. Er schloss dort in den Jahren 1956/57 die ersten zwei Zentralschulklassen ab und 1959 den C. Básico in
Asunción und war somit der erste Schüler der den Básico in
Asunción abgeschlossen hat, beides ganz privat.
Gemeindetrennung und Einfluss auf dem Gebiet der Gemeinde:
In dieser Zeit wurden auch Stimmen laut, die von einer Gemeindetrennung sprachen, etwa in dem Sinne: Wir wollen beim `Alten’ bleiben, `wie wir es immer gehabt haben’ und uns von denen trennen, die vorwärts oder mit der `Welt’ mitgehen wollen. Laut Protokoll einer Predigersitzung vom 21. September 1956 wurden bezüglich eines Austritts einer Gruppe aus der
Gemeinde einige Männer auf der Predigersitzung vorstellig und wollten eine
Bruderschaft anberaumt haben, wo sie offiziell aus der
Gemeinde als Gruppe austreten wollten. Grund: `Weil sie ihr Altes halten wollten’. („Haulte, waus du haust, damit niemand deine Krone raube!" so steht es in der
Bibel). Die Predigerschaft aber nahm den Antrag nicht an.
Und laut Protokoll einer Predigersitzung vom 19. Juli 1957 sind hier in
Menno zwei
Prediger der
Kolonie Sommerfeld gewesen, um die Angelegenheit wegen Gemeindetrennung zu untersuchen. Laut Punkt 5 dieses Protokolls heißt es:
„Da eine unruhige Gruppe unter uns ist, welche sich nicht in unserm Wirken schicken will, und daher etwas anderes will, so sind auf ihren Wunsch 2 Prediger von Kolonie Sommerfeld hier her gekommen, um ihnen zu untersuchen und ihrem Begehren womöglich zu fördern. Sie haben auch mit Ält. M. C. Friesen gesprochen, und in dem, was er ihnen sagte, haben sie auch nichts gesucht zu widerlegen. Sie wurden auch zu unserer Sitzung eingeladen, welches sie aber ablehnten. Wir bestehen aber darauf, dass sie zu unserer Sitzung kommen, bevor sie hier etwas unternehmen. Das soll Ält. Friesen ihnen schreiben. (Welches auch schon geschehen ist.)"
Im Protokoll vom 26. September 1957, Punkt 1 heißt es weiter zu diesem Thema: „Ein Brief von Ält. Isbrand Friesen (aus
Sommerfeld, AS.) wurde vorgelesen; es war eine Antwort an uns auf unsern letzten Brief an ihn, in Angelegenheit einer Neugründung einer
Gemeinde, welches etliche von den unsern wünschten. Es wurde aber nicht für unbedingt notwendig gehalten, ihn zu beantworten." Hiermit ist wohl das Thema Gemeindetrennung unter Mithilfe von Mennoniten aus Caaguazú abgeschlossen worden.
Es ist in
Menno nie zur Gemeindetrennung gekommen, wenn es auch bezüglich des Schulwesens viel Uneinigkeit und Streit gegeben hat, z. B. auf Bruderschaften, Koloniesitzungen und auch sonstwo.
In dieser Zeit sind aber einige Gruppen hauptsächlich wegen der Schulen, der Erneuerungen in der
Gemeinde und in der Kolonieverwaltung nach Bolivien ausgewandert. Sie waren auch gegen das Kooperativswesen das durch das Kooperativsgesetz der Regierung in den sechziger Jahren befestigt wurde.
In den Jahren 1956 – 1960 ist im Blick auf Erneuerungen viel Bewegung in die Gemeinschaft von
Menno gekommen. Es hatte wohl damit zu tun, dass 1956 die Vereinsschule nach
Loma Plata verlegt und schon 1957 in einem ansehnlichen Hause mit drei Klassenzimmern und einem Lehrerzimmer in Betrieb genommen wurde.
Laut Protokoll einer Predigersitzung vom 14. Juni 1956 wurde bereits auf der `
Bruderschaft‘ am 9. Juli in der Kirche zu Weidenfeld über den Bau der neuen Schule informiert. Diskutiert oder abgestimmt wurde jedoch nicht, denn dazu war diese Sache noch nicht reif.
Mit diesem zu der Zeit großen Bau (Schulbau) mit auffälligen Giebelformen trat die Schule aus dem Versteck eines kleinen Hauses in Ebenfeld mehr an die Öffentlichkeit und demonstrierte damit, dass auf dem Gebiet der Weiterbildung und
Schulreform wirklich etwas getan wurde und diese Entwicklung unaufhaltsam weitergehen sollte. In
Loma Plata wurde gleich in zwei Klassen unterrichtet, und es wurden zum ersten Mal auch Mädchen in dieser Schule aufgenommen. Insgesamt waren 1957 in der neuen Schule 25 Jungen und 7 Mädchen, das sind 32 Schüler, während die Schülerzahl in Ebenfeld immer nur zwischen 12 und 20 Jungen betragen hatte.
Laut Protokoll einer Predigerkonferenz wurde am 3. April 1952 der erste
Schulrat in
Menno vom
Lehrdienst eingesetzt. Bis dahin unterstanden die Schulen ganz dem
Lehrdienst, Gemeindevorstand; aber auch jedes Dorf für sich hatte ein gewichtiges Wort mitzusprechen, wenn es um die Anstellung und Entlohnung des Lehrers im Dorf ging. Es war für die Anstellung und den Lohn des Lehrers bis dahin verantwortlich gewesen.
Lehrdienst und
Schulrat (Schulverein, Schulkomitee) arbeiteten etwa 21 Jahre (von 1952 bis 1972) parallel und zusammen in Schulangelegenheiten. Nach und nach wurde die Schulverwaltung führend auf diesem Gebiet, und auf den Predigersitzungen wurden die Punkte über Schulangelegenheiten immer weniger, so dass nach 21 Jahren Übergangszeit das Kind – Schulverwaltung – mündig wurde, so dass seit 1972 wohl kaum noch über Schulangelegenheiten auf Lehrdienstsitzungen gesprochen wurde. So viel mir bekannt ist und auch aus den Protokollen hervorgeht, hat es hierbei kaum Kompetenzschwierigkeiten gegeben. Diese Gremien haben meist gut zusammengearbeitet, auch wenn der
Lehrdienst der
Gemeinde nicht immer alles billigen wollte, was von der Schule aus getan wurde (z.B. in Sachen Theater, Nationalhymne singen, Mädchensport, Filmvorführungen etc.).
Das ganze Schulwesen in
Menno wurde von nun ab 1972 vom
Schulrat im erweiterten Sinne verwaltet. Eine Zeitlang gab es für die Schulen in
Menno zwei Gremien, zwei Schulkomitees, die parallel arbeiteten: Eines für die Volksschulen und ein anderes für die
Zentralschule.
Die
Gemeinde war durch
Prediger bzw. Gemeindeleiter immer im
Schulrat vertreten und sie ist es auch heute noch.
Allgemeine Schulkasse:
1952 wurde auch die Allgemeine Schulkasse eingerichtet, und ab dieser Zeit wurden die Lehrer von einer zentralen Kasse aus, die in der Kooperative geführt wurde, bezahlt. Auch dies hat die
Schulreform gefördert und begünstigt, obzwar man auch hierin anfänglich bei vielen Bürgern auf Widerstand stieß. Andere Bürger hingegen haben dieses System tatkräftig unterstützt.
Ein Teil des Schulgeldes wurde zu dieser Zeit nach der Anzahl der Rinder, die ein Bürger besaß, verrechnet. Ein Bürger, der keine Schüler mehr hatte, aber ziemlich viel Vieh, protestierte: „Mine Ossi oppen Kaump leare nuscht; woroam saul eck fea de Schoolgeld toole?!".
Aber nach und nach gewöhnte man sich daran. Dieses System hat sich durchgesetzt und wurde bald zu einer feststehenden Einrichtung, die noch heute funktioniert, obzwar sich die Art und Weise der Beiträge für diese Kasse von Zeit zu Zeit etwas verändert hat. Aber auch hier war es so: Wer das Geld hat, hat am meisten zu sagen. Und so hatte der
Schulrat, in Zusammenarbeit mit dem
Lehrdienst, immer mehr bei der Anstellung der Lehrer in den Dörfern mitzureden.
In den siebziger Jahren wurden die Programme für die Volksschulen in allen Dörfern mehr oder weniger angeglichen, und die Lehrer erhielten ab dieser Zeit während des ganzen Jahres Lohn mit der Bedingung, dass sie sich in der freien Zeit im Sommer auch auf andern Gebieten für die Koloniegemeinschaft unentgeltlich einspannen ließen, z.B. für Zensusaufnahmen etc. Predigern, Diakonen oder Jugendarbeitern, die zugleich auch Lehrer waren, wurden die Gemeindearbeiten als `Sommerbeschäftigung’ angerechnet. Bis dahin bekamen die Lehrer nur so lange Lohn, wie sie im Jahr unterrichteten, d.h. `arbeiteten’.
Erneuerungen im Schulprogramm:
Einigen Dörfern aber war das alte Schulsystem noch am Ende der fünfziger Jahre so wichtig, dass sie sich selbständig einen `Lehrer’ suchten, der sich an keiner Fortbildung beteiligt hatte. Er wurde wie früher vom Dorf aus entlohnt, auch wenn die Dorfsbürger von den allgemeinen Schulauflagen nicht freigesprochen wurden. Öfters kamen diese Dorfsbürger dann nachträglich zum
Schulrat bzw. zum
Lehrdienst, um die Anerkennung ihres Lehrers durchzusetzen, damit er von der allgemeinen Kasse entlohnt würde. Dies wurde vom Schulvorstand auch meistens angenommen, wenn die Dorfsbürger und der betreffende Lehrer auch etwas entgegenkamen und zur Verbesserung des Unterrichts bereit waren. Es hat aber auch Fälle gegeben, wo die gegenseitige Anerkennung auf diesem Gebiet nicht zustande kam, und man es auch halb-offiziell so gehen ließ, bis das betreffende Dorf mit der Zeit doch nach und nach einlenkte. Wieder in anderen Dörfern, wo der Lehrer sich in guter Zusammenarbeit mit dem Schulvorstand für den Fortschritt einsetzte, aber nicht alle Bürger des Dorfes hinter sich hatte, musste er sich oftmals diesen gegenüber hart verteidigen, wenn es darum ging, neue Bücher einzuführen. Es kamen dann auch einmal selbstgebildete `Kommissionen’ in die Schule um nachzusehen, welche unnötigen oder gar `schädlichen’ Materialien bzw. Bücher der Lehrer schon in die Schule hineingebracht hatte, um diese dann eventuell zu entfernen oder auch zu zerstören.
Es ist vorgekommen, dass der Lehrer seine Landkarten am Montag unterm Schattendach oder auf dem Hof einsammeln musste, da der Schulbesorger (wenn dieser ein Gegner der Erneuerungen war) sie beim Vorbereiten des Schulhauses für die Andacht am Sonntag hinausgeworfen hatte (Heuboden).
Ein anderer Lehrer musste seine neuen Lesebücher von den Zaunpfosten der Straße einsammeln, die ein Nachbar aus dem Dorf gegen Abend dort ausgelegt hatte, weil es nach Regen aussah und die Bücher dann dort über Nacht eingeweicht werden sollten. Dies geschah im Dorf Friedensfeld, wo Kornelius K. Sawatzky Lehrer war und Cornelius S. Kehler die Bücher zerstören wollte. Der Lehrer wurde noch rechtzeitig benachrichtigt und konnte die Bücher noch vor dem Regen einsammeln – erzählt
Frau Anna Sawatzky.
Ein anderes Beispiel: Auf dem Schulzenbott in einem Dorf (Rosental), welcher in der Schule stattfand, kamen natürlich auch Schulangelegenheiten zur Sprache. Einigen Bürgern erschien die Zukunft der Schulen sehr dunkel zu sein. Ein Bürger nahm ein Erdkundebuch unterm Schülertisch hervor und sagte dann: Auf diesem Buch steht es klar geschrieben „Diesterweg"! `En so es daut uck met onse Schoole, de Wag es sea diesta!’
Mit der Erweiterung der Schulbildung machten sich auch immer mehr Mängel auf allen Gebieten bemerkbar: Lehrerkurse liefen schon seit 1952, und etwas später organisierte der
Lehrdienst auch für sich Predigerkurse.
Auf Predigersitzungen des Jahres 1958 wurde angeregt, dass die Kinder erst ab dem 7. Lebensjahr schulpflichtig sein sollten, und dass das Schuljahr in den Wintermonaten von fünf auf sechs Monate zu verlängern sei, – zusätzlich Dezember – . Diese Vorschläge kamen vom
Lehrdienst und sollten erst der
Bruderschaft vorgestellt werden, bevor sie als Beschluss bekannt gegeben würden.
Es wurde auf einer Predigersitzung vom 3. und 4. Februar 1959 ein Lehrplan mit Einbeziehung der neuen Fächer für die Schulen in Auftrag gegeben. In Punkt 3 dieser Sitzung heißt es: „Ein Lehrplan soll ausgearbeitet werden. Selbiger soll dann dem
Lehrdienst zur Prüfung vorgelegt werden, und wenn er anerkannt wird, soll er in der Vorschule (der Lehrerkursus vor Schulbeginn ist hier gemeint) durchgearbeitet werden, dass dann auch die Möglichkeit bestehe, in den Dorfsschulen mehr darnach zu arbeiten." Und weiter vom 11. März 1959, Punkt 2: „Der jetzige Stoffplan für unsere Schulen wurde vorgelesen und geprüft. Er wurde gründlich erwogen und besprochen. Es handelt sich um Sachen, die wir von je her zum Teil nebenbei in den Schulen hatten; jetzt aber zum Fach gemacht werden soll. Es wurde zugestimmt."
Lehrerkonferenzen mit anderen Kolonien:
Schon 1954/55 fuhr eine kleine Gruppe von Lehrern aus
Menno aus eigenem Interesse und auf Einladung der Konferenzleitung zu einer
Lehrerkonferenz des „Allparaguayischen Lehrerverbandes der Mennoniten" nach
Volendam. (Es waren die Lehrer Martin W. Friesen, Kornelius K. Sawatzky und Andreas F. Sawatzky). Eine etwas größere Gruppe aus
Menno hatte schon 1954 an einer
Lehrerkonferenz in Gnadental,
Neuland, teilgenommen. Auf beiden Stellen war die Teilnahme von
Menno aus ganz inoffiziell.
Weiter heißt es in einem Protokoll einer Lehrdienstsitzung vom 14. Januar 1959, Punkt 26: „Es wurde bekanntgegeben: In nächster Zeit wird in
Filadelfia ein
pädagogischer Kursus gegeben. Es wurde befürwortet, dass auch unsere Lehrer sich daran beteiligen". Es nahm wohl auch eine Gruppe von Lehrern aus
Menno daran teil; aber noch nicht alle. Um diese Zeit etwa sind die Lehrer von
Menno auch zu Konferenzen nach
Filadelfia eingeladen worden, und die mehr fortschrittlich gesinnten nahmen auch nach Möglichkeit daran teil, auch wenn es galt, mit Fahrrädern oder auf Buggis dahinzufahren.
Vereinzelt haben Lehrer aus
Menno auch Hospitationen in Schulen von
Fernheim gemacht. Das Umgekehrte ist auch geschehen.
Im Februar 1961 nahm schon eine größere Lehrergruppe aus
Menno an einer „Allgemeinen
Lehrerkonferenz" in
Neu-Halbstadt,
Neuland, auf Einladung teil. Auf dieser
Konferenz war auch der Kulturattaché der Deutschen Botschaft in
Paraguay, Herr Dr. Peter Bensch, zugegen. Herr Bensch hat sich sehr für das deutsche Schulwesen in
Paraguay eingesetzt, und durch ihn haben auch unsere Schulen viel Mithilfe in Form von Lehrmitteln und Geld aus Deutschland erhalten.
Menno nahm solche Mithilfen damals noch nur zögernd an; aber Lehrer Jacob Redekopp war hier schon seit 1960 an unserer
Zentralschule als Lehrer tätig und der hatte wohl keine Hemmungen, sich für unsere Schulen bei der Deutschen Botschaft in Zusammenarbeit mit dem damaligen Oberschulzen, Herrn Jacob B. Reimer, einzusetzen. Die
Deutsche Botschaft hat hier seitdem immer großzügig in Sachen Lehrmittelbeschaffung mitgeholfen.
Seit Juli 1963 ist der
Lehrerverein von
Menno Mitglied des Lehrerverbandes der Mennoniten Paraguays.
Im Protokoll einer Schulratsitzung vom 2. August 1963, Punkt 3 heißt es:
„Setzte Abram B. Reimer die Sitzung in Kenntnis, dass man sich dem `Lehrerverband der Mennoniten Paraguays’ angeschlossen habe auf der Lehrertagung inVolendam vom 7. – 10. Juli d. J. Leider habe man unterlassen vorher den Schulrat und die Gemeindeleitung hierüber zu unterrichten oder zu befragen; man findet dieses als einen Fehler und einigt sich in Zukunft solches vorher vom Schulrat und Gemeindeleitung bestätigen zu lassen."
Bemerkung:
Prediger Abram B. Reimer als Schulprüfer hatte mit etwa vier Lehrern zusammen (vom
Schulrat dazu beauftragt) aus
Menno an der Tagung in
Volendam teilgenommen.
Protokoll einer Predigersitzung vom 15. Dezember 1963, Punkt 4: „Der
Lehrerverein von
Menno hat sich etwas voreilig dem Lehrerverband der Mennoniten von
Paraguay angeschlossen; man hätte solchen Anschluss erst in weiteren Kreisen besprechen sollen, obzwar der Anschluß, der sonst keine Bedingungen in sich schliesst als gegenseitige Unterstützung, für gut angesehen wird."
Schülerfeste:
Nach 1963, als wir schon die große Aula hatten, wurden auch die ersten Schülerfeste von der ganzen
Kolonie, Nord- und Süd-
Menno zusammen, organisiert und durchgeführt, wo religiöse wie auch kulturelle Beiträge gebracht wurden. Das erste Schülerfest in diesem Rahmen hat wohl 1964/65 in
Loma Plata stattgefunden.
Überarbeitung des Katechismus:
Eine Kommission von Lehrern (H. Ratzlaff, W. F. Sawatzky, Korn. K. Sawatzky) wurde beauftragt, den
Katechismus zu überarbeiten; denn es wurde von vielen Lehrern bemängelt, dass er sprachlich wie auch inhaltlich nicht mehr ganz aktuell sei. Der
Katechismus sollte aber nicht aus den Schulen verschwinden, was viele mit der Reformierung der Schulen befürchteten.
Diese Kommission hat wohl auch etwas daran gearbeitet, das Werk aber nie zu Ende geführt, und der
Katechismus verschwand nach und nach in den siebziger Jahren – ohne einen offiziellen Beschluss – ganz aus den Schulen, obzwar er in einigen Schulen noch in den achtziger Jahren benutzt worden sein soll.
Dies hing auch damit zusammen, dass er in den
Kirchen nicht mehr von den Taufkandidaten aufgesagt werden musste. Stattdessen legten die Taufkandidaten Zeugnis vor der
Gemeinde ab.
Lehrerinnen in der Grundschule:
Es gab aber auch die andere Seite in der
Kolonie. Als es hier offiziell noch nicht in Frage kam Lehrerinnen anzustellen, hatte sich in Schönwiese eine Gruppe von Eltern zusammengetan, um in einem Privathaus den Unterricht ihrer Kinder mit einer Lehrerin zu organisieren. Wie viele andere Mennobürger damals (1947/48) hatten auch sie „
Flüchtlinge", die späteren Neuländer, aufgenommen und entdeckten, dass sich unter ihnen eine
Frau mit Namen Agnes Martens befand, die sich für Schularbeiten interessierte. Sie selber schreibt mir dazu in einem Brief: „Als wir nach
Menno kamen und einige Zeit bei Bernhard Töws waren, fragten mich Abram und Anna Bergen, ob ich nicht zu ihnen kommen wollte und ihre beiden Kinder unterrichten. Sie waren zu Besuch gekommen, die beiden Frauen waren Schwestern (Töchter von Isaak Fehrs). So ging ich dann nach Bergtal, damaliger Wohnort von Abram Bergen, und unterrichtete die beiden Kinder, bis wir im August ansiedelten. Das war mein erstes Jahr als Lehrerin. Sie verpflichteten mich gleich für den nächsten Winter, indem sie uns ein sehr zahmes Pferd gaben. Ein Pferd hatten wir schon… Im nächsten Jahr kamen schon mehr Schüler dazu, wie es sich rumgesprochen hatte. Herr Isaak Funk, dessen Kinder auch angemeldet waren, besorgte die Bücher, Landkarten und den Stoffplan für den Unterricht von C.C. Peters, der zur Zeit Zentralschullehrer in
Fernheim war. Am Anfang musste ich jedes Kind persönlich nehmen und sehr intensiv arbeiten, bis ich sie alle in Klassen eingeteilt hatte. Lesen und Schreiben war sehr schwach. Rechtschreiben und Sprachlehre keine Ahnung, aber was sie konnten, das war rechnen.
… Wir bekamen auch einmal Besuch von Ohms, Ohm (Diakon) Kornelius Töws und Ohm (
Prediger) Jakob Zacharias aus Waldheim. Herr Töws war aus Laubenheim. Sie waren aber, so schien es wenigstens, ganz überrascht. Die Kinder haben sich auch vorbildlich benommen und gaben immer gute Antworten. Ich bin persönlich aber nie angegriffen worden. Die Leute waren alle zuvorkommend und freundlich zu mir. Die Schwierigkeiten haben ja die Eltern durchgestanden und sie haben mich da ganz rausgehalten."
Frau Martens wurde dann von der Gruppe weiter angestellt und hat während einiger Jahre (1948 – 52) die Kinder dieser Elterngruppe in einem Privathaus unterrichtet. Sie hat während dieser Zeit bei Abram N. Bergens gewohnt und auch eine zeitlang den Unterricht im Hause von Bergens geführt. Nach Informationen von einer ehemaligen Schülerin von damals nahmen folgende Familien daran teil: Abram N. Bergen, Isaak Funk, Hein J. Töws, Abram (Eb) Bergen und Diedrich D. Neufeld, vielleicht auch noch andere.
Diese Schule wurde damals von einigen als `gottlos’ bezeichnet, und der Gemeindevorstand soll auch versucht haben, sie zu schließen (aufzuheben), ebenfalls nach Informationen ihrer damaligen Schüler. Diese Bürger aber sind nicht darauf eingegangen.
Maria Rempel war die erste Lehrerin in
Menno, die 1963 offiziell vom Schulverein in der Vereinsschule angestellt wurde. Sie hat hier nur ein Jahr gearbeitet, und ab 1964 war es Erna Redekopp, die hier mehrere Jahre unterrichtet hat.
In der Grundschule auf Kolonieebene wurde als erste Lehrerin 1966 Tina Reimer (Tocher des damaligen Oberschulzen J. B. Reimer) in
Loma Plata angestellt. Sie hatte die Básico-Klassen in
Loma Plata und
Filadelfia beendigt und anschließend die Pädagogischen Klassen in
Filadelfia absolviert und war somit die erste ausgebildete weibliche Lehrkraft aus
Menno in einer Grundschule der
Kolonie. Ihre Schwester Maria hatte mit ihr zugleich die Pädagogischen Klassen abgeschlossen, hat hier aber nicht als Lehrerin gearbeitet. Sie wanderte zum Weiterstudium aus nach Kanada und ist dort geblieben.
Singstunden:
Bald nach dem Beginn der Vereinsschule wurden in einigen Dörfern auch Singstunden (besonders mit Jugendlichen) an den Abenden eingeführt, und zwar auf dieselbe Art und Weise, wie es mit den Verbesserungen in den Dorfsschulen gemacht wurde: Wo es in den Dörfern möglich war und ein Gesangleiter (Dirigent) zur Verfügung stand, wurde mit den Singstunden begonnen. Meistens wurden Evangeliumslieder ausgesucht, die in der Dorfsschule oder auch in Privathäusern nach Ziffern und Text vierstimmig an die Wandtafel geschrieben und dann geübt wurden. Etwas später wurden die Lieder von Martin W. Friesen auf Matrizen geschrieben, vervielfältigt und in Mappen an die Sänger verteilt. Nachher wurden sie nach Themen geordnet und als dickere Hefte vervielfältigt. Auch haben wir solche Liederbücher (Harfenklang), vierstimmig in Ziffern geschrieben, von
Fernheim bezogen. Diese Mappen und Bücher wurden auch vom Schulchor benutzt. Einige Leute hatten noch Notenkenntnisse von Kanada mitgebracht, und das Umschreiben von Noten nach Ziffern wurde von einem zum anderen weitergegeben.
Solche Singübstunden gab es in Ebenfeld, geleitet von Martin W. Friesen, in Osterwick, geleitet von Hein K. Braun, in
Reinfeld, geleitet von Hermann W. Töws, Neuanlage, Peter B. Funk, u.a.m. In Süd-
Menno gab es diese Singübstunden auch schon in den fünfziger Jahren. Leiter waren: Johann M. Funk, Wilhelm F. Sawatzky, Bernhard M. Funk, wohl in Rudnerweide und Schönau. Später gab es dann immer mehr von diesen Singübstunden mit Laiendirigenten.
Um den richtigen Ton anzugeben, wurde die Stimmgabel benutzt. Etwa um dieselbe Zeit wurde auch der Gebrauch der Stimmgabel in den Volksschulen eingeführt, immer auch nur bei den fortschrittlich gesinnten Lehrern, wo man sich damit verstand und es wollte. Eine große und sehr praktische Neuerung durch ein kleines Instrument. Bald wurde die Stimmgabel auch in den
Kirchen von den `Vorsängern’ (Gesangleitern) benutzt und so konnten diese das Lied nach der richtigen Tonart anstimmen, was vorher manchmal nicht der Fall war. Neben den importierten gab es auch bald hier in Schmieden nachgemachte Stimmgabeln zu kaufen.
Wenn eine Jugendgruppe eine Anzahl von Liedern geübt hatte, wurde manchmal ein Gesangprogramm gebracht, wozu dann Interessenten aus der Umgebung eingeladen waren. Aber nicht in der Kirche, sondern auf einem Privathof, wo sonst niemand außer dem Eigentümer des Hauses etwas zu sagen hatte.
Passende Gelegenheiten zu solchen Programmen gab es an
Weihnachten, Ostern oder Pfingsten oder auch auf Hochzeiten, wo die Eltern `dafür’ waren. Offiziell in den
Kirchen wurden solche Programme noch nicht zugelassen.
Zu erwähnen ist hierbei noch, dass es vorher schon einige Gesanggruppen in Privathäusern gegeben hat, wo durch Anleitung des Hausherrn Lieder mehrstimmig geübt und gesungen wurden: Bei Peter B. Fehr Schönwiese (wohl die erste Stelle von diesen, schon Ende der dreißiger / Anfang vierziger Jahre, wie man mir erzählt hat, unter Leitung von Peter B. Funk und Bernhard R. Penner. Br. Hein Fehr aus dieser Gruppe, der die besten Voraussetzungen für die Leitung dieser Singstunden in Waldheim hatte, durfte dieses Amt nicht annehmen, da er Lehrer und Vorsänger war und in solchem Falle von diesen Ämtern suspendiert worden wäre). Außerdem gab es Singstunden bei Abram R. Funk Ebenfeld und bei Peter T. Sawatzky Reinland, soviel mir bekannt ist. Interessierte Sänger kamen hier zusammen und übten mit den betreffenden Familien Lieder vierstimmig nach Ziffern ein.
Anfang der sechziger Jahre wurde der Chorgesang schon, wenn auch etwas zögernd, in den
Kirchen zum Gottesdienst zugelassen. Beim Bau der ersten großen Kirche in
Loma Plata wurden vorne schon Stufen eingeplant. Da wurden einige Gemeindeglieder misstrauisch und schöpften Verdacht, dass diese sicherlich für den Chor gedacht wären. Damit hatten sie wohl auch recht; aber man tröstete sie damit, dass es ähnliche Anhöhen auch schon in unseren alten
Kirchen für die
Prediger und die Vorsänger gegeben habe, wenn auch nicht mit so vielen Stufen. Aber diese Kirche war ja auch viel größer, und die Stufen bräuchten wir sowieso für
Prediger und Vorsänger, war die Begründung dafür. Und diese Kirche wurde gebaut, wenn auch zum Teil unter Opposition. Einige Gemeindeglieder hatten sich gar `geschworen’, bei dieser nie über die Schwelle zu treten.
Zur Einweihung dieser Kirche 1962 wurde vom
Lehrdienst beschlossen, dass der Chor aus der Umgebung auftreten und einige Lieder singen würde. Nicht vorne auf den Stufen, denn diese waren ja eigentlich nicht für den Chor gedacht, sondern hinten auf der Empore sollte der Chor sich aufstellen. Eingeübt hatte jemand die Lieder, der nicht
Prediger war. Zu diesem Auftritt wurde aber ein
Prediger bestimmt, der auch Kenntnis von Chorführung hatte. Es war Missionar und
Prediger Johann M. Funk. Der Chor sang schöne Lieder zu dieser Einweihung und somit war das Eis gebrochen. Der Chor hat seither immer in dieser Kirche gesungen, wenn auch noch eine Zeitlang von der Empore aus, von wo der Chor übrigens auch eine gute Akustik hatte.
Der Osterwicker Chor hat schon im April 1962 unter der Anleitung von Heinrich K. Braun bei der Andacht (Gottesdienst) in der Kirche zu Osterwick mit Erlaubnis des Lehrdienstes gesungen, wie Hein Braun mir mitgeteilt hat. Der Dirigent sollte aber nicht vorne stehen und den Takt angeben, dirigieren, sondern aus der Mitte der Sängergruppe tonangebend wirken. In der Schule zu Ebenfeld hat der Chor, geleitet von M. W. Friesen, schon Ende der fünfziger Jahre am Sonntag in den Gottesdiensten gesungen (nach Aussagen von J. T. Friesen).
Sängerfeste:
Bald weiteten diese Singstunden sich aus zu Sängerfesten. Die ersten Sängerfeste wurden in Osterwick in der Kirche im August 1960 und in
Loma Plata im August 1961 auf dem Vereinsschulhof (teilweise auch in den Klassenräumen) durchgeführt. Es kamen viele Zuhörer zu diesen Sängerfesten, auch wenn solche Veranstaltungen noch nicht offiziell von der
Gemeinde akzeptiert waren. Die große Hörerschaft aber übte einen enormen Einfluss auf die ganze Gemeinschaft aus.
Leitende Dirigenten waren dabei Lehrer Bruno Epp (von auswärts) und Lehrer Jacob Redekopp, seit 1960 in
Loma Plata als Lehrer angestellt (auch ehemaliger Flüchtling).
Weiter wirkten hierbei lokale „Dirigenten" mit, wie: Martin W. Friesen, Hein K. Braun, Jacob W. Hiebert, Johann F. Hiebert, Andreas F. Sawatzky, Peter B. Funk, Bernhard M. Funk, Wilhelm Sawatzky, H. Töws.
Lehrer Bruno Epp führte vor beiden Sängerfesten einen Dirigentenkursus durch. Diese beiden Sängerfeste (wie auch später folgende) wurden mit einem vorangehenden Dirigentenkursus verbunden, um lokale Dirigenten heranzubilden.
Schlussbemerkungen:
In dieser Zeit gab es noch viele Erneuerungen mehr in der
Gemeinde von
Menno: Die Bruderschaften wurden zu Gemeindestunden umfunktioniert, woran seitdem auch die Frauen teilnehmen. Bei Wahlen in der
Gemeinde hielten sie sich anfänglich noch zurück; heute aber bestimmen sie überall in den Gemeinden mit. Das Vorsängersystem in der Kirche wurde nach und nach durch Gesangleiter ersetzt und in den Versammlungen wurde mehrstimmig gesungen. Das alte Gesangbuch ohne Ziffern und Noten wurde etwa 1966 durch das
Gesangbuch der Mennoniten, 1965 in Kanada herausgegeben, ersetzt. Musikinstrumente wie Pianos und andere wurden in die Kirche gebracht;
Prediger fingen an mit Krawatte hinter die Kanzel zu gehen (mit dem Ablegen des `Predigerrocks’ hatte man schon in den vierziger Jahren angefangen und das war schon kein Thema mehr).
Jugendarbeiter hatten schon in den fünfziger Jahren ehrenamtlich begonnen; heute haben wir schon angestellte Jugendarbeiter, theologisch gebildete
Prediger, bezahlte Gemeindeleiter und bezahlte
Musik– und Gesangförderer. Die Hochzeiten werden ganz anders gestaltet als früher, z.B. heute weiße Brautkleider und Schleier (anstatt blauer oder gar schwarzer) und Trauringe, die es früher nicht gab usw.
In kultureller Hinsicht wären Vorführungen (Theater), Sportveranstaltungen, Volksmusik, Volkstänze u.a.m. zu nennen.
Die Sonntagsschule nahm in dieser Zeit an den Sonntagnachmittagen in einigen Dörfern (oftmals mit Jugendlichen) ihren Anfang. Die ganze Mennogemeinschaft hat in ein paar Jahrzehnten so eine Wandlung durchgemacht wie wohl kaum eine andere auf der ganzen Welt. Vieles hat auch mit den Veränderungen weltweit zu tun; aber die Wandlungen auf schulischem, religiösem und kulturellem Gebiet gingen in
Menno wohl hauptsächlich von der Schule aus.
Benutztes Material: –
Friesen, Martin W.:
Kanadische Mennoniten bezwingen eine Wildnis,
Asunción, 1977
–
Im Dienste der Gemeinschaft, August 1991;
– Protokolle von Predigersitzungen (Punkte über Schulwesen, zusammengefasst von H. Ratzlaff) und Schulratsitzungen;
– Befragung verschiedener Personen und eigene Erinnerungen.
Themen zur Gruppenarbeit auf dem Symposium:- In wieweit beeinflussen traditionelle Elemente unser heutiges Gemeinschaftsleben, z.B. auch die gegenwärtige Schulentwicklung?
- Menno kommt aus einer sehr traditionell gebundenen Gemeinschaft. Nun ähnelt sich kaum noch etwas mit dem vor 60 – 70 Jahren. Schlägt das Pendel heute auch auf dem schulischen Gebiet zu weit nach der anderen Seite aus?
- In den letzten 50 Jahren haben sich unsere Schulen wie auch die ganze Gemeinschaft sehr stark gewandelt. Wie kann die Schule den richtigen Beitrag in diesem Wandel einbringen?
- Welchen Einfluss hat die Schule heute auf den internen Wandel/Fortschritt in der Kolonie?
- Zur Diskussion: „Was die Schule heute ist, wird später die Gemeinde/Gesellschaft (Die Gesellschaft ist das Spiegelbild der Schule)." In wieweit stimmt diese Behauptung heute noch?
- Wie wird unsere Schule von außen geprägt? Können wir damit in Zukunft zurechtkommen?
- Welche Lücken hat das heutige Bildungswesen in Bezug auf Gemeinde und Wirtschaft?
- Welche Lücken konnten vom alten Bildungswesen und der ersten Zeit des Wandels nicht abgedeckt werden? Welche Lösungen schlagen wir vor?
- Wie kann sich die Wirtschaft mehr im Bildungswesen einbringen?
- Wie kann sich die Gemeinde mehr im Bildungswesen einbringen?
- Inwieweit sollten sich die Mennoniten in der Tertiärausbildung der Region und des Landes direkt einbringen? (Was wird schon getan und welche Möglichkeiten stehen noch offen?)
- Welche Vorschulerziehung sollte angestrebt und gefördert werden?
(Diese Diskussionsthemen wurden zusammen von Lehrer Uwe Friesen,
Schulrat Lic. Adolf Sawtzky und Lic. Andreas F. Sawatzky ausgearbeitet).
Fussnoten:
| |
| Friesen M. W., Kanadische Mennoniten bezwingen eine Wildnis, S. 118. |
| Bei ‘Verweltlichung’ spielte der Gedanke `Hochmut’ immer mit. Es ist nicht mehr gut, was wir bis jetzt gehabt haben, wir wollen höher hinaus wie die Weltgelehrten, hochmütig sein! |
Das Verhältnis der Bewohner der Kolonien Menno und Fernheim zueinander
Peter P. Klassen
Dass andre klüger sind als wir,
das
macht uns selten nur Pläsier,
doch dass der andre dümmer,
erfreut fast immer.
Wilhelm Busch
Die „Kanadier" und die „Russen"(2)
Es gibt keinen größeren Spaß als den, sich über den anderen lustig zu machen. Man hat die Lacher auf seiner Seite, und man selbst hat sein Wertgefühl auf Kosten der andern gesteigert. Warum sollte es im mittleren
Chaco anders sein?
Kanadier wurden die aus Kanada,
Russen die aus Russland in den
Chaco eingewanderten Mennoniten genannt. Es hat im Verhältnis zwischen den Kanadiern und den Russen viel Spaß gegeben, und man hat viel übereinander gelacht, zum Teil noch bis heute. Der bekannteste Witz der Russen über die Kanadier sei vornean gestellt; denn er ist sogar in Abhandlungen gern zitiert worden.
(3)
„Wenn die Kanadier einen Witz hören, dann lachen sie erst am nächsten Tag." Damit sollte zum Ausdruck gebracht werden, dass diese ein wenig begriffsstutzig seien, jedenfalls begrifstutziger als die Russen. (Dazu eine persönliche Bemerkung: Mir kam dieser Witz einmal sehr zustatten. Ich sollte im „Instituto Superior de Educación" in
Asunción als Beitrag für eine Veranstaltung einen Witz über die Mennoniten erzählen. Mein Spanisch war nicht sehr gut. Zum Glück hatte ich vorher gesagt, dass Mennoniten bei einem Witz erst am nächsten Tag lachen. Niemand hatte meinen Witz verstanden. Alle meinten dann nachher wohlwollend und nachsichtig, sie würden erst morgen lachen).
Diese Einwanderer aus Kanada und Russland begegneten sich zum ersten Mal tief im Innern des
Chaco auf der Bahnstation
Km 145, die zugleich Endstation der
Schmalspurbahn vom Hafen Casado war. Die Russländer hatten die Flucht aus der Sowjetunion hinter sich, und das Mennonitische Zentralkomitee (
MCC) hatte sie in den
Chaco von
Paraguay gebracht, weil es außer der Alternative Brasilien keine andere Möglichkeit gegeben hatte. Fuhrleute aus der
Kolonie Menno waren durch Vermittlung der
Corporación Paraguaya, die das Unternehmen für die Russländer im Auftrag des
MCC zu organisieren hatte, mit ihren
Ochsenwagen zur Bahnstation gekommen, um die Einwanderer abzuholen und auf das für sie bestimmte Siedlungsland westlich ihrer
Kolonie zu bringen.
Walter Quiring beschrieb diese erste Begegnung bald darauf:
„Gegen Abend erreicht die Russländergruppe Km 145; der Zug hält vor einem kleinen Balkenschuppen, dem `Bahnhof’. Nicht weit von ihm entfernt halten Fuhrwerke, deren fremdartige Wagenkasten auffallen. Neben den Wagen stehen in Gruppen die Fuhrleute, die Kanadadeutschen aus Menno. Aber wie sehen die aus in ihren zerrissenen und von der weiten Ochsenfahrt mitgenommenen Kleidern! Die meisten gehen barfuß oder in Holzpantoffeln, tragen breiträndige Strohhüte und dunkle Schutzbrillen wegen kranker Augen."
(4)Schon dieses äußere Erscheinungsbild mag für eine erste Beurteilung der Kanadier durch die Russen maßgebend gewesen sein. „So werden auch wir bald aussehen", sagte einer der Ankömmlinge deprimiert.
(5) Der Eindruck, den diese Russen auf die Kanadier machten, war sicher nicht weniger gravierend. Ihre Kleidung und ihr Verhalten waren von Europa her geprägt, also mehr oder weniger modern, und bei den Kanadiern war die fortschreitende Modernisierung in Kanada mit ein Grund für die Auswanderung gewesen.
Ein junger Fuhrmann weigerte sich, eine ihm zugewiesene
Familie auf seinen Wagen zu nehmen. „Warum denn?", fragte man ihn. „Vater hat gesagt, ich solle keinen Schnurrbartmenschen mitbringen", war die Antwort. Er ließ sich dann aber doch überreden.
(6)
Durch diese schnell festgestellten Unterschiede machte sich bei den Russen sofort ein gewisses Überlegenheitsgefühl breit, bei den Kanadiern ein ablehnendes Misstrauen, und diese ersten Eindrücke voneinander nahmen die Russen mit in ihre neue Siedlung und die Kanadier in ihre Dörfer.
Vom äußeren Erscheinungsbild blieb sitzen, dass die Russen meist Schildmützen oder Filzhüte, die Kanadier ihre von den Strapazen der Fahrt stark mitgenommenen Strohhüte trugen. Dort schon mögen sich dann die gegenseitigen Spottbezeichnungen „Schildmützen" für die Russen und „Strohhüte" für die Kanadier festgesetzt haben.
Den schönsten Anlass zum Spott aber gab, jedenfalls bei den Russen, zunächst einmal die Sprache. Wer anders spricht als die Mehrheit, gibt immer Grund zum Lachen. Hier war es mehr die distanzierte Nachbarschaft, die Anlass dazu gab. Das Molotschnaer Platt galt in Russland als feiner, und es setzte sich überall in den Tochterkolonien schnell durch, wie Walter (damals Jakob) Quiring nachgewiesen hat.
(7) Die meisten der angekommenen Russen sprachen diese Variation des niederpreußischen
Plattdeutsch.
Die Kanadier dagegen sprachen das sog. Altkolonier Platt, wie es in Russland in der
Kolonie Chortitza gesprochen wurde, noch unverfälscht. Von dort waren sie einmal hergekommen, und sie hatten es mit auf ihren langen Wanderweg genommen und beibehalten. Die andere Aussprache der Vokale, das Endungs-N bei den Verben, dazu eine vielleicht vom Englischen in Kanada herrührende etwas schnarrende Sprachmelodie waren genug Grund bei den Russen zum Nachahmen und zum Lachen.
(8) (Umgekehrt mag das durchaus auch der Fall gewesen sein).
Hinzu kam, dass die Kanadier das Hochdeutsch anders sprachen als die Russen. In der Predigt und auch in der Schule wurde z. B. das A wie Au ausgesprochen, eine Sprachform, wie sie in Westpreußen zur Zeit der Auswanderung der Mennoniten Ende des 18. Jahrhunderts allgemein durchaus üblich war.
Mein Vater, ein Lehrer, kam von einem Besuch in der
Kolonie Menno nach Hause. Er hatte dort in einem Haus, wo er zu Gast war, ein kleines Mädchen auf seine Schulkenntnisse geprüft. „Wie viel ist fünf und fünf?" – „Ssehn." – „Wie viel ist zehn und zehn?" – „Zwaunzig." Für uns Kinder war das ein Heidenspaß, und er wurde immer wieder erzählt.
Mein Bruder Jakob machte im Laden in Orloff, den er führte, gern Spaß mit Mumtje Ennsche von Straussberg. „Worom sinj ji ,Schautz, ach Schautz, warum so traurig’?", fragte er sie. „Daut heet doch Schatz, ach Schatz." – Mumtje Ennsche konterte: „Schatz, ach Schatz, warum so trarig – daut heat sich je uck no nuscht?"
Ein beliebtes Spottlied, in
Fernheim gern nachahmend gesungen, war: „Saußen einst sswei Turteltauben auf nem dirren, dirren Aust, wo sich sswei Verliebte scheiden, da verweltjet Laub und Graus."
Solche Späße und viele andere machten schnell die Runde, und sie gaben Anlass für das notwendige Überlegenheitsgefühl bei den Russen. Auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich ähnliche und ebenso verbreitete Späße gegeben haben.
Nur einen: Die Kanadier machten Scharwerksarbeit an einem Weg, wo sie wussten, dass Russen vorbeikommen würden. Alle jungen Männer hatten sich eine Krawatte umgebunden, um damit die Kleidung der Russen, die man für üppig hielt, zu verspotten. Das dunkle Kafirbrot nannten sie „Schlipsbrot". Die Russen seien so arm, dass sie sich Weizenbrot nicht leisten könnten, doch einen feinen Schlips müssten sie tragen.
Die historischen Hintergründe
„Volksdeutsches Wiedersehen" nennt Walter Quiring diese für beide Teile unvorhergesehene und unerwartete Begegnung in einer unbekannten Wildnis nach der Terminologie der dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts.
(9) „Wiedersehen mennonitischer Glaubensbrüder" würde man heute vielleicht lieber formulieren.
Fast genau hundert Jahre waren verflossen, seit sich diese beiden mennonitischen Gruppen, die sich nun, 1930, auf der Bahnstation im
Chaco zum ersten Mal begegneten, voneinander getrennt hatten. Um 1833 siedelte eine Gruppe von Bauern aus der ersten Mennonitenkolonie Chortitza am Dnjepr 200 km weiter im Osten in der Gegend von Mariupol an und gründete dort die erste sog. Tochterkolonie
Bergthal. Zusammen hatten diese Mennoniten 1789, als sie aus dem Weichsel-Nogat-Gebiet und Danzig in Russland einwanderten, die
Kolonie Chortitza gegründet.
(10)
Martin W. Friesen hat in seinem Buch „Neue Heimat in der
Chaco Wildnis" (1987) eingehend die Hintergründe und Ursachen untersucht, die zu den doch sehr markanten Unterschieden zwischen diesen beiden Gruppen, die sich nun im
Chaco begegneten, geführt haben. Sie waren damals bei der Einwanderung in Russland sicher eine homogene Gruppe, und sie müssen in ihrem Denken und Handeln wohl ziemlich gleich gewesen sein. Nach Friesen spielten für die damalige Übersiedlung keine gesinnungsmäßigen Gründe eine Rolle, wie das bei späteren Neugründungen von
Mennonitenkolonien in Russland und auch anderswo manchmal der Fall war. Die Umsiedler wurden damals im Wesentlichen von der durch den Bevölkerungsüberschuss verursachten wirtschaftlichen Not getrieben.
Um den in dann nur gerade vierzig Jahren in Russland entstandenen Gegensatz zwischen den Bergthalern und den anderen als fortschrittlich bezeichneten Kolonien besser herauszustellen, soll hier eine kurze Darstellung eben dieses Fortschritts zur Erklärung dienen. Die nach 1804 gegründete
Kolonie an der Molotschna galt von Anfang an im Gegensatz zur Alten
Kolonie (Chortitza) als geistig reger und kulturell fortschrittlicher. Hier setzte sich schon seit 1820 durch rege Beziehungen zum Mutterland Preußen eine gründliche
Schulreform durch, die in der Gründung einer Fortbildungsschule,
Zentralschule genannt, ihren Ausdruck fand. Es wurden ausgebildete Lehrer aus Preußen gerufen, wie Tobias Voth und Heinrich Heese. Allerdings geschah diese Reform auch in Molotschna gegen starken Widerstand von Seiten der Kirchengemeinde, wie Franz Isaac eingehend beschreibt,
(11) doch die Fortschrittlichen setzten sich hier durch.
Um 1840 fand diese Reformbewegung unter dem starken Einfluss von Johann Cornies auch in der
Kolonie Chortitza Eingang, wo auch eine
Zentralschule und später ein
Lehrerseminar gegründet wurden.
Der kulturelle Stand in diesen
Mennonitenkolonien Russlands hatte dann eine stetige Aufwärtsentwicklung zu verzeichnen, die durch Studien junger Leute an den Universitäten im In- und Ausland und durch die Gründung von weiteren Fortbildungsschulen für Jungen und Mädchen und Lehrerbildungsanstalten stark gefördert wurde.
(12) Man kann von einer geistigen und geistlichen Blütezeit sprechen, die um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und dann bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges ihren Höhepunkt fand.
Diese kulturelle Entwicklung haben die
Bergthaler nicht mitgemacht, und sie wehrten sich sehr bewusst dagegen. Ein wesentlicher Faktor für die dann sehr eigenwillige Entwicklung dieser Gruppe war sicher die räumliche Trennung; denn 200 km spielten in jener Zeit für den Verkehr mit Pferdewagen auf schlechten Wegen eine große Rolle. So meint auch Friesen, dass „die räumliche Abgeschlossenheit viel zu diesem – von außen gesehen – trotzigen Eigensinn und dieser Abwehrhaltung" beigetragen habe.
(13)
Diese konservative Haltung und der konsequente Widerstand gegen den geistigen Fortschritt bei den Bergthalern ist aber sicher nicht nur durch die geographische Abgelegenheit zu erklären. Martin W. Friesen setzt sich eingehend auch mit dieser Frage auseinander.
(14) Dafür hat er einen sehr zuverlässigen Kronzeugen, den Ältesten Gerhard Wiebe. Wiebe hat in seinem 1900 erschienen Buch „Ursachen und Geschichte der Auswanderung der Mennoniten von Russland nach Amerika" eine ungeschützte Darstellung seiner Lebenshaltung und der seiner
Gemeinde geliefert. Ein ähnliches ebenso wertvolles Dokument hat der Älteste Isaak M. Dyck 1970 über „Die Auswanderung der
Reinländer Mennonitengemeinde von Canada nach Mexiko"
(15) verfasst. Die etwa zeitgleichen Ströme der beiden
Wanderungen von Kanada nach
Paraguay und nach Mexiko haben in der Auswanderung von 1874 aus Russland den gleichen Hintergrund. Beide Bücher sind als Vermächtnis für die nachfolgenden Generationen gedacht, und sie sollten die Richtung für die Fortführung der
Tradition in
Gemeinde und Siedlung weisen.
Dabei wird deutlich, unter welch starkem Einfluss der jeweiligen Ältesten die Gemeinden standen. Mit einer uneingeschränkten Autorität, verbunden mit strengen Gemeinderegeln legten sie die Denkrichtung ihrer Gemeinden fest. Durch Gemeindezucht, oft in Ausübung des strengen Bannes, hielten sie ihre Gruppen fest im Griff, alles untermauert mit ihrer eigenwilligen Schriftauslegung. Es ist erstaunlich, wie sich Glaubenshaltung und Lebensführung in diesen mennonitischen Gruppen von Generation zu Generation erhalten ließ. Am Beispiel der Mennoniten in Mexiko und deren Ableger in Bolivien (Santa Cruz) und
Paraguay (
Rio Verde und
Nueva Durango) lässt sich das auch heute noch am deutlichsten nachweisen.
Meist wird die Auswanderung der
Bergthaler um 1874 aus Russland nach Kanada – sie zogen auch andere konservative Gruppen aus der Alten
Kolonie und dem Fürstenland nach sich
(16) – mit der Einführung der Allgemeinen Wehrpflicht begründet. Bei Wiebe wird aber auch deutlich, dass ihn noch viel mehr Sorgen und Befürchtungen quälten als nur der drohende Militärdienst.
Erstens war um 1860 die Brüdergemeinde in Molotschna und Chortitza entstanden, und deren missionarischen Eifer verspürte man auch in
Bergthal. Wiebe schreibt von dem „falschen Gottesdienst" und den „falschen Predigern", die er „Wölfe in Schafspelzen" nennt, und er fühlt sich und seine
Gemeinde von dem „Unkrautsamen des bösen Feindes", der von ihnen ausgestreut wird, bedroht.
(17) Auf keinen Fall sollte diese neue geistliche Strömung in seiner
Gemeinde Eingang finden.
Eine ebenso starke Bedrohung sah er in dem schulischen Fortschritt, der in den
Mennonitenkolonien auch von der russischen Regierung stark gefördert wurde. Bei Wiebe kommt die Angst vor diesen als Bedrohung empfundenen Reformversuchen am deutlichsten in der bekannten „Spinnengeschichte" zum Ausdruck.
(18) (Ein Baron von Korff stellt in einer
Bergthaler Schule neue Schulbücher vor. Der
Schulze scheint schon schwach zu werden, bis ihm der Älteste Wiebe im Gespräch eine Spinne in der Ecke der Stube zeigt, die eine Fliege langsam einspinnt. So würden auch ihre Schulen vom Weltgeist eingesponnen werden, warnt Wiebe. Der
Schulze sieht das ein, und die Schulbücher werden abgelehnt).
Über jene alte Schulform, die der Älteste Wiebe verteidigte und die dann mit nach Kanada wanderte, brauchen hier keine weiteren Ausführungen gemacht zu werden. In vielen geschichtlichen Abhandlungen wird sie ausführlich beschrieben, so auch in dem hier oft zitierten Werk von Martin W. Friesen.
(19) Diese Schulform wurde dann einer der Hauptgründe für die Auswanderung der ehemaligen
Bergthaler aus Kanada nach
Paraguay, und sie prägte dann auch zu einem guten Teil das Verhalten der Kanadier hier. Bei den Russen gab sie viel Anlass für das gern zur Schau gestellte Überlegenheitsgefühl, denn sie hatten die fortschrittliche Schulform aus Russland mitgebracht. Immerhin war die konservative Schulform bis in die fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts in der
Kolonie Menno maßgebend.
Diese kulturellen und geistlichen Gegensätze waren es, die das Verhältnis zwischen den Kanadiern und den Russen im
Chaco über viele Jahre mit bestimmten.
Verwunderung und Mahnung
„Man sollte erwarten, wenn in einem derart isolierten Siedlungsgebiet, wie es der mittlere Teil des paraguayischen Chaco ist, zwei Kolonistengruppen wie die von Menno und Fernheim, die beide zu derselben religiösen Gemeinschaft gehören und zum großen Teil eine gemeinschaftliche Vorgeschichte haben, sich kurz nacheinander ansiedeln, ein intensiver Kontakt zwischen den beiden Gruppen entstehen würde. Nichts ist jedoch weniger wahr."
So schrieb Hendrik Hack 1961,
(20) und diese Verwunderung ist besonders von Außenstehenden immer wieder zum Ausdruck gebracht worden.
Verwunderung und Mahnung gab es von Anfang an, wobei die Mahnung meist stärker an die
Kolonie Fernheim, der man als der fortschrittlicheren mehr Verantwortung zuweisen wollte, gerichtet war. So mahnte Professor Benjamin H. Unruh in Deutschland, Wegweiser und Berater bei der Ausreise der Fernheimer nach
Paraguay und bei der Gründung ihrer
Kolonie, 1934 den Oberschulzen von
Fernheim Jakob Siemens: „Wichtig ist auch das Zusammengehen mit der
Kolonie Menno. Ich bitte sehr, dieses Zusammengehen auf allen Gebieten anzustreben. Es muss allseitig sehr taktvoll vorgegangen werden. Sie haben diesen Takt, lieber
Oberschulze. … Gott der Herr wird Ihre Bemühungen segnen."
(21)
Drei Jahre später schrieb der gleiche Absender an den gleichen Adressaten: „Geben Sie die
Kolonie Menno niemals auf. Das Mennonitentum leidet an Zersplitterung und Sektiererei. Wir müssen sie überwinden um der Vernunft und des Evangeliums willen. Die Sache liegt mir so sehr am Herzen und vielen Brüdern mit mir … Hören Sie nicht auf die Orthodoxen in allen Lagern. … Schon Ihre Kinder werden es Ihnen danken. Wir müssen
Menno gewinnen."
(22)
Doch der
Fernheim Oberschulze hatte wenig Hoffnung. „Für die Kanadier sind wir gefährliche Nachbarn", antwortete er Unruh. Man habe der
Kolonie Menno deutsche Lesebücher zum Kauf angeboten, mit dem Vermerk, dass „es wirklich gute Bücher" seien.
(23) Doch der Älteste habe sie mit der Begründung zurückgeschickt, sie könnten diese Bücher nicht einführen, solange die
Gemeinde Gottes Wort vollständig anerkenne. „Wer denen von uns aus in ihren
Kirchen kommen wollte", schrieb Siemens, „der . . .na, das ist nicht meine Sache. Ich arbeite hauptsächlich auf bürgerlichem Gebiet, und da kommen wir schon aus. … Wir wollen einen langen Weg gemeinsam durch den Busch schlagen."
(24)
Friedrich Kliewer, der 1934 zum Studium nach Deutschland gefahren war und das Verhältnis zwischen den beiden Kolonien gut kannte, mahnte den Fernheimer Oberschulzen, doch wenigstens wirtschaftlich mit
Menno zusammen zu arbeiten:
„Das ist bis jetzt noch zu wenig geschehen … Von einer Zusammenarbeit auf kulturellem und geistlichem Gebiet sind wir ja noch weit entfernt, und man sollte einstweilen auch jegliche Versuche auf dieser Seite unterlassen … Doch den Schritt zur wirtschaftlichen Annäherung müssten wir tun. Dabei wird nicht zu vermeiden sein, dass wir einiges gutmachen, was unsere Vordermänner in den ersten Jahren der Ansiedlung ihnen gegenüber verfehlt, und was sie bis heute nicht vergessen haben. Wir müssten von unserer Seite, wenn es drauf an kommt, auch zu Zugeständnissen bereit sein. … Wenn es uns gelingt, ein wirtschaftliches Zusammengehen mit den Kanadiern herbeizuführen, dann wird die kulturelle und geistliche Annäherung von selbst kommen."
(25)Auch Auswärtige beobachteten scharf und urteilten scharf, so etwa der Forscher Professor Herbert Wilhelmy aus Deutschland: „Mit den Kanadadeutschen in
Menno haben die Russlanddeutschen in
Fernheim nicht mehr gemein als den Glauben. Nachbarschaftliche, freundschaftliche oder selbst kirchliche Beziehungen sind zwischen den beiden Kolonien nicht angebahnt worden."
(26)
Der Gutachter F. K. Schmitz-Winnenthal wird dann sarkastisch. Die Oberschulzen der fünf
Mennonitenkolonien Fernheim,
Friesland,
Menno,
Neuland und
Volendam hatten sich notgedrungen, als 1970 ein Schlachthofprojekt vom Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ), Deutschland, aus finanziert werden sollte, fester zusammengeschlossen. Dem Gutachter, den das Ministerium zur Untersuchung des Projektes nach
Paraguay entsandt hatte, war das längst nicht genug, und er kritisierte die mangelhafte Bereitschaft der Kolonien zur Zusammenarbeit. „Die Autonomiebestrebungen der einzelnen Kolonien widerstreben jeder Wirtschaftlichkeit", schrieb er in seinem Gutachten. Er weist auf einen Antrag Mennos auf Finanzierung einer Erdnussölraffinerie hin, wo doch die Raffinerie in
Filadelfia, nur 25 km entfernt, nicht ausgelastet sei. „Nur die Irrenanstalt wird gemeinsam getragen."
(27)
Rückblickend könnte man wohl feststellen, dass bei der Kritik an der mangelnden Bereitschaft zur geistlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit die kulturelle und geistliche Annäherung dann doch leichter gewesen ist als die wirtschaftliche, wie weiter unten dargestellt werden wird.
Als der deutsche Botschafter Dr. Josef Rusnack die Oberschulzen in seiner Abschiedsrede vor etwa einem Jahr zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit mahnte, meinte der
Oberschulze Gustav Sawatzky von
Menno erklärend, es ginge uns allen wohl noch zu gut. Gemeint war, dass uns erst größere Not zusammentreiben würde.
Ansätze zur Annäherung und Zusammenarbeit
Ansätze, die dann eine allmähliche Annäherung zwischen den beiden Kolonien möglich machten, hat es von Anfang an gegeben. Oft fanden sie unauffällig auf der Ebene persönlicher Freundschaften statt. Bei den schweren Fahrten zur Bahnstation, bei denen die Fernheimer durch die Dörfer Mennos fahren und dort Station machen mussten, ist viel Gastfreundschaft zum Tragen gekommen. Die Fernheimer rühmten die unkomplizierte Art und Weise, mit der die müden Fahrer zu Tisch gebeten wurden. Wasser und Weide für die Ochsen war meist eine Selbstverständlichkeit.
„Was die Russländer bei den Mennoleuten sehr positiv bewerteten, das war die Zuverlässigkeit ihrer Aussage", schreibt Martin W. Friesen. „Wenn sie etwas aussagten, dann verhielt sich das auch so. Den Mennoleuten dagegen fiel die Handelsbeschwingtheit der Russländer auf. Sie sagten dazu auf
Plattdeutsch: ,De Russlända vestohnen to juden.’ (In Anspielung auf die Geschäftstüchtigkeit der Juden).
(28)
In ähnliche Richtung weist auch ein Bericht von Walter Quiring aus dem Jahr 1934, den er 1973 im „Mennonitischen Jahrbuch" veröffentlichte. Zwei Fernheimer kommen nach Osterwick, weil sie kein Mehl mehr haben, damals das Grundnahrungsmittel und knapp, weil es importiert werden musste. Doch auch in Osterwick ist das Mehl knapp. Der eine Fernheimer kann bei einer
Familie 20 kg kaufen, gibt dem andern aber nichts davon ab. Da gibt der Familienvater dem leer ausgegangenen Fernheimer auch sein letztes Mehl ab. „Wir werden ohne dieses Mehl sicher leichter auskommen als sie", sagt der Mann zu seiner
Frau.
(29)
Doch auch auf administrativer Ebene zeigten sich Ansätze der Verständigung. Jakob A. Braun, einer der führenden Männer Mennos, beschwerte sich im Mai 1930 darüber, dass die Spurweite der Wagen, die die Russländer aus Deutschland mitgebracht hatten, enger sei als die der Kanadier. Das hätte man doch bedenken müssen; denn die Wege würden durch Wagen mit verschiedener Spurweite arg zerschnitten, was den Transport erschwere. Als die Fernheimer so weit waren, dass sie eigene Wagen herstellten, beschlossen sie auf einer Sitzung am 3. Februar 1933, die Spurweite der
Kolonie Menno zu akzeptieren.
Auch dann, wenn die Not groß wurde, fand man manchmal zueinander. So unterzeichneten
Vorsteher Jakob Hiebert aus
Menno und
Oberschulze Jakob Siemens aus
Fernheim am 9. August 1938 ein Abkommen, nach dem die beiden Kolonien einen Arzt aus Camacho (heute Mcal. Estigarribia) bezahlen wollten, der dann einmal im Monat in die Kolonien kam.
(30)
Die weitere Entwicklung der Beziehungen und der Annäherung ist nicht mehr gut isoliert nur zwischen den Kolonien
Menno und
Fernheim zu betrachten. Die Ebene hatte sich durch die Zuwanderung der
Flüchtlinge aus der Sowjetunion ab 1947 sehr stark erweitert, und gerade diese Erweiterung war mit ein Anlass dafür, dass sich die Kanadier äußeren Einflüssen gegenüber stärker zu öffnen begannen. Das
MCC war sehr bestrebt, auch die
Kolonie Menno in die Hilfsaktion für die aus Europa in Schüben eintreffenden
Flüchtlinge einzubeziehen, und sie ließ sich einbeziehen.
An den Beratungen, die zur Regelung dieser Einwanderung und besonders zur Unterbringung der
Flüchtlinge in den Kolonien dann im
Mennonitenheim in Asunción stattfanden, nahmen Vertreter der Kolonien
Fernheim,
Friesland und
Menno teil. Unvorhergesehen und vielleicht ungewollt wurde so eine Begegnung auf breiter Ebene herbeigeführt, die deutlich feststellbare Folgen hatte. (Darüber, welchen Einfluss diese Begegnung der Bewohner Mennos mit den Flüchtlingen aus Europa dann hatte, wird sicher im nächsten Vortrag von Dr. Jakob Warkentin ausführlich berichtet werden).
Fast immer waren es dann Anforderungen von außen her, die die immer noch stark eigenbrötelnden Kolonien zu gemeinsamen Aktionen trieben. Im Oktober 1957 hatte das
MCC bei der US-Regierung einen Kredit von 1 Million Dollar für die
Mennonitenkolonien in
Paraguay zur Entwicklungshilfe locker gemacht. Um dieses Geld richtig zu kanalisieren, gründeten die Kolonien ein „Comité Económico Mennonita" (CEM) mit einem ständigen Büro in
Asunción.
Weitere geschäftliche Beziehungen mit dem Ausland führten dann nach 1961 zur Gründung des Oberschulzenrates und zur Erweiterung des CEM zum „Comité Social Económico Mennonita" (
CSEM) und damit zu einem noch stärkeren administrativen Zusammenschluss der Kolonien. Äußerer Anlass war die über die
Deutsche Botschaft in
Asunción in Aussicht gestellte Entwicklungshilfe von der „Evangelischen Zentralstelle" in Deutschland und dann auch Angebote auf Entwicklungshilfe vom „Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit" (BMZ).
(31)
Diese Entwicklungshilfe und die langfristigen
Kredite, für die auch „
Brot für die Welt" gewonnen werden konnte, haben für die Entwicklung der
Mennonitenkolonien in
Paraguay einen wesentlichen Beitrag geliefert. Was vielleicht weniger konstatiert worden ist, war auch eine durch diese Beziehungen bewirkte starke Öffnung äußeren Einflüssen gegenüber, der sich auch die
Kolonie Menno nicht entziehen konnte. Man wollte auch den Erwartungen der Geldgeber entsprechen, und so überwanden auch die Kanadier schnell manche Hemmungen, die sie noch wenige Jahrzehnte zuvor solchem Fortschritt gegenüber gehabt hätten.
Wenn weiter oben für die konservative Haltung der
Bergthaler der Einfluss führender Persönlichkeiten, dort der der Ältesten, verantwortlich gemacht wurde, dann waren auch hier für den relativ schnellen Fortschritt in der
Kolonie Menno wieder Persönlichkeiten, Oberschulzen, Lehrer,
Prediger und Geschäftsleute zuständig.
Dabei muss hier vermerkt werden, dass die von außen her so dringend geforderte wirtschaftliche Zusammenarbeit der Kolonien meist nur so lange funktionierte, wie dieser Druck bestand. Ließ er nach oder verschwand er ganz, versanken die Kolonien mit ihrer wirtschaftlichen Planung meist wieder in den alten separatistischen Zustand.
Anders war es auf der kulturellen und geistlichen Ebene, sprich dem Schulwesen und der Glaubensgemeinde. Hier funktionierte die Zusammenarbeit, verbunden mit fortschrittlichen Maßnahmen, reibungsloser und dauerhaft. Das ist eigentlich um so verwunderlicher, als gerade auf diesen Gebieten einmal die Hauptgründe für die Auswanderung aus Kanada nach
Paraguay zu suchen sind, wobei der Kampf um die alte Schulform dort und sein Scheitern als schwerwiegendster Faktor angesehen werden muss.
(32)
Es waren einsichtsvolle Männer in
Menno, die schon Anfang der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts erkannten, dass die Siedlung im Vergleich mit
Fernheim und
Neuland zu weit ins Hintertreffen geriet, wenn das Schulwesen nicht gründlich reformiert würde. Martin W. Friesen beschreibt diese Entwicklung aus seiner Sicht in der Jubiläumsschrift von 1977 „Kanadische Mennoniten bezwingen eine Wildnis". Friesen nimmt dort aber kaum Bezug auf das Verhältnis zu den anderen Kolonien. Er führt die Reform fast ausschließlich auf die eigene Einsicht und Erkenntnis zurück.
(33) Dem damals erforderlichen Selbstbewusstein einer aufstrebenden Siedlung mag diese Haltung auch durchaus dienlich gewesen sein.
Nicht von der Hand zu weisen ist aber der gegenseitige Einfluss, der bald zu einem sehr guten Einvernehmen führte. 1950 lud der aus Kanada vermittelte Lehrer C. C. Peters, damals Leiter der Fernheimer
Zentralschule, erstmalig zu einer allgemeinen Lehrertagung in
Filadelfia ein, zu der die Lehrervereine aus
Friesland,
Volendam und
Neuland erschienen. Auch
Menno hatte einige Vertreter als Beobachter geschickt. Man könnte wohl feststellen, dass dies der Anfang einer sich immer mehr verstärkenden Fühlungnahme und Zusammenarbeit war.
Schon 1950 kam es zur Gründung des „Allparaguayischen mennonitischen Lehrervereins", der dann 1956 in
Volendam in „Lehrerverband der
Mennoniten in Paraguay" umbenannt wurde. In
Volendam nahmen Lehrer der
Kolonie Menno bereits in größerer Zahl teil, und sie schlossen sich dem Lehrerverband an. Als Markstein für die dann allgemeine und parallele Entwicklung des Schulwesens in den
Mennonitenkolonien kann die Gründung der „Allgemeinen
Schulbehörde" 1970 angesehen werden, die aus der Erkenntnis der Schulverwaltungen erwuchs, einen gemeinsamen Weg für das Schulwesen der
Mennoniten in Paraguay zu suchen. Sie ist dann oft als Beispiel dafür angeführt worden, dass eine Zusammenarbeit bei gutem Willen durchaus möglich ist. Das
Lehrerseminar in
Filadelfia, die
Berufsschule in
Loma Plata, die Hauswirtschaftsschule in
Neuland und die staatliche Anerkennung der Schulen waren gezielt geplante Ergebnisse dieser gemeinsamen Tätigkeit.
(34)
Nicht weniger merkwürdig, doch stetig war die Annäherung der Glaubensgemeinden der
Mennoniten in Paraguay untereinander, wobei der Wandel in der Einstellung der Gemeinden in
Menno am auffälligsten ist. Die meisten Reformen in mennonitischen Gemeinden haben sich bis in die Gegenwart hinein unter schmerzhaften Spannungen und Spaltungen vollzogen. In den Gemeinden der
Kolonie Menno fand der Wandel unauffällig und beinah unmerklich statt.
Vielleicht liegt das zum Teil auch an einer gewissen Gesetzmäßigkeit, die in der
Kirchen– und auch in der Mennonitengeschichte zu beobachten ist. Auf Zeiten großer Gegensätze und Spaltungen folgen wieder Zeiten des Ausgleichs und der Nivellierung. Die Entwicklung des Gemeindelebens in der
Kolonie Menno traf gerade in so eine Zeit der Nivellierung hier in
Paraguay hinein.
Als einschlägiges Beispiel soll hier das Verhältnis der Gemeinden in der
Kolonie Fernheim anführt werden. Die drei Gemeinden hier – MG, MBG und
EMB – gründeten sich bei der Ansiedlung klar und eindeutig nach dem von Russland her bekannten Muster, d.h. in schroffer Abgrenzung voneinander. Obwohl das Konzept der Brüdergemeinde auf Grund ihrer zahlenmäßigen Dominanz stark im Übergewicht war, haben die Jahrzehnte eine sehr deutliche Angleichung der Gemeinden untereinander bewirkt. Die MBG wurde in manchen Stücken toleranter, die MG führte strengere Regeln ein. Heute wären außer einigen Äußerlichkeiten kaum noch Unterschiede zwischen den drei Gemeinden festzustellen.
Doch dieser Nivellierungsprozess hat auch auf die Gemeinden der anderen Kolonien übergegriffen, und es wäre eine Untersuchung wert, wie viele der Glaubenselemente und Praktiken von den Gemeinden Fernheims beispielsweise in den Gemeinden Mennos übernommen worden sind. Die Abschaffung des Katechismusunterrichts als Bedingung für die
Taufe und die Einführung von Evangelisationen, um eine Bekehrung herbeizuführen, wären nur Beispiele.
Ohne hier tiefer auf diesen Prozess einzugehen, kann wohl festgestellt werden, dass sich diese Angleichung im Allgemeinen segensreich und wohltuend auf das gesamte Mennonitentum in
Paraguay ausgewirkt hat. Viel Gemeinsamkeit ist dadurch auch unter Beibehaltung der organisatorischen Grenzen möglich geworden. Durch die Gründung des Gemeindekomitees, das geistliche Pendant zum
Oberschulzenrat, konnten manche gemeinsamen karitativen Einrichtungen, wie die Leprastation und andere geschaffen werden.
(35) Auch die gemeinsamen geistlichen Bildungsanstalten
CEMTA und
IBA, obwohl getrennt von den Konferenzen geführt, haben viel zu dieser Angleichung und zum Ausgleich beigetragen. Dadurch konnte dann auch die Missionstätigkeit, obwohl in getrennten Formationen, ohne größere Rivalitäten untereinander durchgeführt werden.
Die „Mischehen"
Die Heirat war in den mennonitischen Gemeinden, spätestens seit den Jahren des 17. und 18. Jahrhunderts in Westpreußen, ein sehr wirksames Regulativ für die Ordnung in den Gemeinden und für eine sichere
Tradition. In den Gemeinden dort war die Außentrau, d.h. die Heirat mit Andersgläubigen, zeitweilig auch mit Angehörigen anderer mennonitischer Gemeinden (Friesen und Fläminger), strikt verboten. Diese Endogamie hat ohne Frage wesentlich zur Herausbildung eines „mennonitischen Menschenschlages" oder – wenn man so will – des „mennonitischen Volkes" – beigetragen.
(36)
Auch in Russland, in Kanada und dann auch in
Paraguay wachten die Gemeinden mehr oder weniger streng über die Institutionen Heirat und Ehe, weil man darin nicht nur eine Garantie für die Integrität der
Gemeinde, sondern auch für die gesamte mennonitische Gesellschaft sah. Die Verordnungen der
Gemeinde, besonders in
Menno, spielten dann auch für das Verhältnis der Kolonien untereinander, vor allem auch für das zwischen
Menno und
Fernheim, über Jahre eine bedeutende Rolle.
Unübertroffen für eine Darstellung dieser Situation in der Zeit jener ersten Begegnung dieser beiden mennonitischen Gruppen im
Chaco ist eine einfühlsame und reizvolle Kurzgeschichte von Professor Hans Krieg, der um 1931 als Zoologe und Ethnologe im
Chaco Forschungsarbeit betrieb und dabei die Siedler in
Menno und
Fernheim kennen lernte. Die Geschichte heißt „Die gebrochene Deichsel".
(37)
Einem jungen Fernheimer Fuhrmann bricht auf der Rückreise von der Bahnstation in einem Dorf der
Kolonie Menno die Deichsel. Verzagt und hilflos sitzt er am
Brunnen, wo er seine Ochsen tränken wollte. Kalter Südwind weht. Da kommt Rebekka Frees (Fröse), ein gesundes und hübsches Mädchen aus dem Dorf, zum
Brunnen, um Wasser zu holen. Der etwas freche Fernheimer beginnt ein Gespräch, das schüchterne Mennomädchen geht zaghaft darauf ein, und in kurzer Zeit springt der Funke über. Es hätte eine große Liebe werden können. Doch ein Liebesverhältnis zwischen einem Russen und einer Kanadierin ist bei den strengen Regeln der
Gemeinde ausgeschlossen. Rebekka heiratet den für sie bestimmten David Bergmann und birgt in ihrem Herzen die Sehnsucht nach dem fröhlichen Johann, dem sie damals nur so flüchtig begegnet ist.
Die Jahre gingen ins Land, und bis 1946 kam es nach einer Statistik des Heiratsregisters der
Kolonie Menno zu keiner einzigen Heirat zwischen Jugendlichen aus
Menno mit Auswärtigen.
(38) Dann beginnen sich zaghaft und langsam Bande zu knüpfen: je eine oder zwei oder auch gar keine „Mischehe" jährlich bis 1970. Erst ab diesem Jahr wird es dann reger, bis zu neun, später auch bis zu dreizehn Ehen mit Auswärtigen werden in einem Jahr geschlossen, bis zum Jahr 2001 sind es insgesamt 185. Leider ist in der Statistik des Heiratsregisters nicht vermerkt, woher die Partner dieser Mennojugend kommen. Nach einem Vermerk könnten 80 % davon Fernheimer gewesen sein.
Etwas detaillierter ist eine andere Statistik, die Ingrid Epp, damals Archivarin der
Kolonie Fernheim, 1988 für das
Mennoblatt ermittelte.
(39) Die Angaben sind mit denen aus
Menno nicht ganz identisch. Wahrscheinlich ist die Statistik in den ersten Jahren in
Menno noch unvollständig gewesen. Das beweist der Bericht von Andreas F. Sawatzky im
Mennoblatt. Isaak Funk aus
Menno heiratete in den dreißiger Jahren Suse Penner aus
Fernheim. Die
Gemeinde in
Menno erlaubte die Heirat nicht, und Penner wurde ausgeschlossen.
(40) So eine Ehe ist dann sicher auch nicht in die Statistik gekommen. Doch es geht hier nicht so sehr um statistische Genauigkeit als um den Gesamteindruck.
Nach den Ermittlungen von Ingrid Epp fanden in
Fernheim in 57 Jahren 1426 Eheschließungen statt, von denen 499 „Mischehen" waren, d.h. Ehen mit Partnern, die nicht aus
Fernheim kamen.
Im Verhältnis zu
Menno: Von 1930 bis 1939 heiratete ein Fernheimer Mädchen einen Mann aus
Menno. (Wahrscheinlich jene Suse Penner mit Isaak Funk). Von 1940 bis 1949 heirateten zwei Fernheimer Männer Mädchen aus
Menno. Bei den folgenden Zahlen wird immer nur die Zahl der Fernheimer, die Partner in
Menno heirateten, genannt. Von 1950 bis 1959 zwei Männer und eine
Frau. Von 1960 bis 1969 bereits 14 Männer und 5 Frauen. Von 1970 bis 1979 waren es 30 Außenheiraten, 24 Männer und 6 Frauen. Von 1980 bis 1987 (Stichdatum der Erhebung) 46 Eheschließungen, 39 Männer und 7 Frauen. Insgesamt gab es in diesen 57 Jahren 101 Mischehen zwischen Russen und Kanadiern. Professor Krieg hätte das Herz gelacht.
Nach der Ursache für diesen Aufwärtstrend in der Liebe zwischen
Menno und
Fernheim braucht man nicht lange zu suchen. Neben der wachsenden Aufgeschlossenheit von Seiten Mennos und der Abnahme des Überlegenheitsgefühls der Fernheimer waren es vor allem die gemeinsamen Institutionen, in denen sich die jungen Leute begegneten, kennen und lieben lernten: Die theologischen Institute, das gemeinsame
Lehrerseminar, die Universitäten in
Asunción, der „Christliche Dienst" und natürlich auch die gemeinsamen Jugendtreffen, Sportveranstaltungen usw.
Diese vielen Eheschließungen haben sicher erheblich zur Verbesserung des Verhältnisses zwischen den Kanadiern und den Russen beigetragen. „Die Liebe überwindet alles" nach 1. Korinther 13, 7.
Ausblick
Das Geschichtskomitee der
Kolonie Menno hat das Thema über das Verhältnis der beiden Kolonien
Menno und
Fernheim zueinander anlässlich des Jubiläums zum 75-jährigen Bestehen seiner
Kolonie sicher in der Absicht gestellt, nach den Ursachen für die als nicht gerade gut bekannten Beziehungen zu suchen und wohl auch mit dem Wunsch, dass sie sich bessern möchten.
In diesen Ausführungen hat sich unschwer nachweisen lassen, dass sich das Verhältnis seit jener ersten Begegnung auf der einsamen Bahnstation im
Chaco im Lauf der vielen Jahren langsam wirklich gebessert hat. Die Gründe dafür sind angeführt worden.
Was geblieben ist, sind liebgewordene
Witze und Anekdoten, die immer noch gern erzählt werden. Warum sollten sie nicht auch bleiben? Man erträgt sie heute sehr gut, und man freut sich darüber. Ein bisschen Rivalität wird es wohl immer geben, solange es Grenzen zwischen den Kolonien gibt. Wenn es in einer
Kolonie mehr regnet als in der andern, hebt das schon das Selbstwertgefühl.
Ernster sind allerdings die Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu nehmen, wie sie der deutsche Botschafter in dem oben angeführten Beispiel anregte. Es müsste uns ja nicht unbedingt schlechter gehen, um ein gemeinsames Vorgehen auf wirtschaftlicher Ebene zu erreichen. Die Frage wäre höchstens, ob die Konkurrenz zwischen den mennonitischen Genossenschaften heilsam ist, oder ob man sich dadurch gegenseitig schadet.
Bei einem Besuch des im Bau befindlichen Schlachthofes bei
Loma Plata erklärte mir David Sawatzky eingehend und interessant, wie lange man hatte planen und sprechen müssen, bis die Ideen für dieses große Projekt Eingang gefunden hätten. Meine Frage am Schluss der für mich sehr aufschlussreichen Führung war, wie lange man wohl hätte planen und sprechen müssen, damit man einen gemeinsamen
Schlachthof der drei Kooperativen
Menno,
Fernheim und
Neuland hätte bauen können.
Verwendete Literatur
- Dyck, Isaak M.: Die Auswanderung der Reinländer Mennonitengemeinde von Canada nach Mexiko, Cuauhtémoc, 1970
-
Friesen, Martin W.:
Kanadische Mennoniten bezwingen eine Wildnis, Asunción, 1977-
Friesen, Martin W.:
Neue Heimat in der Chaco Wildnis, Altona, Manitoba, 1987-
Froese, Leonhard:
Das Schulwesen der Mennoniten in Russland,in Menn. Lexikon, 1967 Band 4, 109-
Hack, Hendrik:
Die Kolonisation der Mennoniten im paraguayischen Chaco, Amsterdam, 1961-
Isaak, Franz:
Die Molotschnaer Mennoniten, Halbstadt, Taurien, 1908-
Klassen, Peter P.:
Die Mennoniten in Paraguay – Reich Gottes und Reich dieser Welt – Filadelfia, 2. Aufl., 2001-
Krieg, Hans:
Menschen, die ich in der Wildnis traf, Stuttgart, 1935-
Quiring, Jakob:
Die Mundart von Chortitza in Russland, München, 1928-
Quiring, Walter:
Russlanddeutsche suchen eine Heimat,Karlsruhe, 1938-
Schmieder, O./ Wilhelmy, H. :
Deutsche Ackerbausiedlungen im südamerikanischen Grasland, Pampa und Gran Chaco, Leipzig, 1938-
Schmitz-Winnenthal, F. K. :
Gutachten über den Antrag der Mennonitenkolonien im paraguayischen Chaco zur Erweiterung des TH – Projektes für das BMZ– maschinenschriftlich -, Bonn, 1971-
Wiebe, Gerhard:
Ursachen und Geschichte der Auswanderung der Mennoniten von Russland nach Amerika, Winnipeg, 1900
Fussnoten:
| |
| Diese Bezeichnung für die Einwanderer in den Chaco aus Kanada (1927) und aus Russland (1930) fand sehr bald allgemeine Anwendung, auch ohne spöttischen Unterton. Sie werden in dieser Abhandlung deshalb ohne Anführungsstriche geführt. – Heute werden weitgehend die Begriffe Mennos und Fernheimer gebraucht. |
| Hack 1961, 200 und Friesen 1987, 461 |
| Quiring 1938, 141 |
| Friesen 1987, 456 |
| Quiring 1938, 142 (Auf einer Predigerberatung in Saskatchewan war vor der Ausreise aus Kanada beschlossen worden, dass Schnurrbarttragen von der Gemeinde aus verboten werden sollte. Klassen 2001, 88 ). |
| Quiring 1928, 45 |
| Verbreiteter Witz in schnarrendem Ton erzählt: „Etj schnoa nich, mine Frau schnoat nich, und de Tjinja schnoren aula. |
| Quiring 1938, 141 |
| Friesen 1987, 2 |
| Isaac 1908, 278 |
| Froese in Menn. Lexikon1967, Band 4, 109 |
| Friesen 1987, 6 |
| Friesen 1987, 5 und 6 |
| Dyck 1970 |
| Eine ausführliche Erklärung für den Begriff „Altkolonier" gibt Heinrich Ratzlaff im „Jahrbuch für Geschichte und Kultur der Mennoniten in Paraguay" 2001, S. 181 |
| Wiebe 1900, 7 ff |
| Wiebe 1900, 17 ff |
| Friesen 1987, 6 |
| Hack, 1961, 199 |
| Brief vom 29. 11. 1934 – Archiv Fernheim |
| |
| Wahrscheinlich waren es die bekannten grünen Schadeschen Lesebücher aus Russland, die der Kolonie Fernheim in größerer Menge zugeschickt worden waren. |
| |
| Brief vom 26. 11. 1934 – Archiv Fernheim |
| Schmieder/ Wilhelmy 1938, 128 |
| Schmitz-Winnenthal 1970, 21 |
| Friesen 1987, 461 |
| Walter Quiring: "Schulvisite in Osterwick – 1834 in der Ukraine und 1934 in Paraguay", in Mennonitisches Jahrbuch 1973, Karlsruhe, 52 |
| Beide Zitate in Klassen 2001, 230 |
| Klassen 2001, 232 ff |
| Friesen 1987, 34 ff |
| Friesen 1977, 110 ff |
| Klassen 2001, 323 ff |
| Klassen 2001, 434 ff |
| Klassen 2001, 291 |
| Hans Krieg: „Die gebrochene Deichsel" in „Menschen, die ich der Wildnis traf", Stuttgart, 1935 |
| Statistik vom Heiratsregister der Kolonie Menno von 1928 bis 2001 |
| Peter P. Klassen: „Der Philister Weiber" in Mennoblatt Nr. 12, 1988 |
| Andreas F. Sawatzky: Opfer der Diskriminierung, in Mennoblatt Nr. 8, 2002 |
Begegnung zwischen Neuländern und Mennos 1947/48
Dr. Jakob Warkentin
Einleitung
Ende der vierziger Jahre fand im zentralen
Chaco eine merkwürdige Begegnung statt: Gutmütige, einfache und konservativ gesinnte Bewohner der
Kolonie Menno wurden vor die Aufgabe gestellt, ihre mennonitischen Brüder und Schwestern aus Russland, von denen sie sich vor etwa einhundert Jahren getrennt hatten, für mehrere Monate in ihre Heime aufzunehmen. Schlichte Landbewohner mussten nun
Flüchtlinge beherbergen, die in der Sowjetunion in Kolchosen gearbeitet und viel Leid durch Flucht und Familientrennung erfahren hatten. Sie, die in der
Tradition ihrer Vorfahren aufgewachsen waren, stets in abgeschiedenen mennonitischen Siedlungen gemäß ihres Glaubens und ihrer Weltanschauung gelebt hatten, mussten sich nun mit Menschen auseinandersetzen, die zwar auch
Plattdeutsch sprachen, die aber in Russland die Revolution sowie Verfolgung und Enteignung erlebt hatten und durch den Zweiten Weltkrieg und die Flucht verunsichert und entwurzelt worden waren. Wie sollte und konnte das geschehen?
Um darauf eine Antwort zu finden, habe ich zunächst einmal die Protokolle des Chortitzer Komitees befragt, dann mehrere Interviews in
Menno und
Neuland durchgeführt und schließlich die eigenen Erfahrungen zu Rate gezogen. Die Interviews sind nicht repräsentativ, sind aber interessante Mosaiksteinchen, die für das Gesamtbild einen nützlichen Beitrag leisten.
Vorbereitung zur Aufnahme der Flüchtlinge
Die Protokolle des Chortitzer Komitees lassen erkennen, wie sich die Verwaltung und die Bürger der
Kolonie Menno auf die Aufnahme der
Flüchtlinge vorbereiteten. Mit „Flüchtlingen" bezeichnete man die mennonitischen Immigranten, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus Russland geflohen waren und dann ihren Weg über Polen und Deutschland nach
Paraguay gefunden hatten. Die Bewohner von
Menno wurden von den Bewohnern in
Fernheim „Kanadier" oder „Strohhüte" genannt, während die Fernheimer bei den Mennos als „Russen" oder „Mützen" bekannt waren.
Am 19. August 1946 beschloss das
Chortitzer Komitee im Beisein des Lehrdienstes, d.h. der Predigerschaft, auf einer Sitzung, dass die Dorfsbewohner in Verbindung mit dem
Lehrdienst entscheiden sollten, wer wie viele
Flüchtlinge aufnehmen und für einige Zeit beköstigen könnte.
(2)
Im Laufe der Zeit wurde ein Flüchtlingskomitee gegründet und in jedem Dorf ein Bürger zum Flüchtlingsaufseher ernannt, der für die im Zusammenhang mit den Flüchtlingen aufkommenden Fragen zuständig sein sollte.
Am 6. März 1946 beschloss das Flüchtlingskomitee zusammen mit den Dorfsaufsehern im Beisein des Vorsitzenden des Chortitzer Komitees, dass die
Flüchtlinge in der
Kolonie Menno gut behandelt werden und die bis dahin angenommenen Verordnungen von beiden Seiten eingehalten werden sollten. Wörtlich heißt es im Protokoll dann so:
„Jedes Dorf soll seine betreffenden Flüchtlinge selbst von der Bahn abholen. Es soll auch mit Federwagen gefahren werden von etlichen, um schwächliche Personen zu laden. Auch soll jeder Fuhrmann Plane mitnehmen. Die Besorgung der Nahrung für die Fahrt von der Bahn in die Kolonie ist Dorfsangelegenheit. Auch soll für die Fahrt auf jede Person 3 Liter gekochtes Wasser vorhanden sein. Bestimmt wurde, dass nicht mehr als 4 Personen pro Wagen geladen werden sollten."
(3)Es ist erstaunlich, wie fürsorglich und vorsichtig die Mennos bei der ersten Begegnung mit den Flüchtlingen vorgingen. Sie sorgten für keimfreies Wasser, um Magenverstimmungen vorzubeugen, wiesen zudem darauf hin, dass keine „gleichgültigen Personen" die
Flüchtlinge abholen sollten. Dann einigte man sich auch darauf, diskret herauszufinden, ob die Einwanderer von Ungeziefer frei seien oder nicht.
Am 25. September 1947 fasste das Flüchtlingskomitee mit den Vertretern aus den Dörfern Beschlüsse, die den zukünftigen Neuländern das Einleben in der neuen Umwelt erleichtern könnten. So sollten die Bürger der
Kolonie Menno den Flüchtlingen beim Ansiedeln helfen, ihnen zahmes Vieh im Tausch gegen wilde Ochsen und Kühe, die Casado den Einwanderern zur Verfügung stellen wollte, geben, die zur Zeit nicht gebrauchten Pflüge und Kultivatoren ihnen leihweise zur Verfügung stellen und ihnen zeigen, wie man Sielen für Ochsen und Pferde anfertigte, Fenster- und Türrahmen herstellte und Mandiokastangen zum Pflanzen vorbereitete.
(4) Der Vorschlag zum Viehtausch wurde später jedoch vom
Chortitzer Komitee dahingehend abgewandelt, dass die Mennos den Neuländern für fünf Jahre einige zahme Kühe leihweise zur Verfügung stellen sollten, die dann nach dieser Zeit Kuh gegen Kuh wieder zurückzugeben seien.
(5)
Erlebnisse der Neuländer in der Kolonie Menno
Die zukünftigen Neuländer Bürger hatten bereits in Deutschland und auf der langen Reise bis
Paraguay viel Negatives über den
Chaco gehört, so dass sie voller Sorge herkamen. Der spätere
Oberschulze Peter Derksen hat seine Gefühle bei der Ankunft auf der Endstation später zu Papier gebracht. Er bezieht sich zwar direkt auf die Fernheimer, was aber in diesem Fall auch auf die Mennos hätte zutreffen können. Er schreibt:
„Was uns sehr angenehm beeindruckte und überraschte, als wir die Endstation Km 145 erreicht hatten, waren die schönen Pferdefuhrwerke, die hier auf uns warteten, um uns nach Fernheim abzuholen. Es war eine Lust, Pferde, Pferdegeschirre und Wagen zu sehen. Dann dampfte uns der gutriechende Bortschtsch entgegen, den man in großen Kesseln schon fertig gekocht hatte. Schließlich waren es die dicken Onkels, der damalige Oberschulze, der Schriftleiter des `Mennoblatts’ und der Krankenhausverwalter von Filadelfia, die gekommen waren, uns zu begrüßen. Sie sagten uns durch ihre Erscheinung mehr als viele schöne Worte: Wenn es im Chaco auch so dicke Leute gibt, dann werden wohl auch wir dort nicht zu verhungern brauchen."
(6)Derksen hat dann später die Erfahrung gemacht, dass sowohl die Fernheimer als auch die Mennos den Neuländern in vieler Hinsicht geholfen haben. Sie holten sie nicht nur mit eigenen Fahrzeugen von der Endstation ab, sondern nahmen sie für mehrere Monate in ihren Häusern auf, verpflegten sie teilweise gratis und gaben ihnen praktische Ratschläge für das Leben in einer für die Einwanderer völlig neuen Umwelt. Eine besondere Hilfe bedeutete der Häuserbau in der neuen Siedlung:
„Ein großer Anteil der Hilfeleistungen von den Kolonien Fernheim und Menno war der Hausbau für die alleinstehenden Frauen aus der Siedlergruppe des ersten Volendamtransportes. Diese Gruppe bestand aus 264 Familien, davon waren 154 Familien ohne männlichen Familienvorstand und von den 154 Familien wiederum 94 Familien ohne männliche Hilfe von 16 Jahren und darüber. Es wurden von den Kolonien Menno und Fernheim zusammen 94 Häuser im Rohbau aufgeführt. Davon etwa zwei Drittel von der Kolonie Menno und ein Drittel von der Kolonie Fernheim (Die Häuser waren durchschnittlich 6 bis 7 m lang und 3,5 bis 4 m breit, auf einer Seite hatten sie ein Schattendach und waren mit Schilf gedeckt. In den meisten Fällen versah man sie mit Türen und Läden)."
(7)In Reinland hatten die Dorfbewohner ein Haus für 10 Familien gebaut, damit die
Flüchtlinge nicht bei den einzelnen Bauern wohnen mussten. Das hatte praktische Vorteile, sowohl für die
Flüchtlinge als auch für die Dorfsbewohner, denn auf diese Weise konnten die Einwanderer abends zusammen sitzen und singen, was wieder die Dorfsjugend anlockte, denn diese kannte bis dahin nicht den mehrstimmigen Gesang. Die Dorfsbewohner wiederum waren räumlich in ihren Häusern nicht so beengt und hatten zum Teil ein Privatleben mit ihren Familien. Das Verhältnis zwischen den Reinländern und den Flüchtlingen war sehr gut, das konnte man von den Beteiligten immer wieder hören. So berichtet eine Mutter von zwei Kindern über ihre Erlebnisse Folgendes:
„Tagsüber verteilten wir uns …auf die einzelnen Höfe des Dorfes zur Arbeit, auch die Kinder konnten schon ein wenig mithelfen. Meine erste Arbeit war Mandioka hacken. Später gab’s verschiedene Arbeiten im Haushalt und Feld. Nur Mutter, die kränklich und schwach war, blieb im Hause. Sie wurde dort mit Essen versorgt, wir anderen aßen bei unseren Wirtsleuten. Zur Mittagspause und nach dem Abenbrot kehrten wir in `unser’ Haus zurück….
Als erst Weihnachten da war, wurden wir sogar beschenkt. Ich wurde mit einem Küchenschrank überrascht, den der Wirt ganz im geheimen für mich gemacht hatte. Dieser Schrank war, als wir schon auf dem Kamp wohnten, lange Zeit die einzige Stelle, in die der Staub nicht eindringen konnte…."
(8)Familien, in denen keine erwachsene männliche Person vorhanden war, wurde ein Häuschen auf dem Siedlungsgelände errichtet. Darüber berichtet eine damals 17-jährige junge
Frau:
„Unsere Wirtsleute aus Menno brachten uns samt Baumaterial, Dachbalken, Sparren und Latten auf den Kamp, wo wir siedeln wollten. Am Ziel angekommen, nahmen wir gleich die Spaten und machten uns daran, das hohe Bittergras auszustechen, um uns Platz für einen vorläufigen Unterschlupf zu schaffen. Wir holten Äste aus dem Busch, stellten sie in einem kleinen Viereck zu einer Art Hütte zusammen und deckten die ausgestochenen Grasbüschel darüber. Das war unser erstes eigenes `Haus’ im Chaco. In etwa einer Woche hatten aber die Mennoleute das Baugerüst mit Dach für unser zukünftiges Haus aufgestellt. Mit der weiteren Arbeit blieben wir dann allein."
(9)Was beeindruckte nun die jungen Menschen unter den Flüchtlingen, als sie nach
Menno kamen?
Ein 17-jähriger junger Mann war beeindruckt von der Einfachheit und Schlichtheit der Mennobürger und besonders von deren Gastfreundschaft. Die einförmige Kleidung fiel ihm nicht besonders auf, da die Menschen in der Sowjetunion auch einheitliche Kleidung getragen hatten. Weniger gefiel ihm der eintönige Gesang und der traditionelle Gottesdienst. Durch die praktische Arbeit konnte er aber viel lernen, so z.B.
Brunnen graben und Ochsen einfahren, alles Tätigkeiten, die er später auf dem
Kamp gut anwenden konnte.
(10)
Eine 23-jährige junge
Frau machte einige besondere Erfahrungen in der Begegnung mit den Mennos. Beeindruckend war für die
Flüchtlinge immer wieder, dass in den Familien in
Menno auch der Vater zugegen war, denn viele Flüchtlingskinder hatten ihren Vater in Russland oder im Krieg verloren. Väter arbeiteten nicht nur auf dem Feld, sondern halfen teilweise auch den Frauen in der
Familie. So bürstete beispielsweise ein Vater am Sonnabend die Kinder beim Baden gründlich ab, während die Mutter die Kinder abtrocknete. War der Vater in dieser Hinsicht vielleicht modern, so bestand er aber, was die Kleidung betraf, auf die konservativen Grundsätze. Als die zukünftige Neuländerin einmal dessen Anzughose gebügelt hatte, war der Mann sehr aufgeregt und weigerte sich, die Hose mit einer Bügelfalte am Sonntag anzuziehen. Er zog die Hose erst wieder an, nachdem die Bügelfalte verschwunden war.
Eine andere Erfahrung überraschte sie noch mehr. Als sie einmal beobachtete, wie die Mennos, die nach
Südmenno umzogen, mit allen Sachen zum neuen Wohnort gefahren wurden, platzte sie im Blick auf die eigene Sitaution mit der Bemerkung heraus: „So ist das, diese Umsiedler werden mit allen Sachen zum Bestimmungsort gebracht und uns will unser Wirt, der uns 100% ausgenutzt hat, nicht einmal auf unser Siedlungsland fahren." Der Wirt, der zu dieser Zeit nicht anwesend war, hörte später diese Beschuldigung und forderte die junge
Frau auf, mit ihm zur Straße zu gehen, um dort die Sache zu besprechen. Nun bekam sie es mit der Angst zu tun, denn sie wusste nicht, was der Wirt mit ihr vorhatte. Vorsorglich sagte sie zu ihrem Verlobten, der in der Nähe war, dass er ihr unbedingt zu Hilfe kommen sollte, wenn der Wirt sie schlagen wollte. Der Wirt reagierte aber völlig anders, als sie erwartet hatte. Er fragte sie, ob sie die obige Aussage gemacht hätte. Sie sagte: „Ja, das habe ich gesagt." Darauf sagte der Wirt: „Reiche mir die Hand, jetzt sind wir Freunde bis an unser Lebensende." So hoch schätzte er es ein, dass die junge
Frau bei der Wahrheit geblieben war.
Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit standen damals bei den Mennos sehr hoch im Kurs. Das bestätigt auch ein damals 21-jähriger junger Neuländer, der die Mennos als „arglose, grundehrliche und hilfbereite Menschen"
(11) kennen lernte. So hatte er beispielsweise beim Einkauf folgende Erfahrung gemacht. Er und sein Bruder wollten in
Sommerfeld im Geschäft einen Strick kaufen. Der Verkäufer sagte zu ihnen, sie sollten sich den Strick selber abmessen und abschneiden. Nachgemessen wurde nicht, als sie ihn zu bezahlen hatten. Das war „blind trusting", so sein Kommentar nach vielen Jahren.
(12).
Ein anderer 24-jähriger junger Neuländer, der als Soldat und Arbeiter in der Kohlengrube seine Erfahrungen in Europa gemacht hatte, wollte nun auch im
Chaco vieles erleben und vor allem lernen. So lernte er Baumwolle pflücken, Kafir schneiden und bewunderte vor allem die gehorsamen Pferde seines Wirts. Ihm fiel zwar auf, dass die Mädchen Kleider hatten, die von den Füßen bis zum Hals reichten, genoss aber an den Abenden das fröhliche Beisammensein mit den Jugendlichen aus
Menno. Dabei spielten einige Jugendliche Mundharmonika oder Gitarre, während die anderen sich fröhlich beim Tanz drehten. Da er ein guter Tänzer war, machte er begeistert mit. Erst später merkte er, dass die Ohms der
Gemeinde diese Vergnügungen nicht wünschten. Andererseits nahm er aber auch an Versammlungen teil, bei denen ernsthaft über die
Bibel gesprochen wurde. Die Mennos waren in seinen Augen ganz anders als die Menschen in Deutschland, aber als rückständig hat er sie nicht empfunden.
(13)
Eine 17-jährige Neuländerin konnte in
Menno sogar einen Teil ihres Lebenstraumes verwirklichen. Da sie schon immer gerne gelernt hatte, wollte sie Lehrerin werden. Das Leben auf der Flucht erlaubte ihr aber nur eine vielfach unterbrochene Allgemeinbildung. Da sie gerne mit Kindern umging und diesen Geschichten erzählte, wurde sie von der Schwägerin ihres Wirts gebeten, ihre Kinder zu unterrichten. Diesen genügte der damalige Schulunterricht, der aus den Klassenstufen
Fibla, Katechisma, Testamentla und
Bibla bestand, nicht. So führte sie eine kleine Privatschule, in der anfangs in Bergtal und später in Schönwiese Unterricht abgehalten wurde. Sie begann ihren Unterricht mit zwei Kindern, später kamen die Kinder anderer Familien hinzu, so dass sie schließlich eine Schülerzahl von 10 Kindern hatte. Aus
Fernheim hatte sie sich das entsprechende Unterrichtsmaterial besorgt, so dass der Unterricht wie in einer normalen Primarschule erteilt werden konnte. Zusätzlich lehrte sie die Kinder jedoch auch noch den
Katechismus. Das war ein Zugeständnis an das Schulsystem in
Menno.
Insgesamt hat sie auf diese Weise vier Jahre in
Menno unterrichtet, und zwar in den Monaten April bis September. Während der übrigen Zeit war sie in
Neuland, wo sie zusammen mit ihrer Mutter eine eigene Wirtschaft hatte. Entschädigt wurde sie für ihre Schularbeit mit Geld oder Materialien. So bekam sie im ersten Jahr sinnigerweise ein Pferd geschenkt, damit sie zum Schulanfang die weite Anfahrt von
Neuland nach
Menno machen konnte. Später hat sie dann noch drei Jahre in
Neuland und ein Jahr auf der Leprastation als Lehrerin gearbeitet.
Auf diese Weise ging der Lebenstraum der jungen Neuländerin, Lehrerin zu sein, teilweise in Erfüllung und zugleich wurde sie eine Pionierlehrerin in der
Kolonie Menno. Das war zu der damaligen Zeit durchaus revolutionär, denn damals gab es in
Menno keine Lehrerinnen, sondern nur Lehrer und auch keinen modernen Schulunterricht. Auffallend ist, dass das in der damaligen Zeit möglich war. Die Lehrerin erhielt zwar einmal Besuch von den
Ohms in der Schule, wobei diese sich ihren Unterricht anschauten, aber ihr gegenüber keine Kritik äußerten.
(14)
Die kleineren Kinder der Neuländer machten in
Menno ihre eigenen Erfahrungen. So berichtet ein damals 9-jähriges Mädchen über ihre Eindrücke und Erfahrungen Folgendes:
In Deutschland war sie in der 3. Klasse gewesen, nun wurde sie in
Menno der Gruppe der
Testamentla zugefügt. Alle Schulstufen waren in einem Raum beisammen. Wurde in der Schule gelernt, so wurde an den Werktagen hart gearbeitet. Dabei mussten die Kinder mithelfen. Das erfuhr sie an ihrem 10. Geburtstag auf schmerzliche Weise. Vormittags hatte sie frei gehabt, aber nachmittags musste sie Bohnen pflücken, denn es drohte zu regnen, und die Bohnen sollten unbedingt noch vor dem Regen gepflückt werden.
Was sie aber besonders beeindruckte war, dass in
Menno alles so geordnet war. Die Dörfer waren alle in Ost-West oder in Nord-Südrichtung angelegt, die Höfe standen voller Paraisobäume, die Familien waren groß und hatten auch einen Vater in der
Familie, die Häuser waren ordentlich und gepflegt. Das alles war für ein Flüchtlingskind, das den Vater verloren und Vertreibung und Krieg miterlebt hatte, nicht selbstverständlich.
Gepielt wurde in der Freizeit zwar auch, aber Spielzeuge waren weitgehend unbekannt. Man spielte Verstecken, Fangen u.a.m. Sie half der Wirtin auch mit den Kindern, während ihr Bruder dem Wirt beim Vieh und mit den Pferden half. In der Mittagszeit lernte er beim Wirt in der Scheune, wie man einfache Möbelstücke an der Hobelbank anfertigen konnte. Das waren praktische Tätigkeiten, die bei der Ansiedlung auf dem
Kamp von Nutzen waren.
(15)
Nun will ich selber etwas aus der Perspektive eines neunjährigen Jungen über die Begegnung mit den sogenannten Mennoleuten berichten.
(16) Das Wichtigste für uns Kinder, als wir in Reinland von
Ohm Peta und
Sauntjemum aufgenommen wurde, war, dass wir jetzt keine Angst mehr zu haben brauchten. Flucht und Krieg hatten ein Ende gefunden. Nun galt es, sich in der neuen Heimat zurechtzufinden.
Auf dem Land gab es viel zu lernen. Wir lernten, wie man Mandioka und Süßkartoffel pflanzt, wie man Erdnüsse und Baumwolle erntet und vor allem wie man die Felder von Unkraut frei hält. Ich selber half beim Taubenhüten, meistens auf dem Rücken des alten Piet, von wo aus ich eines Tages zusammen mit dem Schaffell eine schnelle Bodenlandung machte. Wir genossen den Obstgarten, das Essen und das freie Leben.
Da meine Schwester und ich noch jung genug waren, durften wir auch die Schule besuchen. Meine Schwester war Bibla und ich Testamentla. Hier lernte ich die gotische Schrift, das schriftliche Dividieren und die Schulregeln, die so beginnen: Wenn du des Morgens früh aufstehst, so danke Gott und sei zufrieden… Das endete dann mit den folgenden Rechenoperationen: 10 mal 10 ist 100, 100 mal 100 ist 10 000, Tausend mal Tausend ist eine Million. Dann setzten wir uns alle schwungvoll in die Schulbänke. Mein Lehrer war Johann B. Giesbrecht, der eine wunderschöne Handschrift hatte, die ich sehr bewunderte. Überhaupt hatten die Giesbrechts sehr geschickte Hände. Ohm Peta konnte nach meiner Vorstellung alles machen: Bettgestelle, Fenster und Türen, Küchenschränke und Wagenräder. Alles, was mit Holz und Eisen zusammenhing, das wurde mit seinen geschickten Händen schnell in die gewünschte Form gebracht.
Nur – ein Bauer war
Ohm Peta nicht, diese Arbeit mussten größtenteils die Töchter verrichten. Pferde hatte er daher auch nicht so schöne wie die Nachbarn. Kurzum, diese Erfahrung und die kümmerlichen bäuerlichen Anfänge auf dem
Kamp, zusammen mit meiner Schwester, meiner Mutter und meiner Grossmutter haben gewiss dazu beigetragen, dass ich selber keine Neigung verspürte Bauer zu werden. So wurde ich Lehrer und habe alle Gelegenheiten genutzt, um mich weiterzubilden.
Die Schattenbäume und die Obstbäume hatten es mir angetan. Manchmal dachte ich, wenn jetzt die russischen Soldaten kämen, würde ich mich in einem dichten Apfelsinenbaum verstecken. Kriegserlebnisse kann ein Kind nicht so schnell vergessen. Mir gefiel auch die Zisterne, die nach oben abgerundet war. Wenn ich abends die Füße gewaschen hatte, brauchte ich keinen Fußlappen. Ein paar Schritte auf der Zisterne trockneten die Füße sehr schnell. An diese Sisterne habe ich in
Neuland noch lange zurückgedacht, als wir in Gnadental unser Trinkwasser in einem Fass herbeiholen mussten. Wenn ich an die Zisterne, an die Schattenbäume und an die Obstbäume dachte, dann konnte ich es nicht verstehen, wie Peter B. Giesbrechts Ende der vierziger Jahre Reinland verlassen konnten, um in
Südmenno neu anzufangen. Abends saßen Groß und Klein oft vor dem Flüchtlingshaus. Da wurde erzählt und vor allem viel gesungen, einstimmig und mehrstimmig, geistliche und weltliche Lieder.
Ein besonderes Fest fand an
Weihnachten oder an besonderen Sonntagen statt, wenn alle Verwandten und auch wir bei Abram Giesbrechts,
Großmaume en
Großpaupe, zusammenkamen. Da wurde nach Herzenslust gespielt und gegessen. Und Geschenke gab es, das war für uns immer etwas Besonderes.
Giesbrechts hatten uns, als wir auf den
Kamp zogen, für den Anfang mit dem Nötigsten ausgestattet. Die Kuh,
Nietel mit Namen, gab uns die eigene Milch und der Hund
Ali fing die ersten Füchse, die unsere Hühner stehlen wollten. Wenn wir später einmal Giesbrechts in Reinland besuchten, fuhren wir wie nach Hause. Meistens fuhren wir dann reich beschenkt nach
Neuland zurück. Einmal wollten wir gerade vom Hof fahren, da kam
Sauntjemum angelaufen, maß mit der Hand schnell meinen Oberkörper, lief zurück an die Nähmaschine und brachte mir nach wenigen Minuten ein Hemd, das sie in der Schnelle zusammengenäht hatte. Was uns aber am meisten freute, war das Obst im Garten, denn in den ersten Jahren auf dem
Kamp haben wir unter dem Mangel an Obst und Gemüse sehr gelitten.
Die Begegnung der Mennos mit den Neuländern
Als die Mennos die
Flüchtlinge von der Endstation abholen wollten, mussten sie dort lange warten. Casado, der Eigentümer der
Eisenbahn, ließ ein paar Ochsen schlachten, damit alle genug zu essen hatten. Ein 27-jähriger Bauer aus Bergfeld holte eine alte
Frau sowie eine jüngere
Frau mit drei kleinen Kindern ab und brachte sie in sein Haus. Er war jung verheiratet, und sie hatten wenig Platz im Haus, dennoch waren sie bereit, den Flüchtlingen Aufnahme zu gewähren. Die
Flüchtlinge waren arm und deswegen störten sie sich auch nicht an der Armut der jungen
Familie, denn sie waren froh, überhaupt mit dem Leben davongekommen zu sein. Die Fernheimer waren ja nicht so arm und ausgehungert in den
Chaco gekommen, sie hatten mehr
Bildung als die Mennos und fühlten sich diesen gegenüber auch überlegen.
(17)
Ein 21-jähriger junger Mann aus Waldheim sollte ebenfalls
Flüchtlinge von der Endstation abholen. Sein Vater hatte ihm gesagt, er könne jeden mitbringen, ganz gleich, ob die Männer Haare unter der Nase hätten oder die Frauen auffällige Kleider trugen. Die
Flüchtlinge machten auf ihn von Anfang an einen guten Eindruck, denn sie waren recht freundlich. Für ihn war der Kontakt mit moderner eingestellten Menschen ohnehin kein Problem, denn er kam aus einem Dorf und aus einer
Familie, wo man fortschrittlich gesonnen war. Mit den Neuländern verstand er sich dennoch besser als mit den Fernheimern, denn diese gebrauchten bei der Anrede das förmliche „Sie" anstelle des vertrauteren „Du".
(18)
Für ein 14-jähriges Mädchen in Reinland war die Begegnung mit den Neuländern eine interessante Abwechslung. Gespannt lauschte sie den Berichten der
Flüchtlinge, wenn diese von Russland, von der Flucht und vom Krieg erzählten. Als eine
Frau wieder einmal von den erfahrenen Ungerechtigkeiten und Schikanen sprach, meldete sie sich zu Wort und machte Vorschläge, wie sie den Missetätern mutig entgegen getreten wäre. Sehr bald aber sah sie ein, dass man gegen brutale Gewalt als Mädchen oder
Frau wenig hätte ausrichten können.
Mit den Flüchtlingen hatten sie überraschenderweise sehr gute Erfahrungen. Bevor die ersten Neueinwanderer ins Dorf kamen, hatten manche Bürger Befürchtungen in Umlauf gesetzt, die nicht allzu Gutes erwarten ließen. Es hieß, die
Flüchtlinge seien stolz und „verlebt". Besonders vor den Frauen fürchtete man sich, denn diese hatten so viel auf der Flucht und im Krieg erlebt, so dass sie sich vermutlich schwerlich problemlos in das Familienleben würden einfügen können. Die Erfahrung zeigte dann später, dass das genaue Gegenteil eintrat. Man konnte von diesen Frauen viel lernen, sowohl was Lebenserfahrung als auch das christliche Leben betraf.
Neugierig wie sie war, versuchte sie als junges Mädchen es den Flüchtlingen gleich zu tun. Wenn ihre Eltern einmal verreist waren, trat sie vor den Spiegel, verkürzte ihren Rock und ging so zu den gleichaltrigen Flüchtlingsmädchen. Nachher trennte sie die Naht wieder auf, so dass die Eltern nichts von ihren Modernisierungsversuchen merkten. Diese erkannten es vielmehr an, als die Flüchtlingsfrau, die bei ihnen wohnte und
Mumtje genannt wurde, ihr von der
MCC-Kleiderspende erhaltenes kurzes Kleid durch einen angenähten Stoffstreifen auf die in
Menno übliche Kleiderlänge brachte.
Die Mennos haben von den Neuländern viel gelernt, so ihr Kommentar nach vielen Jahren. Das enge Zusammenleben mit ihnen habe auch das bessere Zusammenleben mit den Fernheimern ermöglicht. So sei es heute nichts Besonderes mehr, dass ihre beiden Söhne Fernheimer Mädchen geheiratet hätten.
(19)
Einen damals 22-jährigen jungen Mann aus
Menno gefiel von Anfang an der mehrstimmige Gesang der Neuländer. Er war von den Flüchtlingen angenehem überrascht worden, denn sie waren ganz anders, als sie sich diese vorgestellt hatten. Er kam mit ihnen sehr gut aus und lernte auch deren Kinder kennen, da diese die Schule besuchten, in der er zeitweilig als Lehrer angestellt war. Besonders gefiel ihm, dass die Neuländer nicht stolz waren und sich ihnen gegenüber nicht überlegen fühlten. Von den Fernheimern wurden sie damals als niedriger stehend angesehen. Das habe den ungezwungenen Umgang mit ihnen erschwert. Mit den Neuländern hingegen hätten sie sich gleich verbunden gefühlt.
(20)
Beurteilung der Begegnung zwischen den Mennos und den Neuländern
Ich will nun einige Überlegungen anstellen, um zu zeigen, welche Bedeutung die oben beschriebene Begegnung zwischen den Neuländern und Mennos für das spätere Zusammenleben der Mennoniten im
Chaco gehabt hat.
Die Begegnung zwischen den einfachen, konservativen, aber sehr hilfsbereiten Mennoleuten mit den entwurzelten und in vieler Hinsicht desorientierten und desillusionierten Neuländern war ein Lernprozess, aus dem beide Seiten nicht unverändert auseinandergingen. Die Neuländer hatten erfahren, dass es in dieser Welt noch Menschen gibt, die friedlich miteinander umgehen, an Gott glauben und bei Bedarf einander helfen. Die Mennos hatten gesehen, dass Menschen, die moderne Kleider tragen, sich die Haare krausen und mehrstimmig singen im Grunde genommen doch mennonitische Brüder und Schwestern sind.
Diese Erfahrung wirkte sich befruchtend auf das weitere Zusammenleben der Mennoniten in den Chacokolonien aus. Es gab nun nicht mehr nur zwei Gruppen, die sich gegenüberstanden und einander mit Hochmut und Misstrauen begegneten, wie es lange zwischen den „Russen" und den „Kanadiern" der Fall gewesen war, sondern drei Gruppen, die zwar alle verschieden waren, dennoch aber zusammenarbeiten mussten und es schließlich auch konnten.
Auf diese Weise wurde in der
Kolonie Menno der Reformkurs, der von innen kam, von außen ideell und praktisch unterstützt und dadurch beschleunigt.
Die Fernheimer und Neuländer erkannten, dass sich die Einfachheit und Treuherzigkeit der Mennos auf christliche Werte gründete und nicht auf Naivität oder Beschränkheit zurückzuführen sei.
Die Mennos sahen ein, dass das sture Festhalten an überlieferten Normen und Traditionen auf die Dauer Rückständigkeit zur Folge haben würde. Ein differenziertes Schulwesen und ein abwechslungsreiches Gemeindeleben brachte nicht notwendigerweise den Abfall von Gott und die Abkehr vom überlieferten Glauben der Väter mit sich, sondern bedeuteten echte Lebenshilfe.
Die häufigen Kontakte zwischen den Neuländern und den Mennos trugen dazu bei, dass auch das Verhältnis zwischen den Fernheimern und Mennos sich nach und nach normalisierte. Vorurteile wurden abgebaut, wirtschaftliche, schulische, gemeindliche und sportliche Kontakte zwischen den Bewohnern aller drei Kolonien auf- und ausgebaut, so dass im Laufe der Zeit die drei Kolonien zwar weiter bestehen blieben, die Beziehungen untereinander aber zunahmen und sich in zahlreichen gemeinsamen Projekten manifestierten.
Es bleibt zu wünschen, dass sich die Beziehungen zwischen den Kolonien weiterhin verbessern, Vorurteile weiter abgebaut werden und Unterlegenheits- und Überlegenheitsgefühle einer nüchternen und realistischen Selbsteinschätzung Platz machen. Es wäre für alle Beteiligten gut, wenn die Gemeinsamkeiten in unseren Köpfen und Herzen mehr Raum gewinnen und die immer noch bestehenden Unterschiede realistisch eingeschätzt würden.
Quellenmaterial
- Interviews mit Neuländer Bürgern
- Interviews mit Bürgern aus der Kolonie Menno
- Jakob und Sina Warkentin: Vortrag auf dem Menno-Gedenktag am 25.Juni 2001
- Protokolle des Chortitzer Komitees 1946/47
- Walter Regehr (Hrsg.): 25 Jahre Kolonie Neuland, Chaco Paraguay (1947-1972), Karlsruhe 1972.
Fussnoten:
| Langjähriger Dozent und Direktor des Gemeinsamen Lehrerseminars der Mennonitenkolonien in Paraguay. Dr. phil., der Universität Marburg. |
| Prot. des Chortitzer Komitees vom 19.8.1946. Alle zitierten Protokolle befinden sich im Archiv der Kolonie Menno und zwar im Aktenordner der Jahre 1944-59. Die Protokolle aus der damaligen Zeit sind sehr knapp gefasst, meistens werden nur die Beschlüsse festgehalten. Ich danke Heinrich Ratzlaff, dass er mir dieses Aktenmaterial zur Verfügung gestellt hat. |
| Prot. vom 6. März 1946. Mit „Bahn" ist hier die Endstation der Schmalspurbahn gemeint, die vom Hafen Puerto Casado 145 km landeinwärts führte und hauptsächlich für den Holztransport genutzt wurde. Mit Federwagen sind die von Pferden gezogenen „Buggies" gemeint, die die Mennos von Kanada aus kannten. |
| Prot. der Sitzung des Flüchtlingskomitees mit den Dorfsvertretern am 25.Sept.1947 |
| Prot. der Sitzung des Chortitzer Komitees am 30. Okt. 1947 |
| |
| ebd., S. 34 |
| |
| Agnes Martens in ebd., S. 111 |
| Interview mit Heinrich Franz am 8.5.2002 |
| Heinrich Ratzlaff: Das Schulwesen der Kolonie Menno. Maschr. Manuskript 1992, S. 25 |
| Interview mit Heinrich Ratzlaff am 24.5.2002 |
| Interview mit Peter Dyck am 8.5.2002 |
| Interview mit Agnes Martens am 8.5.2002 |
| Interview mit Lily Regehr am 15.5.2002 |
| Leicht gekürzter Bericht aus meinem Vortrag vom 25.6.2001 in Loma Plata |
| Interview mit Abram Ginter am 23.5.2002 |
| Interview mit Johann Töws am 23.5.2002 |
| Interview mit Anna Harder am 23.5.2002 |
| Interview mit Johann B. Giesbrecht am 23.5.2002 |
Sieghard Schartner
I. Mennoniten in Bolivien
a) Einwanderung
Der erste Kontakt der Mennoniten mit Bolivien kam durch Handel zustande, als etliche Leute aus den
Mennonitenkolonien im
Chaco über
Mariscal Estigarribia (damals Camacho) mit Handelsleuten in Villa Montes, Bolivien, besonders im Bereich der Erdölderivate in Verbindung kamen.
Diese Verbindungen haben wohl das Interesse geweckt und die Verbindungsmöglichkeiten geschaffen, dass im Jahre 1953 Anfang Dezember rund 10 Familien meistens auf Pferdewagen von
Fernheim in Richtung Bolivien losfuhren. Die Familien kamen im Januar 1954 auf dem erhandelten Landstück rund 25 km nördlich der damals kleinen Stadt Santa Cruz de la Sierra an und gründeten dort die erste Mennonitenkolonie „
Tres Palmas". Diese
Kolonie hat nie mehr als 14 Bürger gehabt und ist später an Baumwollfirmen verkauft worden, so dass sie heute nicht mehr existiert.
Während der Jahre 1956 bis 1958 kam dann eine größere Gruppe von Familien aus der
Kolonie Menno nach Bolivien und gründete die
Kolonie „Canadiense 1". Zum Umzug motiviert wurden diese Leute durch Armut und verschiedene Veränderungen innerhalb der Sozialzweige und des Gemeindelebens in der alten
Kolonie im
Chaco. Manche fuhren mit Pferdewagen, andere fuhren auf alten Lastwagen bis Villa Montes und von da mit dem Zug weiter bis Santa Cruz. Canadiense 1 ist heute die älteste noch bestehende Mennonitenkolonie in Bolivien.
Während der Jahre 1966 bis 1968 kamen dann die ersten großen Gruppen von Mennonitenfamilien aus Mexiko nach Bolivien und gründeten hier vier große Kolonien. Drei Kolonien wurden von Altkoloniern und eine
Kolonie wurde von Sommerfeldern gegründet.
Seit diesen Jahren hat sich die Zahl der Tochterkolonien und der Kolonien mit neuen Einwanderern stetig erweitert, so dass es gegenwärtig 40
Mennonitenkolonien mit rund 38.000 Einwohnern in Bolivien gibt.
b) Verschiedenheit
Dass verschiedener Gemeindehintergrund, Landeskultur und kulturbedingte Bräuche und Gewohnheiten manche Unterschiede im Laufe der Zeit zwischen mennonitischen Gemeindegruppen geschaffen haben, kennen wir im
Chaco auch, wo über „Russe" oder „Kanadia" nach 70 gemeinsamen Jahren immer noch manche Bemerkungen fallen.
Diese Situation haben wir noch verstärkt in Bolivien, wo die Abgrenzung zwischen den verschiedenen Gruppen bewusst gefördert wird. So haben wir in Bolivien wenigstens acht mennonitische Gemeindegruppen, die sich, wie sie sagen, „untereinander respektieren". Dies bedeutet so viel wie: Wenn du mich in Ruhe lässt, dann interessiere ich mich auch nicht für deine Probleme. Also nach Möglichkeit Abgrenzung voneinander.
Die größte Gruppe sind die Altkoloniergemeinden, die rund zwei drittel der Gesamtzahl – also ca. 25.000 Personen – ausmachen. Die Altkolonier selber teilen sich auch in 2 Gruppen auf.
Dann haben wir
Sommerfelder aus Mexiko,
Sommerfelder und
Bergthaler aus
Paraguay, Kanadier (
Menno) aus
Paraguay, Reinländer und
Bergthaler aus Kanada und
Paraguay, eine
Kolonie als Resultat der Missionsarbeit von GMU (Gospel Mission Union) und eine größere
Kolonie unter der Gemeindeleitung der Kleingemeinde von Belize.
c) Gemeinsamkeit
So unterschiedlich der Hintergrund und die Gewohnheiten dieser verschiedenen Gemeindegruppen auch sind, so gibt es aber doch auch sehr konkrete Gemeinsamkeiten. Ich will nur kurz etliche Dinge erwähnen:
– Alle stützen sich auf das mennonitische Glaubensbekenntnis und die Grundlinien des Täufertums.
– Die allermeisten haben ihre Gottesdienste nach althergebrachter Art und Weise mit Vorsängern, Predigten usw.
– Die allermeisten haben das althergebrachte Schulsystem nach dem Muster der altpreußischen Mennonitengemeinden.
– Die allermeisten leben in Bolivien, weil sie sich zu Neuerungen in den Gemeinden und Kolonien der alten Heimat nicht schicken wollten.
II. MCC-Arbeit in Bolivien
a) Beginn und Entwicklung der MCC-Arbeit
Das
MCC begann mit seiner Arbeit in Bolivien im Jahre 1960, als die beiden
Mennonitenkolonien Tres Palmas und Canadiense I um eine Krankenschwester und landwirtschaftliche Beratung baten.
Die Arbeit der Krankenschwester und die Eröffnung einer kleinen Klinik brachten auch manche Kontakte mit der armen bolivianischen Bevölkerung in der Umgebung. Als dann nach rund zehn Jahren die Klinik an die
Mennonitenkolonien abgegeben wurde, konzentrierte sich die
MCC-Arbeit auf Wunsch mancher armer Bevölkerungsgruppen in Bolivien hauptsächlich auf Leute aus dem spanisch-sprachigem Umfeld.
b) MCC-Programm Centro Menno
Da die Anzahl der
Mennonitenkolonien und ihre Einwohnerzahl aber stark zunahm, wurde auch hier manche Not gesehen. So enstand um 1980 neben sieben anderen
MCC-Programmen unter spanischsprachigen Gruppen wieder ein
MCC-Programm, welches das Wohlergehen der plattdeutschsprachigen
Mennonitenkolonien in Bolivien im Blickfeld hatte. Dieses
MCC-Programm wurde „Centro
Menno" genannt.
Dazu muss gesagt werden, dass die
Mennonitenkolonien beim
MCC nicht um Hilfe baten, sondern dass das
MCC von sich aus eine Begleitung der Glaubensbrüder in Bolivien in ihren verschiedenen Herausforderungen und Nöten für angebracht hielt. Von daher ist es verständlich, dass Centro
Menno bis heute eine begleitende und keine führende Stellung in der Zusammenarbeit mit den Kolonien hat.
c) Centro Menno-Arbeit heute
Durch die begleitende Stellung von Centro
Menno wird nicht mit konkreten Aufbau und Entwicklungsprojekten gearbeitet, sondern es wird auf verschiedenen Gebieten auf Wunsch Beratung und Begleitung angeboten. Dabei haben sich während der Jahre verschiedene Beratungsebenen herauskristallisiert, an denen heute gearbeitet wird.
- Landwirtschaftsberatung: Nach Möglichkeit gehört ein Agronom zum Team von Centro Menno. Sein Aufgabenbereich teilt sich auf in konkrete Beratung einzelner Bauern, Förderung von Kontakten mit Aufkauffirmen von Agrarprodukten und Beratung in Viehwirtschaft.
-
Gesundheitsdienst: Nach Möglichkeit gehört eine ausgebildete Krankenschwester zum Team von Centro Menno. Ihr Aufgabenbereich teilt sich auf in konkrete Kontakte mit den ungelernten Gesundheitsförderern (Doktamumtjes und Doktaomtjes und Knokendoktasch und Narvendoktasch usw.) innerhalb der Koloniegemeinschaften, Kontakte mit Krankenhäusern und Ärzten in Santa Cruz und auf Wunsch Begleitung von Kolonisten zum Arzt, um mit Übersetzung und Erklärungen zu helfen.-
Dokumentenbeschaffung: Da die meisten der Mennoniten letztlich aus Kanada kommen, werden in Centro Menno kanadische Dokumente beantragt, kanadische Reisepässe erneuert usw. Es wird nur mit kanadischen Dokumenten gearbeitet.-
Erziehungsabteilung: Nach Möglichkeit gehört ein Schullehrer zum Team von Centro Menno. Im Erziehungsbereich wird auf verschiedenen Ebenen gearbeitet.-
Es gibt eine größere Leihbibliothek, wo Bücher mit verschiedenen Themenbereichen in deutscher und englischer Sprache zum Verleih angeboten werden. Es ist interessant, dass Frauen trotz geringer Schulbildung die Leihbibliothek mehr brauchen als Männer.-
Es gibt einen Buchhandel, in dem sich die Kolonisten ihre Bibeln und Gesangbücher, das Schulmaterial für die Schulen, Rezeptbücher, Kinderbücher usw. kaufen können.-
Monatlich wird der Menno–Bote – eine Zeitschrift für die Mennoniten in Bolivien herausgegeben. Der Menno–Bote ist wohl das einflussreichste Erziehungsmittel in unseren Händen. Monatlich gibt es eine Auflage von 2.200 Exemplaren, von denen rund 1700 Zeitschriften direkt in alle Kolonien in Bolivien gehen. Schullehrer und Gesundheitsförderer bekommen sie umsonst zugeschickt. Es wird darauf Gewicht gelegt, dass die Artikel in einem einfachen, aber richtigen Deutsch und mit einem soliden Lehrthema in die Zeitung kommen. Selbstverständlich gibt es dann auch die Seiten wie „Zacharias erzählt" und andere, die von den Leuten gern gelesen werden, aber weniger aussagen.-
Es ist ein Programm angelaufen, in dem von Centro Menno aus an Beschaffung von Zusatzmaterial für die mennonitischen Schulen in Bolivien gearbeitet wird.
III. Heutige Situation der Mennoniten in Bolivien
a) Kirchliche Gemeindearbeit
Die Kirchengemeinde ist die tragende Institution in jeder
Kolonie in Bolivien. Es gibt wohl Ansätze von Gemeinschaftsunternehmen in Gruppen wie z.B. eine Molkerei für etliche Dörfer zusammen, aber Koloniegemeinschaften, wie wir sie hier im
Chaco kennen, gibt es dort nicht. Die
Gemeinde ist die einigende und ausschlaggebende Institution in allen Lebensbereichen der
Kolonie.
In jeder
Kolonie gibt es nur eine
Gemeinde, die von einem Ältesten und etlichen Predigern und Diakonen geleitet wird. Es gibt aber in den größeren Kolonien mehrere
Kirchen, wo sonntäglich Gottesdienste abgehalten werden.
In den meisten Gemeinden wird nach der langen Weise aus ihren alten Gesangbüchern gesungen. Jeder Kirchgänger nimmt zwar keine
Bibel, aber immer sein Gesangbuch mit in die Kirche. Die Kinder gehen meistens nicht mit in die Kirche, da sie ja in der Schule den Bibelunterricht bekommen.
Den Jugendlichen steht es frei, am Gottesdienst teilzunehmen oder nicht, solange sie nicht durch die
Taufe zur
Gemeinde gehören.
Die Tauffeste finden nur während der Pfingstfeiertage statt, und es wird befürwortet, dass die Täuflinge nicht unter 18 Jahre alt sind.
In den Kolonien findet man viele sehr gläubige Menschen und für die gewählten
Prediger und den Ältesten ist ihr Aufgabenbereich ein von Gott und der
Gemeinde anvertrautes Gut, das gewissenhaft und den hergebrachten Erkenntnissen gemäß verwaltet wird.
b) Wirtschaftslage
Die Wirtschaftslage innerhalb der
Mennonitenkolonien hat sich während der letzten Jahre sehr verschlechtert. Hauptgründe dafür sind, dass sich während der letzten vier bis fünf Jahre die Regenzeit stark verschob und die Preise für die Agrarprodukte gegenwärtig bis zu 50% niedriger liegen als vor sechs Jahren.
Da innerhalb der
Mennonitenkolonien in Bolivien nicht das Genossenschaftswesen im Wirtschaftsbereich läuft, muss jeder Bürger für die Finanzen der Aussaat und Ernte selber aufkommen und seine Ernteerträge alleine vermarkten. Dadurch sind in den letzten Jahren viele Familien verarmt und viele haben hohe Kreditschulden bei Banken und Agrarfirmen. Diese Situation hat die Auswanderung nach Mexiko und Kanada während der letzten zwei Jahre stark ansteigen lassen.
Die Ernteerträge sind in diesem Jahr durchschnittlich wieder zufriedenstellend, obzwar die Schuldenlast nur etwas gelindert, aber noch nicht befriedigend gelöst werden kann.
Gegenwärtig sind die Kolonisten für Alternativen im Produktionssektor offen und erste Schritte in Richtung Genossenschaftswesen (besonders in der Milchverarbeitung) werden gemacht.
c) Gesundheitswesen
In jeder größeren
Kolonie gibt es Gesundheitsförderer aus den eigenen Reihen. Diese haben keine theoretische Vorbildung auf dem Gesundheitsgebiet und arbeiten privat, obzwar sie die moralische Unterstützung und Anerkennung der
Gemeinde und der Gesellschaft brauchen.
In den kleinen Privatkliniken werden Dienste wie Erste Hilfe, Geburten, Massagearbeit, Hilfe bei kleineren Knochenbrüchen, Zahnbehandlung usw. angeboten, während die schwierigen Krankheitsfälle in die gut ausgerüsteten Krankenhäuser von Santa Cruz gebracht werden.
Eine Not im Gesundheitssektor ist, dass die Mennonitenfamilien meistens groß sind, die Finanzlage sich stark verschlechtert hat und es keine
Krankenversicherung gibt. Das Resultat dieser Situation ist, dass man oft erst dann zum Arzt geht, wenn keine
Hausmittel mehr helfen und als Folge dann oft lebenslange Schäden bleiben oder Kranke sterben.
d) Sozialleben
Das Sozialleben wird sehr stark von der
Gemeinde und dem Familienleben bestimmt.
Die Nachbarn treffen sich sonntäglich im Gottesdienst, obzwar hier recht wenig miteinander gesprochen wird. Im Zentrum steht eben der Gottesdienst.
An
Weihnachten, Ostern und Pfingsten werden immer drei Feiertage gehalten, wo sich dann nach den Gottesdiensten die Großfamilien zu den uns bekannten Familienfesten zusammenfinden.
Die allgemeinen Sonntagsgottesdienste beginnen in vielen Kolonien recht früh und nach dem Mittagessen um 10 Uhr geht’s dann ans Spazieren.
Für die Verlobungen und auch für Begräbnisse werden Verwandte und Freunde schriftlich zur Feier eingeladen. Bei beiden Anlässen wird ein gemeinsames Essen serviert. In den meisten Kolonien findet die Trauhandlung für Brautleute in der Kirche statt, und es gibt selten anschließend noch ein einfaches Familientreffen.
Ein wichtiges Fest sind die Ausrufe. Die Einladungen für einen Ausruf werden in alle Kolonien geschickt und es kommen dann oft bis 2000 und mehr Leute zusammen. Oft sind ganze Familien dabei. Man kauft nicht unbedingt, aber es ist ein Tag, an dem man Freunde trifft und spaziert.
Eine Not auf sozialem Gebiet ist, dass für die Jugend sehr wenig oder keine gezielt geplante
Freizeitbeschäftigung angeboten wird. Das Resultat ist, dass sich besonders die männliche Jugend dann mit Zigaretten, Alkohol, Unmoral und sonstigen schmutzigen Dingen beschäftigt, was dann wiederum zu Belastungen und Lastern führt, die bei der
Taufe und dem Eintritt in die
Gemeinde und auch in der Ehe manche Schwierigkeiten mit sich bringen.
e) Beziehung zum Landesvolk
Die Beziehung der einzelnen Mennoniten zur spanischsprechenden Bevölkerung ist in den meisten Fällen gut und sogar freundschaftlich. Gefördert wird dieser Kontakt dadurch, dass jeder Bauer seine Produkte selber an jemand aus der Landbevölkerung verkauft und meistens dort dann auch wieder seine Ware einkauft. Dazu kommt, dass in den meisten Kolonien die Kolonisten nicht eigene Wagen fahren und sich von sogenannten „Einheimern" in Taxis oder Omnibus fahren lassen und diese dann auch die Ernte mit dem Lastwagen abtransportieren.
Die meisten Männer sprechen so viel Spanisch, dass sie sich im Handelsbereich durchschlagen können, obzwar in der Schule kein Spanisch gelernt wird. Die allermeisten Frauen und Mädchen können nicht Spanisch sprechen.
Allgemein sehe ich es so, dass das Verhältnis zwischen der Landesbevölkerung und den Kolonisten direkter und positiver ist als in unseren Chacokolonien.
IV. Erziehungskonzept und Schulsituation
a) Das Erziehungskonzept in den Gemeinden und Gemeinschaften
Um die Schulsituation innerhalb der
Mennonitenkolonien in Bolivien zu verstehen, müssen wir uns kurz etliche recht verschiedene Erziehungskonzepte ansehen.
Das Erziehungskonzept in der allgemeinen sekularen Schulbildung geht davon aus, dass der Schüler möglichst befähigt werden soll, sich einen Platz im Rahmen der heutigen und zukünftigen Gesellschaft zu sichern, an dem er während seiner Lebenszeit zum Wohle und zur Entwicklung der eigenen Gesellschaft und des Vaterlandes beiträgt. Deshalb wird dem Schüler erst ein allgemeines Grundwissen und dann je nach persönlicher Wahl und Begabung ein solides Fachwissen übermittelt.
Das Erziehungskonzept der konservativen Mennonitengemeinden und Gemeinschaften geht davon aus, dass der Schüler möglichst befähigt werden soll, innerhalb des klar abgegrenzten Rahmens der Kirchengemeinde und der gottesdienstlichen Veranstaltungen einen Platz zu bekommen, von wo aus er die ewige Seligkeit anstrebt. Da Gott alles, was zum Leben, zum Sterben und zum Seligwerden in seinem Worte – der
Bibel – den Menschen übermittelt, wird in den Schulen dafür gesorgt, dass die Schüler so viel lesen lernen, dass sie in der
Bibel lesen können. Dann werden der
Katechismus, Abschnitte des Neuen Testamentes und des Alten Testamentes auswendig gelernt. Dazu kommen dann noch Kirchenlieder, Schulregeln, lange Weihnachts- und Neujahrswünsche und anderes mehr.
Um im Alltag mit den verschiedenen Berechnungen fertig zu werden, wird ein starkes Mathematikprogramm in der Schule durchgearbeitet.
Wenn wir diese beiden recht verschiedenen Erziehungskonzepte nebeneinander stellen, dann haben sie beide ihre Werte und ihren Platz in einer christlichen Gesellschaft. Von daher geht es uns in unserer Arbeit in Bolivien auch nicht darum, das eine oder das andere Konzept zu unterstützen und zu fördern, sondern es geht darum, zwischen diesen beiden Konzepten gesunde Brücken zu bauen, damit sie beide in der Gesellschaft und in der
Gemeinde zum Tragen kommen.
b) Allgemeine Erwartungen im Erziehungssektor
Vom Schullehrer wird erwartet, dass er in erster Linie eine straffe Ordnung in der Schule hat. Weil Gehorsam eine biblische Verordnung ist und gelernt werden muss, wird dem Schullehrer hier eine wichtige Rolle zuerkannt. Der Schullehrer ist während des Unterrichts, auf dem Schulhof und auf dem Schulweg für ordentliches Benehmen seiner Schüler verantwortlich.
Es wird erwartet, dass der Lehrer Ungehorsam mit der Rute der Zucht bestraft.
Es wird erwartet, dass die Kinder den
Katechismus und Bibelabschnitte auswendig hersagen können.
Besonderes Gewicht wird darauf gelegt, dass die Kinder am Weihnachtstag und an Neujahr ein langes Gedicht aufsagen können, wobei ein guter Lehrer jedes Jahr ein anderes Gedicht sucht oder selber schreibt, um Wiederholungen zu vermeiden.
Vom Lehrer wird erwartet, dass er wenigstens 100 Schultage im Jahr in sein Programm hineinbekommt.
c) Allgemeine Schulsituation
In den
Mennonitenkolonien in Bolivien gibt es rund 250 Schulen mit insgesamt 8500 bis 9000 Schulkindern. Die Schulsprache ist Hochdeutsch. In den
Mennonitenkolonien in Bolivien ist es klar, dass jedes Kind während des Schulalters in der Schule ist. Schulflucht kennt man nicht.
Die Mädchen sind vom sechsten bis zum zwölften und die Jungen vom sechsten bis zum dreizehnten oder auch vierzehnten Lebensjahr in der Schule. Dann schließt für jedes Kind das „zur Schule gehen" fürs ganze Leben ab.
Die Mädchen lernen dann zu Hause von der Mutter den Haushalt führen und die Jungen lernen vom Vater die Landwirtschaft zu betreiben.
Die Schullehrer werden für die Schularbeit bezahlt. Da am Samstag kein Unterricht ist, die 100 Schultage aber gefordert werden, ist der Schullehrer vier oder fünf Monate im Jahr mit dem Unterricht beschäftigt. Für diese Monate bekommt er ein Gehalt, das je nach Schülerzahl und den ökonomischen Möglichkeiten der
Kolonie oder des Dorfes zwischen 180 und 450 US$ beträgt.
Weitere Vergünstigungen sind, dass der Schullehrer im Schulhaus wohnen darf und die dazugehörigen Ländereien entweder bepflanzen oder zur Milchwirtschaft brauchen kann.
Jedes Dorf hat einen Schulschulzen, der für die Anstellung des Lehrers und dem Einsammeln des notwendigen Geldes zuständig ist.
Die Finanzierung der Schule wird in den verschiedenen Kolonien verschieden gehandhabt, doch wird die Verpflichtung der Schulgeldzahlungen meistens ganz oder wenigstens zum Teil nach dem
Landbesitz der einzelnen Dorfsbürger verrechnet.
Die Schulen unterstehen konkret dem Gemeindevorstand und einigemal im Jahr kommt ein Ohm oder der Älteste selber zur Schulinspektion in die Schule.
Schulprogramme für die Eltern oder Dorfsbewohner werden nicht erwartet, doch haben Eltern das Recht, auch einmal einen Schulbesuch zu machen.
d) Die Not im Schulwesen und seine Folgen
Trotz eines mehr oder weniger klaren Schulkonzeptes und einer bewährten Schulsprache (das Hochdeutsch) entsteht durch dieses Bildungswesen eine konkrete Not für diese Leute. Hier nun etliche Nöte, die spürbar sind:
- Die Schullehrer haben keine berufliche Ausbildung. Es gibt talentierte Schullehrer, die mit dem wenigen, was ihnen aus ihrer eigenen Schulzeit noch im Gedächtnis geblieben ist, und etwas schriftlichem Material Hervorragendes leisten. Durch ihre Schulerfahrung gelangen sie auch gelegentlich zu erstaunlich guten Lernresultaten. Trotzdem muss gesagt werden, dass sie nicht mehr geben können, als sie selber haben.
-
Meistens sind die Schullehrer arm und werden aus diesem Grund als Lehrer eingestellt. Es ist eine Mithilfe von Seiten der Gemeinde und der Gemeinschaft für diese arme Familie. Daraus entstehen zwei ganz konkrete Nöte:- Der Schullehrer ist oft eine Person mit wenig Eigeninitiative. Sonst wäre er wohl nicht arm und landlos.
-
Der soziale Platz eines Schullehrers innerhalb der Gemeinschaft ist niedrig. Für eine etwas besser gestellte Familie ist es eine Schande, wenn einer ihrer Mitglieder so wenig leistet, dass er Schullehrer sein muss. So soll der Lehrer wohl eine Respektsperson für die Schulkinder sein, wird aber von der Gesellschaft als minderbegabt eingeordnet.
-
Die hochdeutsche Sprache als Schulsprache ist stark verformt. Durch den Einfluss verschiedener Landessprachen, bedingt durch den ehemaligen Wohnsitz der Eltern oder Großeltern, wird der Akzent stark verformt. Dazu kommt, dass die alte deutsche Schriftsprache in gotischer Schrift gebraucht wird. Innerhalb der Altkolonier-Gemeinden wird das „a" als „au" ausgesprochen. Das Resultat ist, dass diese Leute in den allermeisten Fällen sich recht schwer oder gar nicht mit einem Deutsch sprechenden Menschen aus Deutschland unterhalten können. Es ist aber für diese Leute klar, dass sie Deutsche sind.-
Der kirchenbezogene Lerninhalt des Schulprogramms schließt aus folgenden Gründen jegliche sekulare Weiterbildung aus:- Der Lerninhalt der mennonitischen Schulen deckt sich nicht mit den Anforderungen der Landesschulen. Aus diesem Grund bekommt kein mennonitisches Kind ein Zeugnis, das ihm ein Weiterstudium erlaubt.
-
Von den Gemeinden und der Gemeinschaft wird ein breiteres Studium als nutzlos und sogar gefährlich angesehen, denn Paulus schreibt an die Korinther: „Denn dieser Welt Weisheit ist Torheit bei Gott" (1. Kor. 3,19). Im Jakobusbrief lesen wir dann: „So aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gibt einfältig und rücket’s niemand auf, so wird sie ihm gegeben werden" (Jak. 1,5). Menschliche Weisheit führt oft zur Überheblichkeit und zum Hochmut und zum Zweifel. Um sich dieser Gefahr nicht auszusetzen, wird jegliche schulische Weiterbildung abgelehnt.-
Da eine gute Schulbildung nicht als eine Voraussetzung für eine bessere Zukunft der jungen Leute gesehen wird, darf die Schule nicht viel kosten, denn dafür bekommt man nichts zurück.
Die Folgen dieser Schulsituation sind:
Innerhalb der
Mennonitenkolonien in Bolivien haben wir auf keinem Gebiet eigene Fachleute. Das bedeutet, dass es keine ausgebildeten Schullehrer, keine Ärzte, keine Krankenschwestern, keine Wirtschaftsexperten, keine in einer Bibelschule ausgebildeten
Prediger, keine Techniker usw. gibt. Da man sich bei Fachleuten von draußen nur in Notfällen Rat holt, diese aber als Außenseiter nicht innerhalb der Kolonien wohnen und arbeiten lässt, werden unsere Kolonien immer mehr an den Rand gedrängt.
Für die Zukunft kann dies nur bedeuten, dass unsere
Mennonitenkolonien sowohl auf wirtschaftlichem als auch auf geistigem und geistlichem Gebiet immer mehr verarmen und oft nicht einmal merken, wie weit dieser Weg schon beschritten wurde.
Da 60% der Einwohner der
Mennonitenkolonien laut Statistik unter 20 Jahren ist, bedeutet dies, dass heute in Bolivien in den
Mennonitenkolonien 20.000 junge Menschen heranwachsen und keiner dieser Heranwachsenden eine solide Grundschulausbildung und die Möglichkeit einer Berufsausbildung in der Zukunft hat. Dies sind deutsche junge Menschen! Dies sind Kinder aus mennonitischen Familien und Gemeinden! Hier muss doch etwas unternommen werden.
e) Mögliche Entwicklung im Schulsektor in absehbarer Zeit
Es gibt heute drei kleinere Kolonien und etliche Gruppen, die an einer besseren Schulbildung interessiert sind. In der
Kolonie Chihuahua (rund 60 Familien) wird langsam, aber gezielt an einer Verbesserung des Schulniveaus gearbeitet. Die
Gemeinde wird von der Kleingemeinde in Belize betreut und von dort kommt auch das deutsche Schulmaterial.
In der kleinen
Kolonie Campo Leon hat man sich vor drei Jahren auf Anraten von Missionaren entschlossen, ihre Schule in Englisch und nach kanadischem Lehrprogramm zu führen.
In der neuen Siedlung Buena Vista (seit 1999) gibt es eine kleine Schule, die seit zwei Jahren mit einer ausgebildeten Lehrerin aus
Neuland nach dem Schulprogramm der Chacokolonien arbeitet. Diese Schule ist dabei, die legale Anerkennung zu erhalten und wäre somit die erste deutschmennonitische Schule in Bolivien, die staatlich anerkannte Zeugnisse herausgeben kann.
In der neueren
Kolonie Cariño wird teilweise nach einem deutschen Schulprogramm aus Kanada gearbeitet.
In einigen Familien der
Kolonie Las Palmas wird in Hausschulen nach einem ähnlichen deutschen Programm aus Kanada gearbeitet wie in Cariño.
In einigen Familien, die auf Privatländereien neben den Kolonien oder in kleinen Städtchen in Miethäusern wohnen, wird nach Möglichkeiten der Eröffnung einer Schule gesucht.
In den meisten alten Kolonien gibt es Familien, die für ihre Kinder eine bessere Schule wünschen.
Es gibt eine begrenzte Anzahl von Lehrern in den alten Kolonien, die konkret an der Verbesserung ihrer Schulen arbeiten.
Dieses Panorama von verschiedenen Initiativen und Unterrichtsmaterialien passt einerseits gut in das Denken unserer Kolonisten hinein, dass eben jeder seinen eigenen Brei kochen darf, doch werden sie sich nur gemeinsam auf die Länge behaupten und entwickeln können. Damit wurde begonnen, indem wir schon etliche Zusammenkünfte mit den verantwortlichen Schulkomitees einiger Kolonien und Gruppen hatten, um gemeinsame Schritte in der Schulentwicklung zu erwägen. Nicht alle interessierten Gruppen machen mit, doch ist dies der Anfang.
Es wurde auf Wunsch von Buena Vista ein Projekt erarbeitet, wie sich diese Siedlung zu einem Schulzentrum für alle
Mennonitenkolonien in Bolivien entwickeln könnte. Diese Möglichkeit wird in drei klar abgegrenzten und doch sich ergänzenden Programmen gesehen:
- Die Schule mit einem staatlich anerkannten Lehrprogramm muss in den nächsten Jahren alle Schüler aufnehmen können, für die die Eltern eine bessere Bildung wünschen. Diese Schule sollte so schnell wie möglich bis zur 12. Klasse aufgestockt werden. Diese heutigen Schüler werden die Schullehrer und leitenden Personen nach 20 Jahren sein.
- Alle Schullehrer, die keine Ausbildung haben, aber an konkreten Verbesserungen in ihrem Schulwesen arbeiten, sollen durch Besuche und Kurse gefördert werden.
- Da in den Gemeinden und Gemeinschaften nur ein langsames Öffnen im Schulwesen zustande kommen kann, muss den interessierten Lehrern ein Material in die Hände gelegt werden, das von den Gemeinden und den Eltern angenommen wird. Deshalb wird die Materialbeschaffung für diese Schulen einen breiten und wichtigen Platz einnehmen müssen.
Für solche Pläne und Projekte sind die Kolonien aber von auswärtigem Fachpersonal und auswärtigen Finanzierungsmöglichkeiten abhängig und damit kommen wir dann zum letzten Punkt.
Der Platz der paraguayischen Mennonitenkolonien im Entwicklungsprozess der Mennonitenkolonien in Bolivien.
In welche Richtung und wie schnell sich die
Mennonitenkolonien in Bolivien auf den verschiedenen Gebieten entwickeln werden, wird daran liegen, von wo und in welcher Form sie Begleitung bekommen.
Meines Erachtens wäre eine nahe Begleitung von Seiten der
Mennonitenkolonien aus
Paraguay und besonders der Chacokolonien aus folgenden Gründen wünschenswert und zweckmäßig:
- Die beiden Länder Bolivien und Paraguay sind Nachbarstaaten. Daraus ergibt sich, dass die Situation der Kolonien im Kontext des Heimatlandes sehr ähnlich ist und manche Parallelen zu ziehen sind. Es ist dieselbe Landessprache, eine sehr ähnliche Landbevölkerung, sehr ähnliche Wirtschaftssituationen usw.
- Durch die Nachbarschaft werden beeinflussende Kontakte und konkrete Begleitung ohne zu große finanzielle Belastungen und Kulturschocks ermöglicht.
- Die plattdeutsche Sprache ist auf beiden Seiten die Umgangssprache und das Kolonie– und Gemeindeleben hat denselben Ausgangspunkt und Hintergrund. Wo die Mennonitenkolonien in Bolivien heute sind, da waren wir vor 50 oder 100 Jahren auch und dadurch gibt es besseres Verständnis füreinander.
- Wir stehen auf derselben Glaubensgrundlage und treffen uns auf dieser Ebene. Als Mennonitengemeinden und Mennonitenkolonien haben wir eine Verantwortung füreinander und wenn in unserem Nachbarland Mennonitengemeinden langsam verarmen und zerbrechen, wird das auch unser Dasein beeinflussen.
- In unseren Kolonien und Gemeinden haben wir viel gut vorbereitetes Personal auf den verschiedenen Gebieten.
Fussnoten:
| Lehrer und Prediger Sieghard Schartner ist gegenwärtig als Entwicklungshelfer des MCC in Bolivien tätig. |
Kulturelle Beiträge
Erlebnisse einer Neuländerin in einem Mennodorf
Sina Warkentin
Die sehr langsame Bahnfahrt in den
Chaco gab uns Gelegenheit, die Natur zu beobachten. Neben den dicken Flaschenbäumen sah ich auch Kakteen, so wie sie bei meiner Oma auf dem Fensterbrett gestanden hatten. In Puerto Casado entdeckten wir die verlockend aussehenden Feigenkaktusbeeren. Vorsichtig steckten wir sie in die Tasche und fragten den Fuhrmann nachher, ob man sie essen könne. Taschen und Körperteile waren aber schon voller kleiner Stacheln.
Auf dem Pferdewagen waren Erdnussballen als Pferdefutter, doch pflückten wir die kleinen Erdnüsse vom Stroh und verzehrten sie als Leckerbissen. Als wir abends ein Lagerfeuer machten, hat Peter Hiebert für uns Eier gebraten. Das war ein kostbares Essen, das wir lange nicht mehr gehabt hatten. Seine
Frau hat später öfters für uns Rührei zubereitet oder Eier gebraten. Mir war jedes Ei zu schade, das der Hund bekam. Schließlich hatte ich aber von den Eiern genug, denn inzwischen hatte ich zu viel davon gegessen.
In Edental waren damals nur sieben Bauernhöfe, die jungen Ehepaaren gehörten. Deshalb gab es da auch noch keine Schule für uns, und zum Gottesdienst fuhren wir nach Weidenfeld. Dort fiel uns besonders der Gesang mit dem Vorsänger und den langen Liedern auf.
In der Regel fuhren wir jeden Mittwoch zu Mutta-Großmama nach Weidenfeld, um von dort Trinkwasser zu holen. Da sie einen Verkaufsladen hatten, konnten wir dort jedes Mal reichlich
Candy im
Stoa essen. Ich empfand das freundliche Grüßen und gemütliche Spazieren als sehr angenehm. In Russland wurde ja nur gearbeitet, auch sonntags. Das kam damals auch in unseren Kinderspielen zum Ausdruck, wo wir in die Rolle der arbeitenden Mütter schlüpften. Im
Chaco wurde mir bewusst, dass zu einem gesunden und sinnvollen Leben nicht nur Arbeiten, sondern auch Ruhen gehört. Ich bin noch heute für die freien Sonn- und Feiertage sehr dankbar!
Da die jungen Bauern in Edental nur kleine Häuser hatten, wurde unsere
Familie aufgeteilt. Mein Bruder, Peter Hildebrandt, und ich blieben bei Hieberts, während meine Mutter und meine Cousine zu Peter Klassens kamen. Im Haus und im Garten lernten wir nun die verschiedenen Arbeiten kennen. Besonders glücklich war ich, dass ich Hieberts erstes Baby hüten durfte. Durch diese Trennung von meiner Mutter konnte ich mich von ihr lösen, denn auf der Flucht hatte ich immer mit ihr in einem Bett geschlafen. Manchmal hatten wir nur einen Mantel zum Zudecken gehabt. Im letzten Winter hatte ich ein graues Soldatenhemd umgeändert und in ein Kleid verwandelt. Welch ein Gegensatz war es, als nun
Frau Hiebert für mich vier hübsche Sommerkleider genäht hatte. Seither gehört ein neues Sommerkleid zu meinen Weihnachtserlebnissen.
Als im April 1948 mit Hilfe von Herrn Hiebert unser Häuschen in Friedensheim,
Kolonie Neuland, gebaut wurde, erkrankte zu Hause seine Tochter Sauna. Die Mutter fuhr mit ihrem Baby zu ihrer Mutter nach Weidenfeld, denn einen Arzt gab es damals in der
Kolonie Menno nicht. Aber selbst die beste Mutter konnte in solchen Fällen nicht immer helfen. Sauna starb über Nacht, noch ehe Vater Hiebert von
Neuland nach Hause gekommen war. Die Reise mit dem Pferdewagen hatte allzu lange gedauert. Damals starben viele kleine Kinder in
Menno an einer Krankheit, die starke Halsschmerzen hervorrief.
Meine Mutter war mit meiner Cousine Katja Willms bei
Familie Abram Klassen untergebracht, denn diese
Familie hatte bereits fünf Kinder, was mit viel Arbeit verbunden war. Für uns war es eine neue Erfahrung, am Familientisch einen Familienvater zu sehen, der im guten Sinne Anordnungen auf dem Hof und im Garten geben konnte. So ein riesiges Ehebett, wie die Klassens hatten, war uns bis dahin unbekannt. Besonders beeindruckte uns die darüber hängende Babyschaukel, in der die Mutter beim Liegen das Kind in den Schlaf schaukeln konnte. Heute weiß man, wie wichtig der Körperkontakt zwischen Mutter und Kind ist, wenn es angstfrei aufwachsen soll. In der Geborgenheit der
Familie erwirbt es ein Urvertrauen, das für das spätere Selbstvertrauen eine wichtige Voraussetzung ist.
Als wir in Edental waren, erkrankte Herr Klassen schwer. Er bekam Lähmungen und konnte nicht mehr gehen Es war erstaunlich, wie viele Leute am Sonntag bei Klassens zu Besuch kamen und mithalfen, wenn es nötig war. Für uns war das Leben bei und mit diesen Familien sehr wichtig, um uns in dem für uns neuen Land
Paraguay zurecht zu finden. Auf diese Weise lernten wir das praktische Leben in dieser neuen Umgebung kennen. Wir wussten nun, wie man hier im
Chaco lebt und arbeitet. Für mich war es eine wohltuende Erfahrung zu erleben, dass man ein willkommener Gast war, den man gerne wiedersehen möchte. Das war das genaue Gegenteil von dem, was wir als
Flüchtlinge auf unserem weiten Weg von Russland bis
Paraguay erlebt hatten.
Mit unseren Gastfamilien in
Menno sind wir immer in Kontakt geblieben. Als Kinder machten wir später mit dem Ochsenfuhrwerk eine Reise von Friedensheim in
Neuland nach Edental in
Menno. Einen ganzen Tag und eine Nacht waren wir unterwegs. Der Wagen war mit Kafirstroh, das als Futter für die Ochsen diente, gefüllt. Unterwegs diente es als Schlaflager, wenn einige von uns müde geworden waren. Tags liefen wir manchmal auch zu Fuß hinter dem Wagen her, wenn uns das Fahren zu langweilig wurde. Nachts zählten wir die vielen Königinnen der Nacht, die weiß aus dem dunklen Busch leuchteten. Wir zählten damals auf der Fahrt insgesamt mehr als 900 dieser Prachtblüten. Daneben erzählten wir uns auch Gruselgeschichten. Kein Wunder, dass wir immer sofort an einen Jaguar oder Puma dachten, wenn wir irgendwo im Dunkel ein paar Augen leuchten sahen. Viel konnten wir in der Dunkelheit allerdings nicht sehen, denn wir besaßen damals nicht einmal eine Taschenlampe. Die Reise lohnte sich trotz der Strapazen, denn in
Menno konnten wir uns einmal wieder richtig an Obst satt essen. Auch das Wiedersehen mit unseren guten Bekannten und Freunden tat uns gut.
Unterwegs hatten wir immer feste Standplätze, wo wir auf den Hof fuhren, um eine kurze Rast einzulegen und die Ochsen oder Pferde zu füttern und zu tränken. Ich denke manchmal, ob wir heute auch noch so bereit wären wie unsere Gastgeber damals, nämlich alles mit anfänglich ganz fremden Menschen zu teilen und sie für ein halbes Jahr in unser Haus aufzunehmen? Wäre diese Einstellung, wie sie damals in
Menno und auch in der
Kolonie Fernheim verbreitet war, heute noch in gleicher Weise vorhanden, so könnte viel Not und Elend in der Welt gelindert werden.
Fussnoten:
| Leicht gekürzter Bericht aus dem Vortrag vom 25.6.2001 in Loma Plata Sina Warkentin erlebte als Kind die Flucht aus Russland, sowie die Ankunft und Ansiedlung in Neuland. |
Wie vor hundertfünfzig Jahren … In einer russlanddeutschen Altväterschule im Chaco von Paraguay
Walter Quiring
Über drei Monate bin ich nun schon auf der Ansiedlung, aber noch ist es mir nicht geglückt, eine einzige Schule zu besuchen. Ganz planmäßig arbeite ich beim Lehrer des Dorfes, einem jungen Bauern, auf mein Ziel hin, aber als ich meine Bitte endlich vorbringe, ist er doch überrascht und bittet sich Bedenkzeit aus.
Ich weiß, dass er sich vorher mit dem
Prediger des Dorfes, einem misstrauischen, aber treuherzigen Menschen, verständigen will, doch auch dort habe ich vorgearbeitet, und meine Bitte wird gewährt.
Morgens regnet es leicht, und der Wind bläst kalt aus dem Süden. Solches Wetter erzeugt in diesen dürftigen Verhältnissen eine Stimmung der Miesepetrigkeit, die nur durch Einschaltung des Willens überwunden werden kann. Im Hause ist es genauso kalt wie draußen, denn Glasfenster und Öfen gibt es im
Chaco nicht. Die Menschen laufen in Jacken und Mäntel gehüllt einher, dabei aber sind die meisten barfuß.
Mein kleiner Freund Franz, der mir morgens beim Waschen immer das Wasser in die Hände gießt (die ganze
Familie ist trachomkrank), drückt sich vor Ungeduld die Nase platt an meinem Drahtgitterfenster und mahnt wiederholt schüchtern: „Onkel, de Leera jeet aul". Also los!
Auf der Straße hole ich eine Kindergruppe ein, die um eine tote Schlage herumsteht. „Habt Ihr die getötet"?, frage ich. „Ja, der Jakob hat das", erzählt zutraulich ein kleines Mädel, „mit der Tafel haute er ihr eins aufs Kreuz. Dann können sie nicht mehr kriechen. So tun die Indianer das auch…"
Der Jakob steht da wie ein kleiner Siegfried, vor Eifer und Stolz ganz rot im Gesicht. An seinen Backen bewundere ich die Dehnbarkeit der menschlichen Haut, so dick ist sie.
Wir gehen zusammen der Schule zu. Wie frisch die kleine Bande zwitschert und schwätzt. Völlig unbefangen geben sie sich, was sicherlich auch daher kommt, dass ich ihr Danziger
Plattdeutsch spreche. Ein prachtvolles Schülermaterial ist das, völlig gesund und unbelastet. Aber wie ein Krampf greift wieder an mein Herz das Gefühl, dass wir ein Volk sind ohne Raum und dass hier wieder einmal wertvolles deutsches Volkstum hinausgehen musste, das nun in diesem elenden Busch ein kärgliches Dasein fristest.
Der Lehrer steht schon wartend am Pult, als wir eintreten. Schweigend begeben sich die Kinder auf ihre Plätze. Auf den langen Bänken sitzen einige Kinder und lernen. Niemand spricht laut, obzwar der Unterricht noch nicht begonnen hat.
Das Schulzimmer ist auch von innen nicht geweißt. Vorn auf einer quer durch das Zimmer reichenden gemauerten Erhöhung, hier Katheder genannt, steht der Lehrertisch mit einem Pult und einer langen Bank, auf der sonntags beim Gottesdienst die „Vorsänger" sitzen. Links sehe ich einen offenen Schrank mit Schiefertafeln, Gesangbüchern und Bibeln. Vorn an der Wand hängt eingerahmt unter Glas in großes, bedrucktes Blatt, auf dem ich noch gerade entziffere „Schulregeln".
Flüsternd unterhalte ich mich mit dem Kollegen. Auf ein Zeichen drängen die Kinder in die Klasse, und der Unterricht beginnt. Der Lehrer holt das dicke Gesangbuch hervor, ein uraltes, und beginnt zu singen. Nach und nach fallen auch die Kinder mit ein. Vier Strophen werden gesungen, dann beten alle gemeinsam das Vaterunser, worauf stehend, wie jeden Morgen, in schaukelndem Rhythmus die „Schulregeln" wiederholt werden:
Das erste, was Du tust,
Wenn Du erwachest früh,
Sei ein Gebet zu Gott,
Kind, das versäume nie!
Dann stehe schleunig auf
Und biete guten Morgen
Den Eltern, die für Dich
In treuer Liebe sorgen.
Dann wasch’ und rein’ge Dich,
Zieh ordentlich Dich an,
Unreinlich darfst Du nie
Dich Deinem Lehrer nah’n…. und so fort – 23 Strophen.
Auch die Namen der Bibelbücher werden anschließend im Chor aufgesagt:
In des alten Bundes Schriften
Merke in der ersten Stell
Mose, Josua und Richter,
Ruth und zwei von Samuel,
Zwei der Kön’ge, Chronik, Esra,
Nehemia und Esther mit,
Hiob, Psalter, dann die Sprüche,
Prediger und Hohelied usw., insgesamt sechs Strophen.
Dann dürfen wir uns setzen; beinahe eine Viertelstunde ist bereits herum.
„Lesen", befiehlt der Lehrer, und alles greift hastig unter die Tische.
Es gibt in diesen Schulen nur vier Abteilungen: Fibler, Katechismer, Testamenter und Bibler.
Die „Bibler", die Oberstufe, zerren schwere Bibelfolianten hervor, während die anderen Testamente,
Katechismus und die Fibel vor sich bereitlegen. „Weltliche" Schulbücher – Lesebücher, Erdkunde-, Geschichts- und Rechenbücher – werden hier grundsätzlich nicht geduldet.
Zuerst lesen die Fibler. Alte Buchstabiermethode: hau, hau – au, au – te, te = haut (hat); de, de – au, au – es, es = daus (das)…
Das Hochdeutsche ist hier eine seltsame Ehe eingegangen mit dem Plattdeutschen: die Kolonisten sprechen auch im Hochdeutschen au statt a, also daus statt das, waus, Krauft, haute(hatte), gauns statt ganz usw. Für hochdeutsch u gerauchen sie ü, also Dü statt Du, Hüt = Hut, Wüt, Müt… Au wird von den Alten vielfach auch als äu ausgesprochen, z.B. äuf für auf, Häupt – Haupt, Gläuben – Glauben usw. Auch sprechen die Kolonisten statt hochdeutsch a z.B. vor g ihr Plattdeutsches öo; sagen heißt dann söogen (
Plattdeutsch sajen), Wöogen – Wagen, klöogen – klagen…
„Das ist das eigentliche Hochdeutsch", erklärt mir später kampflustig der Lehrer, „das allein richtige Hochdeutsch. Nicht Ihr in Deutschland, sondern wir hier im
Chaco sind die Träger des ursprünglichen Deutsch. Euch war die schlichte deutsche Sprache nicht mehr gut genug, Ihr wurdet stolz, und darum sprecht Ihr heute dieses komische Deutsch, das entstellte…."
Währenddessen lesen die anderen Abteilungen flüsternd vor sich hin. Von Zeit zu Zeit fährt dabei jemand in die Höhe und meldet: „Neues Wort"! Langsam begibt sich der Lehrer durch die Reihen zu dem Fragenden hin und spricht das „neue Wort" vor, ohne es jedoch zu erklären: Nebukadnezer, Zephanja usw.
Nach den Fiblern lesen nacheinander die Katechismer, Testamenter und die Bibler, während die Anfänger eine halbe Tafelseite vollschreiben sollen. Mich wundert die unnatürliche Stimmlage der Lesenden: das ist die Technik des überlieferten schleppenden Gesanges auf Lesen übertragen. Besonders kräftig betont werden aus irgendwelchen Gründen die Endsilben: hier wird die Stimme entweder stark gehoben oder auch gesenkt. Offenbar bleibt das dem Geschmack des einzelnen überlassen.
Die unruhigen Abc-Schützen stören übermütig. Längst haben sie die halbe Seite vollgeschrieben und schnellen der Reihe nach in die Höhe;
„Haub schon ne haulbe Seite voll, haub schon ne haulbe Seite voll…."
In der Klasse wird es immer kälter und ungemütlicher. Der Südwind streicht ungehindert durch die Drahtgitter. Zusammengekauert und fröstelnd sitzen die Kinder an den viel zu hohen Tischen.
Der Lehrer legt seit einiger Zeit Pausen zwischen die Stunden. Bis zu unserer Bekanntschaft hat er immer drei Stunden ohne Unterbrechung unterrichtet. Wer verschwinden musste, durfte sich melden.
Aber die Pausen sind nur sehr kurz. Das ist wie auf einer deutschen D-Zugfahrt: sobald die Reisenden eingestiegen sind, geht die Fahrt weiter.
Der Lehrer baut einen Stapel „Probeschriften" vor mir auf. Jeden Monat werden sie geschrieben und dem
Prediger zur Begutachtung vorgelegt. Die Schrift ist ordentlich und sauber.
Endlich ist es halb zwölf. Ganz steif sind wir von dem langen Sitzen geworden.
Die Kinder sagen gemeinsam das Einmaleins auf (abends zählen sie bis Hundert – vorwärts und rückwärts), und nach einer kurzen Andacht verlässt die kleine Gesellschaft ruhig und gesetzt die Klasse.
Langsam gehe ich auf der sandigen Straße durch das langgestreckte Dorf meiner Wohnung zu. So also sah es in einer preußischen Schule um 1789 aus. Mein Ideal ist diese Schule allerdings nicht, nein, wirklich nicht. Aber wenn ich mir die Menschen, die diese Altväterschule auch besucht haben, näher ansehe, komme ich doch zu interessanten Feststellungen.
Vom ersten Tage meines Aufenthaltes hier fiel mir das unbefangene Vertrauen dieser Volksgenossen zu ihrem Nächsten auf und die stete Hilfsbereitschaft die weit über eine gewöhnliche Gastfreundschaft hinausgeht. Immer wenn ich wieder weiterreisen muss, werden mir von verschiedenen Kolonisten im Dorf Fuhrwerke angeboten. Und eine Ochsenfahrt von 30 bis 40 Kilometer durch den engen Busch, über dem tagsüber die glühendheiße Chacosonne brütet, ist hier ein größeres Unternehmen als etwa eine Autofahrt von Berlin nach Hamburg.
Gekränkt sind die Siedler immer, wenn ich ihre Gastfreundschaft, die ich wegen meiner Arbeit manchmal 2 bis 3 Wochen lang in Anspruch nehmen muss, irgendwie vergüten will. Erstaunt und beschämt wehren sie dann ab: „Nein, nein, bezahlen, das gibt es bei uns nicht"!
Bei einem Vergleich – auch einem wirtschaftlichen – mit den Russlanddeutschen in dem benachbarten
Fernheim schneiden diese so zäh an der Überlieferung festhaltenden Siedler keineswegs schlecht ab. Und in
Fernheim sind die Schulen im allgemeinen auf der Höhe und brauchen hier und dort sogar einen Vergleich mit den Schulen im Reich nicht unbedingt zu scheuen.
Aber irgendwann einmal werden auch jene Kolonisten einer Auseinandersetzung mit der „Welt" nicht länger aus dem Wege gehen können, und es bleibt nur zu wünschen, dass sie sich selber bei den kommenden Kämpfen nicht aufgeben.
Fussnoten:
| Quelle: Post aus dem Osten, 8. Aug. 1936. |
Die zerbrochene Deichsel
Hans Krieg
Rebekka Frees ist die Tochter Abraham Frees’, des Jüngeren, und die Enkelin Abraham Frees’, des Älteren.
David Bergmann ist der Sohn Peter Bergmanns, des Predigers und der Enkel David Bergmanns, des Auswanderers.
Beide sind zweiundzwanzig Jahre alt, blond, fleißig und fromm. Seit einem Jahr sind sie miteinander verheiratet. Schon lange war das so ausgemacht, und es hatte sich zwischen ihnen nichts ereignet, was man eine Liebesgeschichte nennen könnte. Nun haben sie ein Kind, ein Mädchen. Alles ist in Ordnung.
Nein, nichts ist in Ordnung. Im Gegenteil, traurig sieht es aus um die beiden. Dass ihr Kind die Augenkrankheit hat, die bei den Mennoniten gang und gäbe ist, seit sie im
Chaco angesiedelt wurden, ist zwar ein Unglück, aber es ist doch nicht das Wesentliche. Da ist etwas anderes. Die Nachbarn merken’s nicht oder wollen’s nicht merken, und es gibt Zeiten, da merken sie es selber kaum. Denn sie arbeiten und sind des Abends müde. Man ist ja bei diesen Bauern nicht sentimental und nicht kompliziert. Man betet und singt Psalmen, man arbeitet und vermehrt sich. Punktum. Hader mit dem Schicksal ist Hader mit Gott; das gibt es nicht. Punktum. Und doch gibt es das. Ich will erzählen, wie es war und wie es ist.
Abraham Frees, der Ältere, lebt noch. Ich glaube, er ist der einzige unter den Kanada-Mennoniten im
Chaco, der noch die Zeiten erlebt hat, als die deutschen Mennoniten zum zweiten Male die Heimat wechselten und von der Ukraine und Sibirien nach Kanada gingen, um dort nach den Regeln ihrer Sekte leben zu können. Die Mennoniten sind ja Kriegsdienstverweigerer, und ihre Lehre bringt es auch sonst mit sich, dass gerade die Strenggläubigen unter ihnen immer wieder in neues Land ihre Pflüge setzen müssen, sobald das alte aufhört, ihre Besonderheiten zu dulden. Deutschland – Russland, das war der erste Wechsel; Russland – Kanada, das war der zweite, Kanada –
Chaco der dritte. Abraham Frees also, der Ältere, kann noch von Russland erzählen. Russisch hat er nie gelernt, auch in Kanada kein rechtes Englisch. Warum sollte er jetzt auf seine alten Tage noch Spanisch oder Guaraní oder gar die Lenguasprache lernen? Er bleibt wie alle seinesgleichen bei seinem alten
Plattdeutsch, kann in der deutschen
Bibel lesen und beim einstimmigen Gesang der Kirchenlieder mittun. Er versteht was vom Weizenbau und von Pferden und Rindern. Aber im übrigen will sein einfacher Geist nicht mit Dingen und Gedanken belastet werden, die das diesseitige Leben unruhig und das jenseitige ungewiss machen. Und so wie Abraham Frees, der Ältere, sind sie alle in seiner Sippe ein wenig stur, ein wenig engherzig und ein wenig bauernschlau trotz allem. Und sie sehen alle auf die Russländer mit leiser oder lauter Missbilligung, denn jene, die eine Generation länger in Russland geblieben und, ohne es zu wissen, ein wenig angekränkelt sind von den sogenannten Freiheitsgedanken unserer Zeiten, jene singen mehrstimmige Lieder, die weltlich klingen, ihre jungen Leute liebäugeln mit der Außenwelt, und ihre Lehrer sind neuerdings sogar nach
Asunción gefahren, um Spanisch zu lernen.
Es wird mit den Russländern drum ein schlimmes Ende nehmen, meint Abraham Frees, der Ältere, und verzieht streng sein altes, faltiges Bauerngesicht, das sonst immer so unbeteiligt und ruhig in die Welt sieht.
Die Russländer müssen durch einige Dörfer der Kanada-Mennoniten hindurchfahren, wenn sie mit ihren Ochsenkarren mühselig zur Endstation der Casadobahn reisen, um Weizenmehl und Zucker und andere Notwendigkeiten für ihre einsamen Dörfer zu holen. Die jungen Kerle, die auf den Karren hocken und lustig mit ihren langen Peitschen knallen, die schlagen nicht die Blicke nieder, wenn sie die blonden Kanadamädchen zum Ziehbrunnen gehen sehen, sondern rufen ihnen wohl sein paar herzhafte plattdeutsche Worte zu, und diese Worte haben sie nicht aus der
Bibel und nicht aus dem frommen Liederbuch bezogen. Dann werden die Mädchen rot und gehen rascher, denn es wäre undenkbar, dass eine von ihnen sich etwa mit einem der Russländer einließe, von denen man sich so unfromme Dinge zu erzählen weiß.
Nun muss man aber wissen, dass Rebekka Frees ein gesundes und hübsches Mädchen war, ehe sie die
Frau des David Bergmann wurde, und dass sie ein Erlebnis hatte kurz vor der Hochzeit, das ihr noch heute sozusagen in den Knochen sitzt.
Alles wäre gut gewesen, wenn nicht vor rund anderthalb Jahren am Ochsenkarren des Russländers Johann Klausner die Deichsel gebrochen wäre, gerade als er an der Zisterne eines Kanadierdorfes vorbeikam auf der Rückreise von der Bahn zu seinem Heimatdorf. Fünf Tage war er schon unterwegs gewesen, denn die Wege waren schlecht damals; seine Ochsen waren so schlapp, dass sie kaum mehr gehen konnten. Zwei Tagereisen mindestens musste er noch rechnen bis zu seinem Heimatdorf; denn es war eines der entlegensten.
Es blies ein schwerer, kalter Staubsturm von Süden her, der einem den Atem verschlug. Drum ließ er die Ochsen sich niedertun und flüchtete sich in den Windschutz des hohen Brunnenrandes.
Dort saß schon jemand. Dort saß Rebekka Frees mit ihrem großen Wassereimer und wartete auf das Ende des Sturmes. So kamen die beiden zusammen, und der Sturm und der Bruch der Deichsel hätten ihnen Glück bringen können, wenn sie beide Kanadaleute oder beide Russländer gewesen wären, und wenn es nicht zudem schon eine ausgemachte Sache gewesen wäre zwischen Rebekka Frees und David Bergmann.
Johann Klausner war ein lustiger Junge und hatte keine Angst vor den Mädchen. Er hockte sich neben Rebekka Frees und machte Späße, dass sie lachen musste. Da war ja weiter nichts dabei.
In wilden Stößen fegte der Pampero über das ebene Land, riss Äste von den beiden schlanken Urundeí-Bäumen, die dicht am
Brunnen standen, und es schien, als wolle er die phantastisch gewundenen hellen Stämme der Paratodos zu immer wilderen Formen verwirren. Hörbar rieselte und rauschte der Sand, den der Sturm teils in der Luft, teils am Boden vor sich her trieb. Himmel und Landschaft lagen in einem düsteren Gelb, und es war eine Stimmung ringsum, als wollte etwas Ungeheuerliches vor sich gehen. Rebekka Frees war zuerst erschrocken, als der junge Mensch dahergerannt kam und sich kurzerhand neben sie setzte. Aber dann sah sie seine blonden Haare, und es war ihr, als sei alle Drohung des Sturmes jetzt nicht mehr so schlimm. Wenn Mädchen ein wenig Angst haben, dann werden sie leicht zutraulicher, als es sonst ihre Art ist; deshalb lachte sie zu seinen Späßen, zuerst vor Aufregung über den Sturm und den fremden Mann, nachher vor Freude am Lachen und am Spaß. Sie hatte wohl seit Wochen niemals Grund und Gelegenheit zu Spaß und Lachen gehabt, denn so etwas war selten bei der
Familie Frees und bei allen andern Familien des Dorfes.
Warum soll man sich also sonderlich darüber wundern, dass sie sich schließlich über die Haare fahren und in die Augen gucken ließ, länger als für sie gut war?
Und als der Sturm aufgehört hatte, ohne dass die beiden es merkten, da hatte sie dem guten Jungen immer noch nichts von David Bergmann gesagt.
„Jetzt muss ich nach Hause gehen", sagte sie. Und er sagte: „Jetzt muss ich die Deichsel flicken". Sie trennten sich und hatten beide heiße Köpfe und waren ein wenig hilflos wegen des Neuen, das in ihr Leben gekommen war. Aber es war ja gewiss ein Erlebnis, wie es bei jungen Leuten eben vorkommt, und Johann Klausner sang und pfiff bei seiner Arbeit am Karren, sang und pfiff auch noch, als er mit dem ächzenden Wagen langsam weiterfuhr durch den Sand, fast die ganze Nacht hindurch. Erst am nächsten Tag begann er sich zu überlegen, wie diese Sache nun eigentlich weitergehen sollte. Er fand keine Lösung. Denn wie hätte er, der Russländer, sich in ein Kanadierdorf begeben können, um dort ein Mädchen zu besuchen?
Rebekka Frees aber wagte nicht, irgend etwas zu denken. Sie war ganz ohne Trost und ohne Phantasie, fühlte sich verworfen und elend, träumte vom Fluch des Predigers und des Großvaters und fand es ganz sicher, dass keine Qual der Hölle groß genug sei für ihre Verderbtheit. Sie heuchelte Tag für Tag und wagte kaum mehr laut zu beten und tüchtig zu singen in der Betstunde. Es grauste ihr vor sich selbst, wenn jeden Abend David Bergmann in allen Ehren seinen stillen, langweiligen Besuch machte, wie es Sitte war unter Brautleuten. Niemand hätte einen Funken von Verständnis für sie gehabt, wenn sie gesprochen hätte; und sie selber war zu fromm, zu schwerblütig und zu weltfremd, um über die Sache wegzukommen. Kläglich sah es aus mit ihr.
Und doch, Ihr mögt es glauben oder nicht, wurde später ihr Gesicht und ihr Wesen allmählich hochmütiger von Tag zu Tag. Durch ein kümmerliches kleines Fensterchen hatte sie einmal hinausgesehen aus dem eignen Alltag von Sippe und Dorf, und man könnte wahrhaftig meinen, das steige ihr jetzt, nach Jahr und Tag zu Kopf. Griesgrämig und fast hoffärtig sieht sie manchmal aus, als meine sie mehr zu sein, als die Menschen um sie her, und der arme David Bergmann hat mit seinen zweiundzwanzig Jahren eine
Frau, die viel, viel älter ist als er selber, ein müdes, kaltes Bauernweib.
Und doch ist ja auch sie nur zweiundzwanzig. Immer wieder bildet sie sich ein, dass sie es hätte anders haben können, frei, lustig und voller Abwechslung.
Denn sie hat erfahren, dass Johann Klausner von der Sekte abtrünnig geworden und auf einem Schiff nach
Buenos Aires gefahren sei. Dort sei er in einem Kaufladen angestellt, der in einem riesengroßen steinernen Haus liege, und in diesem Laden verkaufe er wunderschöne Anzüge, Hemden, Schlipse und bunte Flaschen mit wohlriechenden Wassern an Argentinier, Deutsche und Engländer. Abends gehe er durch die hellen Straßen als feiner Herr, trinke Bier und streue das Geld mit vollen Händen unter das Volk. So erzählt man sich’s in den Dörfern der Mennoniten im
Chaco. Es steht in einem Brief, den Samuel Frees, der Lehrer, bekommen hat von Jakob Zimmer, dem Händler in
Asunción. Und der hat es erfahren von Jonathan Zimmer seinem Vetter, der erst vor kurzem angekommen ist, und dem man es in
Buenos Aires gesagt hat auf der Agentur.
Die jungen Leute haben es überall herumerzählt. Wenn nach der Betstunde von diesem traurigen Fall unchristlicher Weltsucht gesprochen wird, dann sagt Abraham Frees, der Ältere, mit bösem, strengem Gesicht: „Ja, ja, es nimmt ein schlimmes Ende mit den Russländern. Drum betet, betet und arbeitet! Und fürchtet Gottes Zorn"!
Dann sehen die jungen Leute einander verstohlen an, und man hat fast den Eindruck, als teilten sie nicht ganz die strenge, fromme Meinung Abraham Frees’, des Älteren. Man könnte meinen, es glimme in ihnen ein ganz kleiner, zaghafter Funke des Widerspruchs. Manche sehen hinüber zur blassen Rebekka Frees, David Bergmanns
Frau. Es ist, als ahnten sie etwas von dem dummen kleinen Erlebnis, welches sie damals hatte an der Zisterne, als dem Russländer Johann Klausner die Deichsel brach.
Fussnoten:
| Quelle: Menschen, die ich in der Wildnis traf,Stuttgart, 1935. |
Die erste Fahrt in den Chaco
Cornelius W. Friesen
Weihnachten ist vorbei. Es war die erste in
Paraguay. Wie ganz anders aber war es als ein Weihnachtsfest in Kanada! Die Sonne scheint senkrecht vom Himmel, so dass es um die Mittagszeit keinen seitlichen Schatten gibt. Man kann des heißen Sandes wegen nicht ungeschuht gehen. In Kanada lag stattdessen der weiße, kalte Schnee und das glatte Eis, so dass wir Kinder der grimmigen Kälte wegen im warmen Haus bleiben mussten. Nur für gewisse kurze Stunden war es uns erlaubt, draußen im Freien auf den Schneedünen unsere angesammelte Energie im hurtigen Spiel zu verwerten. Auch die Weihnachtsbescherung war in den letzten Jahren dort reichlich und schön ausgefallen. Hier dagegen waren es jetzt einige wenige Süßigkeiten, die auffallenderweise alle einzeln in weißer Papierhülle lagen.
Auf unserem Hofe und auch in der Nachbarschaft standen Kirschbäume, die um diese Zeit für uns für eine angenehme Abwechslung sorgten: Glänzend schwarze Früchte mit milchigem, süßem Saft gaben die Bäume zu Tausenden her, wenn Stäbe die Zweige rüttelten. Stäbe, die von geschickten, flinken Jungenhänden mit wuchtigem Schwung in die Baumkronen geschleudert wurden. Um diese Zeit etwa saßen auf diesen Bäumen auch jene Zikaden und sangen ihre langatmigen, ohrenbetäubenden Lieder, die ihnen den ehrenvollen Namen „Wienachtstjnipasch" einbrachten.
Und nun soll es losgehen in den
Chaco. Die erste Strecke wird uns der „Zug" auf der
Schmalspurbahn, die vom Zentrum des Hafenstädtchens Casado unweit an uns vorbei in die Wildnis führte, mitnehmen. Dieser Zug kommt uns so klein vor, dass wir uns manches Mal über ihn lustig gemacht und ihn ausgelacht haben. Er ist ja kaum länger als er hoch ist. Beim Fahren keucht er, als wäre er ein Junges von einer Lokomotive in Kanada. Der Pfiff, der die Anfahrt meldet, könnte auch von einem kräftigen Knaben gekommen sein. Und die Waggons machten einen nicht besseren Eindruck. Aber das
macht uns nicht unglücklich, wir sind nur reichlich stolz auf unser Kanada und auf seine gewaltigen Züge. Welche Geschwindigkeit unser Zwergzug entwickelte, weiß ich schon nicht, aber als einem der großen Jungs der Hut vom Kopfe fliegt, springt er ihm nach, hebt ihn auf und schwingt sich beim Fahren ohne Schwierigkeiten auf eine der hintern „Karren".
Unsere wichtigste Beschäftigung auf der so geruhsamen Reise, die mit dem Lokomotivlein beim Hafen beginnt, besteht darin, dass wir alle Brücken der
Eisenbahn und alle für den
Chaco typischen dickbäuchigen Flaschenbäume, die wir zu Gesicht bekommen, zählen. Dass es solche höchst seltsamen Bäume überhaupt irgendwo in der Welt gäbe, hätten wir nicht einmal ahnen können. Wir waren ziemlich zuverlässig, jeden neu entdeckten Baum unserer bisherigen Zahlenreihe hinzuzufügen.
Als wir die damalige Endstation, wahrscheinlich Km 74, erreicht haben, sollte die Geschwindigkeit noch um ein Bedeutendes herabgesetzt werden, denn von nun an sollten die Ochsen das Tempo weitgehend bestimmen. Wir hatten vier Ochsen, die von andern Männern vorher schon zugbändig gemacht worden waren: Prinz und Taum; Jim und Schale. Unsere Sachen werden nun auf einige Wagen verladen, und im Schneckentempo geht’s unserer neuen Heimat zu. Unserer kränkelnden Mutter wird die Fahrt dadurch sehr erleichtert, dass sie im weichen Federsitz unseres sanftfedernden Buggys ihren Platz haben darf. Auch von uns Kindern darf einer von den Kleineren hier mitfahren. Aber das ist uns nicht so wichtig, als dass wir jetzt nach Belieben auf den Füßen sein dürfen und die Karawane durch Gras und Busch begleiten, laufend, spielend, lachend und zankend. Dieses Letzte natürlich nicht mit Erlaubnis, und auch ohne es dafür zu halten, dass es gezankt wäre. „Daut doni onsi Jungis uck so en want omm en tjlienet Schweldostji jeit", hörte ich Onkel Harder sagen, einen dicken, etwas ulkigen Herrn, als er und unser Vater neben den Wagen hergehen und unsern zu heftigen Wortwechsel vernehmen. In
Laguna Casado holen wir wieder unsere kanadischen Nachbarn Hieberts ein. Sie wohnen, wenn ich mich recht entsinne, mit einer kleinen Gruppe Familien am Buschrande, einer längeren Lagune gegenüber. Es ist schon nicht mehr weit bis zu unserem vorläufigen Ziel,
Pozo Azul. Bald schleppt sich unsere Karawane wieder langsam weiter, und dann sind wir da, wo wieder alles abgeladen und in den Zelten untergebracht wird.
Hier sollen sich wieder einige der ersten Eindrücke festsetzen. Dazu gehören die Polvorinos, diese fast pulverfeinen, brennend stechenden Flieglein. Nicht nur einzelne von ihnen tauchen auf, sondern viele. Für solche, die an windgeschützter Stelle ihre Arbeit zu verrichten haben, ist das höchst ungemütlich. Glücklicherweise aber hat man schon ein wirksames Abwehrmittel gefunden: „De Pilisaunta Rüak". Vor diesem wohlriechenden, aber auch alles anschwärzenden Qualm des noch ungetrockneten Palosantoholzes scheinen sie zu weichen. Vielleicht hat der Genuss des Duftes allein schon ein gut Teil mit dazu beigetragen, das Ungeziefer zu vergessen. Denn wenn er heute gelegentlich meine Riechnerven berührt, werde ich urplötzlich in jene Buschecke in
Pozo Azul versetzt.
An unserer Wohnung vorbei führt der Weg zum
Gemeindegarten. Dort hat man verschiedene Feldfrüchte angepflanzt: Mais, Erdnüsse, Mandioka und Wassermelonen. Vielleicht auch noch anderes mehr. Hier genieße ich zum erstenmal die bewundernswerte Schönheit einer Mandiokapflanze. Ihre viellappigen, so saftig grünen Blätter strecken sich an ihren langen rötlichen Stengeln wie offene Hände dem Besucher entgegen. Eine andere Pflanze, die mir besonders auffiel, ist die Erdnussstaude. Dass die „Pienitz" von solchen kleinen, dunkelgrün beblätterten Pflanzen herkommen sollten, hätten wir nicht einmal ahnen können. Und dann noch unter der Erde. Eine andre Saite meines Herzens wird von einem Konzert kleiner Frösche berührt. Meine älteren Brüder mit noch anderen zusammen treiben eines Morgens eine Viehherde in Richtung „Km 9" auf die Weide. Ich darf diesmal auch mit. Von Km 9 laufen Geschichten, dass dort Tiger wären. Mir bangt von vornherein bei dem Gedanken, dass eines von solchen gefährlichen Tieren uns an dem Wege auflauern könnte. Gleich außerhalb unseres Siedlungslagers müssen wir das knöcheltiefe Wasser einer flachen, von Algorrobobäumen bestandenen Niederung durchwaten. Das ist ein gesuchter Ort für die Frosch- und Krötenwelt. Aber hier hämmert und dröhnt nicht der Ochsenfrosch. Hier johlt und quakt keine andre Kröte als nur diese eine Gruppe, deren Herz allzu stark zu klopfen scheint, weil sie anscheinend auch um unsere Tigergeschichten weiß. In hohem Ton schlagen sie ihre Stimme an und ziehen sie zitternd in weitem Bogen niederwärts. Genau meinen beängstigenden Gefühlen angepasst. Es hat sich aber kein Tiger gezeigt. Nicht selten hat später so eine wehmütig klingende
Musik mich zurück nach
Pozo Azul getragen.
Hier haben wir auch den sisalartig feinblätterigen Faserkaktus kennengelernt. Die Gleichaltrigen unsres Herrn Harder sind dabei unsre Lehrer. Sie hatten nämlich jeder eine hübsch gedrehte Peitsche, die nach unten hin immer dünner wurde. Was wir an diesen Peitschen am meisten liebten, ist, dass sie unsern Drang nach Lärm ein Etwas befriedigen können. Wenn die anderen sonst nicht allzu sehr nach Stille und Ruhe sind, müssen die Peitschen knallen. Schlag auf Schlag durchhallt es
Pozo Azul, und nicht selten schneidet sich der Schlussknoten ab und fliegt pfeifend durch die Luft. Ein andres Mal befestigen wir andere Gegenstände am unteren Teil der Peitsche und schleudern sie durch die Luft, dass eine Gummischleuder ihre Küglein nicht weiter zu treiben vermag. Das aber ging nicht immer mit geborgten. Wir müssen unsere eigenen haben. Und nun wird der sonst so dornige Krüppelwald zu einem wertvollen Arbeitsplatz, an dem wir gerne in unseren freien Stunden verweilen. Nicht aber, um dort herumzutollen, sondern um das kostbare Strick- und Peitschenmaterial aus der Erde zu ziehen und nach Hause zu tragen.
Später im Dorf haben wir solche Faserblätter nach Hause geholt. Hier wurden sie über einen platten Drahthaken gezogen und so die Fasern von der äußeren Hülle freigelegt; darauf in der Sonne getrocknet und verarbeitet. Die Stricke fanden ihre Verwendung beim Umgang mit Rindern und Pferden. Wir machten uns davon Schaukeln und zogen damit Wasser aus den tiefen
Brunnen hoch. Sogar gab es dann und wann etwas Taschengeld für den Vater.
Die Hauptsache für uns Knaben aber lag in der Arbeit, die unsern Spieldrang befriedigte. Manchen Tag sind wir in den 500 Meter entfernt beginnenden Krüppelwald gegangen und haben ihn nach den besten „Kaktusplacke" durchstrichen. Dass die Finger von den vielen nadelspitzen Widerhaken ganz aufgerauht und stellenweise bis auf Blut verwundet wurden, tat der Sache keinen Abbruch.
Und nun wandern wir in Gedanken noch einmal zurück nach
Pozo Azul. Auch hier sorgten die Väter dafür, dass wir das Lesen und Schreiben nicht ganz vergäßen. Unweit der im Zentrum gelegenen Lagune hatte man einen Schuppen für Versammlungen errichtet, den wir auch als Schulraum nutzten. Unser Lehrer war hier der schwerhörige Onkel Abram Töws. Er war schon mein siebenter Lehrer. Es lässt sich denken, dass wir hinter seinem Rücken seine Schwerhörigkeit freudig begrüßt und ausgenutzt haben, interessanteren Beschäftigungen als Lernen nachzugehen.
Etwa 3 Monate haben wir uns hier nun aufgehalten, und nun soll’s weiter nach dem Dorfe Osterwick gehen. In Kanada hatten die Eltern immer in Osterwick gewohnt, und das soll hier nun so weitergehen. Jetzt wird alles wieder auf Wagen verstaut, der Federwagen wieder einem Wagen angehängt, die Kuh, die alte Rote, mit ihrem großen Kalb am andern Wagen befestigt, und nun geht’s nach Hause. Diese Wegstrecke aber ist mir restlos aus dem Gedächtnis entschwunden.
Als wir auf dem Osterwick-
Kamp ankommen, nimmt unser Zug einen neuen, geradeaus nach Süden führenden Weg, der zukünftigen Dorfstraße und biegen dann bald nach rechts ab auf unsere Hofstelle. Dass es hier noch wo einen zweiten Einwohner geben soll, das vermögen die Augen nicht auszumachen. Der
Kamp ist so dicht mit Bäumen und Büschen bestanden, dass man einen Nachbarn von 150 Meter Entfernung wohl kaum sehen könnte.
Das Erste muss nun der Spaten dran, die dicht bei dicht stehenden Bittergrasbüschel „üttostätje". Denn Herd und Zelt könne nicht im tiefen Grase aufgestellt werden. Auch für die Kisten und für das Hausmöbel muss ein sauberer Platz da sein.
Als das geschehen ist, wird ein kleiner Graben ausgehoben, der schmaler ist als die mitgebrachte Ofenplatte, aber etwas länger. Die Endöffnungen dienen nun als Ofentür und Schornstein. In stark gebückter Haltung muss die Mutter das Rührei zubereiten. Der Rauch schwärzt keine Wand oder auch kein Dach an, um so mehr aber alles Ofengeschirr und den Koch. Wir Jungens arbeiten nicht schwer, stehen aber am Tisch beim Essen keinem nach. Was Mutter aufträgt, wird von uns mit Riesenappetit verzehrt. So wenig wie wir Schwerarbeiten verrichten, werden wir auch von Sorgen gequält. Den Schatten und die Ruhe brauchten wir nur, wenn es nötig war oder wenn es uns befohlen wurde.
Wir wissen bald, welche Bäume sich am leichtesten erklimmen lassen und wie tragfähig ihre Äste sind. Die Quebrachobäumchen schützen sich mit ihren Stacheln vor unseren Belästigungen. Dafür aber müssen die beindicken Paratodobäumchen herhalten. Wir haben es nämlich schon bemerkt, dass hier viel auf Pferden und Maultieren geritten wird. Und da das nicht Stillesitzen bedeutet, eignet sich dazu nicht irgendein fester Baumast. Die hätten wir schon. Aber Pferde und Esel nicht, und da muss ein Ausweg gefunden werden. Und auch das haben wir in den freien Stunden bald geschafft. Die erwähnten Paratodobäumchen haben federnd biegsame Stämme. Wenn wir sie erklettern, geben sie dem Gewicht unserer Körper nach und biegen um, und bald schlägt ihre Krone am Boden auf. Um nun wie im Galopp wieder hochzufahren, geben wir mit den Füßen genügend Schwung, und in hohen Sprüngen tragen uns unsere tapferen Pferde den Viehherden nach, die kein anderer sieht als wir allein.
Den ersten lustigen, vielstimmigen Freudengesang des Krötenreichs, wie er heute auch nach schönen Regen nicht lieblicher sein kann, hörten wir in Osterwick einige Tage nach unserer Ankunft. Es war in dieser Nacht unser Nachbar Onkel Peter mit einigen anderen Männern angekommen. Wir haben es nicht bemerkt. Zu gleicher Zeit zieht auch ein Sschöner Regen übers Land. Da unser Zelt aber schon schadhaft geworden ist und das Wasser durchlässt, haben die Eltern über die Sachen drin und auch über unsere Betten eine zweite Plane ausgebreitet.
Morgens, als wir aus unserm Versteck hervorkommen, ist schon einer jener Männer da. Er grüßt uns mit seiner tiefen Bassstimme in barschem Tone: „Nü koome di Moldwarm fedäl!"
Tausenden solcher kleinen und noch kleineren Erlebnissen sind wir begegnet, die uns Großen nichts mehr bedeuten, damals aber oft höchst wichtig und lebensbereichernd erschienen. 47 Jahre trennen uns nun schon von jener Zeit, und vieles ist anders, ganz anders geworden. Dass uns manche Kleinigkeit heute weniger Freude bereitet, gehört nicht unbedingt zur guten Veränderung, vielmehr ist es ein Verlust. Die Pflanzen- und Tierwelt will auch heute noch unsere beglückende Lebensbegleiterin sein. Wenn sie das darf, wird sie uns zu manchem Abstecher in echte, wenn auch zeitlich vergängliche Freudenstunden verhelfen, die aber in engem Zusammenhang mit der Freude im Herrn steht. Freude im Herrn ist nicht blind für die unzähligen Gaben des Zeitliche
Fussnoten:
Das Tagebuch
Eugen Friesen
Anne staubte das alte Heft, welches sie eben aus der von Mäusen angenagten Schachtel genommen hatte, mit der Hand ab. Da lag es nun vor ihr, dieses kleine vergilbte Heft. Sie kannte es. Vor über zwanzig Jahren hatte sie es zum letzten Mal gesehen. Damals hatte sie einen Blick hinein werfen wollen, war jedoch von ihrer Mutter dabei ertappt worden und hatte es rasch wieder zurück ins Regal gestellt. Später hatte sie es wieder versuchen wollen, doch dann war das Heft verschwunden und sie hatte sich nicht getraut, danach zu suchen. Doch jetzt hatte sie alle Freiheit, es zu lesen. Sie räumte sich zumindest dieses Recht ein. Ihre Mutter war zwei Monate zuvor gestorben. Anne war gerade dabei, die Sachen der Verstorbenen zu ordnen, zu säubern und zu sortieren. Dabei war ihr dieses Heftchen in die Hände geraten. Als sie es sah, bekam sie Schuldgefühle, wie damals. Ihre Mutter hatte es ihr damals strikt verboten, darin zu lesen. Während sie das Heft in der Hand hielt, wanderten ihre Gedanken zurück an den Tag, an dem ihre Mutter gestorben war. Es war an einem regnerischen Sommermorgen gewesen, als das
Telefon sie aus dem Schlaf riss. Missmutig hob sie den Hörer ab und meldete sich. „Hallo, hier Anne. Was gibt’s?" Als sie den Hörer nach wenigen Sekunden wieder auflegte, war jegliche Farbe aus ihrem Gesicht gewichen. Sie schlug sich mehrere Male an die Backe um sich zu vergewissern, ob sie wirklich wach war oder ob sie Hauptdarstellerin eines Alptraums sei. Erst als sie im Bad stand und ihr Gesicht gewaschen hatte, wurde ihr bewusst, dass es sich weder um eine Illusion noch um einen Traum handelte. Es war also wirklich geschehen. Wie oft hatte sie sich vor diesem Moment gefürchtet.
Bevor die vier Männer den Sarg ins Grab herunterließen, gab Anne ihrer Mutter den letzten Kuss auf die Stirn und nahm noch einmal Abschied. Die Leute standen neben ihr und versuchten sie trösten, aber es wäre ihr tausendmal lieber gewesen, wenn man sie alleine gelassen hätte. Sie brauchte ein paar Minuten, wo sie noch einmal mit Mutter alleine sein konnte. Wie gerne hätte sie noch einige Worte mit ihrer Mutter über die Dinge gesprochen, die sie solange verdrängt und die jetzt wieder an die Oberfläche gedrungen waren. Der zarte Duft der Rosen schien Anne noch mehr zu betäuben und zu verwirren. Alles schien ein Traum zu sein. „Wäre es doch ein Traum, so könnte ich aufwachen und das Leben ginge normal weiter, als ob nichts geschehen wäre. Doch es ist etwas geschehen und das Leben wird weitergehen, aber es wird nie wieder so sein, wie es früher war." Wie hatte sie ihre Mutter geliebt, und jetzt war so plötzlich alles aus. Noch am Vorabend hatten sie zusammen einen Kaffee getrunken. Etwa um neun Uhr hatte sich die Mutter von ihr verabschiedet und war mit leichten Kopfschmerzen ins Schlafzimmer gegangen. Anne hatte sich noch kurz mit ihrem Vater unterhalten und war dann nach Hause gefahren.
Wie üblich hatte die Mutter sich von ihr mit einem „Gott segne dich" verabschiedet. Für Anne war dieser Gruß ein Brauch geworden, den sie über sich ergehen ließ, der sie jedoch immer kalt gelassen hatte. Ja, ihre Mutter hatte an Gott geglaubt, aber sie? Sie hatte es zwar versucht, aber sie war nie perfekt gewesen und würde es auch nie werden. Außerdem sollte sie so vieles Liebgewordene aufgeben, und dazu war sie nicht bereit. Mutter hatte für den Glauben gelebt, und sie war ständig von ihm überzeugt gewesen. Gott war wohl nur für die schwachen und hilflosen Menschen da. Jedenfalls für die Fehlerlosen. Das war dann doch nichts für sie. Jemanden wie sie brauchte Gott bestimmt nicht.
Doch ihre Mutter war weder schwach noch hilflos. Ganz im Gegenteil, sie war ausgeglichen, stark und freundlich, und hatte doch an Gott geglaubt. Ihr Verhalten, ihr Reden, ihr Handeln, alles war so rätselhaft, so liebevoll, selbstlos gewesen. Anne hatte immer gedacht, diese Ausgeglichenheit sei eine Frage des Charakters oder der Persönlichkeit gewesen. Doch jetzt, wo sie am Grab ihrer Mutter stand und die angenehme, kühle Luft einatmete, dachte sie über diesen „`Gott segne dich’ Gruß" nach. Die Gesichtszüge der Mutter sahen entspannt aus. Ein Lächeln spielte um ihre Lippen und ein Abglanz tiefen Glückes und unbeschreiblicher Freude lag auf dem Gesicht der Verstorbenen.
Welch großer Schlag war der Tod der Mutter für sie gewesen. Anne wischte sich die Tränen aus den Augen und schaute wieder auf das Tagebuch. Vorsichtig öffnete sie es und fing an zu lesen. Die Schrift war durch den Lauf der Zeit beinah unleserlich geworden.
Die Eintragungen des Heftes fesselten Anne. Von Zeit zu Zeit musste sie sich die Augen abtrocknen, denn die Tränen ließen sie das Bild nur verschwommen wahrnehmen. Wie viel Leid und Sorgen musste die arme Mutter wegen ihrer widerspenstigen Tochter erlitten haben. Das erkannte sie erst jetzt. Sie hatte immer gedacht, dass Mutter sich keine Sorgen um sie gemacht hatte. Nie hatte sie Vorwürfe gehört. Doch was sie hier las, schien nicht von ihrer Mutter geschrieben worden zu sein. Viele Einträge waren verzweifelte Hilfeschreie. „Mama verzweifelte an meiner Dickköpfigkeit. Aber nicht nur daran. Auch der Glaube hat sie viele Tränen gekostet. Am eigenen Leib musste sie erfahren, was es bedeutet, zu entbehren."
Anne merkte plötzlich, dass auch die Mutter nicht ein leichtes Leben gehabt hatte. Nicht immer war sie von ihrem Glauben so überzeugt gewesen wie Anne angenommen hatte. „Auch Mama hat gezweifelt. Auch sie war nur ein Mensch, der ständig nach der Wahrheit suchte." Anne musste die Lektüre beenden, denn sie konnte ihre Gefühle nicht mehr kontrollieren. Sie fühlte sich leer, verlassen und fing an bitterlich zu weinen. „Warum hat Mama nie mit mir über ihren Glauben gesprochen? Wollte sie mir nicht das Bild von ihr vermitteln, dass auch sie Momente erlebte, in denen sie an allem zweifelte? Ach, wenn sie sich doch mit mir unterhalten hätte, wie vielem hätte vorgebeugt werden können." Wie sehr bereute sie es, nie mit ihrer Mutter über den Glauben gesprochen zu haben. Jetzt erst wurde Anne bewusst, dass nicht derjenige ein Christ ist, der problemlos durch die Welt wandert und schöne Worte spricht, sondern derjenige, der trotz schwerer Situationen bestrebt ist, sich selber und Gott gegenüber ehrlich und offen zu sein. Plötzlich merkte sie, wie sich ihr Herz entspannte und wie eine unbekannte Ruhe über sie kam. Anne faltete ihre Hände, kniete auf den Boden und betrat in diesem Moment den Weg, den ihre Mutter vor ihr gegangen war.
Fussnoten:
| Eugen Friesen ist Student der Literaturwissenschaft an der Nationalen Universität, Asunción. |
Durchkreuzte Pläne
Eugen Friesen
Es war an einem Dienstag Nachmittag, als Ralf den Neugeborenen unbeholfen in seinen Armen hielt und mit gerührter Stimme zum ersten Mal „mein Sohn" sagte. Jetzt war es mit der Ruhe im Haus, falls es so etwas überhaupt gab, wohl vorbei, dachte der knapp neunzehnjährige frischgebackene Vater. „Ach, was soll’s. Andere haben es ja auch geschafft. So schlimm kann es doch auch nicht sein."
Auch die Großeltern beiderseits waren erschienen und bewunderten den kleinen Thronfolger. Jetzt würde doch alles gut werden. Die Verzweiflung, die sie bei der Trauung ihrer Kinder vor sieben Monaten gefühlt und die sie nicht zu verbergen vermocht hatten, war wie abgewischt. Der Neuankömmling hatte etwas Magisches an sich, das alle Sorgen, Befürchtungen und Beschuldigungen zumindest vorläufig in den Hintergrund zu stellen schien.
Das jungvermählte Ehepaar wohnte in einem nahegelegenen Dorf. Johannas Vater hatte ihnen eine Wirtschaft gekauft. Langsam hatten die beiden sich auch daran gewöhnt, dass es einen Dritten im Hause geben würde. Zuerst war der Schock groß gewesen. Er war erst achtzehn, sie stand kurz vor dem siebzehnten Geburtstag. Alle Zukunftspläne waren erschüttert, wenn nicht sogar zerstört worden.
Die Leute des ganzen Bezirkes munkelten, dass es wohl bald eine Hochzeit geben müsse, denn Johanna und Ralf hatten sich fürs nächste Tauffest angemeldet. Das war Grund genug zu dieser Annahme. Bestätigen konnte es jedoch niemand, bis man einige Wochen später die Nachricht von der Kanzel vernahm: „Johanna und Ralf geben ihre Verlobung bekannt und befehlen sich der Fürbitte an."
Jetzt wurde den Gerüchten freier Lauf gegeben und jeder sprach davon, dass die beiden eigentlich überhaupt nicht hätten heiraten wollen, aber den Kindern zuliebe tue man doch irgendetwas. Auch die Angelegenheit mit der
Taufe wurde von vielen sehr skeptisch beobachtet und als eine Farce gedeutet. Manche äußerten sogar in ironischem Ton, dass es doch komisch sei, dass man noch kurz vor der Hochzeit zur Einsicht komme und das Ganze noch von Gott gutheißen lassen wolle.
In jeder Tererérunde unterhielt man sich über dieses Ereignis, und jeder wusste noch eine Neuigkeit beizutragen. Es dauerte allerdings nicht lange, bis die Geschichte von Ralf, Johanna und dem kleinen Tim in Vergessenheit geraten war. Die ständigen Ereignisse dieserart erlaubten es niemandem, sich über unbegrenzte Zeit mit einem einzigen Fall zu beschäftigen. Es wäre doch die reinste Zeitverschwendung gewesen, wenn man nur über diese eine „Blitzheirat", wie sie von vielen genannt wurde, diskutierte.
Die Dorfbewohner nahmen alle Fälle unter die Lupe und analysierten jede einzelne der betroffenen Familien um festzustellen, wem man wohl die Schuld in die Schuhe schieben könne. Immer fand man jemanden. Manchmal waren es die Eltern des Mädchens, die dem Pärchen erlaubten, sich zu treffen, wann immer es wolle. Manchmal traf die Schuld die Eltern des Jungen, weil sie sich ständig in den Haaren lagen und ihrem Sohne keine Werte mitzugeben vermochten. In einigen Fällen beschuldigte man die Braut, ihrem Freund eine Falle gestellt zu haben, um ihn für sich sicherzustellen. Oft kam man auch zu der Schlussfolgerung, dass es wohl ein Plan der beiden Jugendlichen gewesen sein könnte, die keine andere Lösung gefunden hätten, um sich von der ständigen Nörgelei der Eltern zu befreien und ein Leben in Freiheit führen zu können. Irgend jemand musste doch Schuld an der Situation haben.
Auf jeden Fall schufen diese Art von Ereignissen in der
Kolonie immer Gesprächsstoff und der Blick wurde von den eigenen Problemen auf die der anderen gelenkt. Dadurch wurde auch das eigene Leben viel schöner und angenehmer, und die eigenen Fehler waren nicht so auffällig.
In seiner frühesten Kindheit war Tim ein fröhlicher Junge und er fühlte sich wohl in seiner
Familie. Doch als er fünf Jahre alt war, erlebte er seine erste große Enttäuschung. Ralf hatte manche Dinge gesagt, die er nicht verstand. Und zwar hatte er diese Dinge in einem sehr unfreundlichen Ton gesagt. Das stand fest. Das spürte sogar der Fünfjährige und er hörte das Schluchzen der Mutter. Ob sie sich ungefähr so fühlt, wie ich mich in der letzten Woche fühlte, als die großen Jungen aus der Schule mir und Bert mit Prügel drohten? Dabei war es doch nur ein Zufall gewesen, dass sie mit angesehen hatten, wie die Jungen in der Pause hinter einem dichten Gebüsch eine Zigarette geraucht hatten. Aber wenn Mama sich jetzt so fühlt, dann muss es ihr sehr schlecht gehen.
Tim saß gedankenverloren auf seinem Bett. Hin und wieder drangen Wortfetzen zu ihm durch, denen er aber keine Beachtung schenkte. Er war einfach zu traurig. Er wollte nichts hören. Ihm war übel und er fing an zu weinen. Mama und Papa verstehen sich nicht. Das war Grund genug, traurig zu sein. „…ich hab’s satt…nur geheiratet, weil du nicht aufpassen konntest… nie wieder…" Tim hörte diese Worte, aber er verstand sie nicht. Worüber ist Papa nur so böse? Und weshalb hat Mama nicht aufgepasst? Irgendetwas sehr Schlimmes muss da passiert sein. Inmitten dieser Gedanken war er eingeschlafen. Er wachte noch einmal auf, als irgendwo eine Tür voller
Macht ins Schloss fiel, schlummerte jedoch sofort wieder ein.
So waren die Jahre verstrichen und diese Art von Diskussionen hatten sich allmählich in die Tagesordnung dieser
Familie eingeschlichen. Natürlich war es auch für Ralf und Johanna keine angenehme Lage. Aber sie hatten alles versucht. Zumindest fast alles. Hilfe bei einem Fachmann hatten sie nie gesucht. Das ist etwas für Schwächlinge. Was werden bloß die Leute von uns denken, wenn sie erfahren, dass wir bei einem Seelenarzt gewesen sind? Irgendetwas war in ihrem Leben schiefgelaufen. Beide vermuteten, dass ihre überstürzte Heirat damit zusammenhing. Oft war sie Thema der Diskussionen gewesen. Mehr als einmal hatte Johanna Ralf mit Fragen bombardiert. „Waren wir wirklich füreinander bestimmt? Hättest du mich auch geheiratet, wenn nichts dazwischen gekommen wäre? Liebtest du mich wirklich oder hast du mich nur geheiratet, weil alle auf uns schauten und es dir einen schlechten Namen eingebracht hätte, wenn du mich sitzengelassen hättest?" Viele Fragen dieser Art drangen immer wieder hoch und nagten wie ein bösartiger Krebs an der Beziehung. Das hatte zur Folge, das Johanna meist nervös und oft stark depressiv war, Ralf hingegen widmete sich immer mehr seiner Arbeit. Seltsamerweise war jedoch Tim derjenige, der sich immer stärker für diesen Zustand der Ehe seiner Eltern verantwortlich fühlte. Er wusste nicht warum, aber er fühlte es. Und er konnte nichts dagegen tun.
Ralf wollte zumindest die Beziehung zu seinem Sohn retten. Doch auch da stieß er immer wieder auf Schwierigkeiten. „Ich müsste eigentlich viel mehr Zeit mit meinem Sohn verbringen. Ich hätte gerne eine Vertrauensbeziehung zu ihm aufgebaut, doch ich fühlte mich nie fähig dazu. Ich habe mich nie getraut, mich mit ihm über Partnerschaft und Ehe zu unterhalten. Was hätte ich ihm auch schon von einer gesunden Partnerschaft sagen können. Wie gerne würde ich ihm die Wahrheit sagen und ihm helfen, nicht dieselben Fehler zu begehen. Aber wie wäre seine Reaktion gewesen, wenn er erfahren hätte, was zwischen Johanna und mir alles gelaufen ist, und dass er der Grund unserer Heirat war? Nein, da ist es doch besser, dass wir etwas distanzierter voneinander leben und niemand schneidet sich in die Finger. Er wird schon alleine seinen Weg finden müssen. Er schafft das schon. Er ist ja jetzt in der 6. Klasse der
Zentralschule. Er hat es schon weiter gebracht in der Schule als ich."
Johanna plagte sich mit ähnlichen Fragen herum, aber auch sie war sehr vorsichtig in ihren Äußerungen und achtete ständig darauf, Tims Sympathie und Unterstützung zu bekommen. So glaubte sie zumindest einen kleinen Ersatz von dem zu haben, was sie verloren hatte. Vielleicht hatte sie es auch nie besessen.
So ging jeder seinen Weg und versuchte, sein Leben möglichst gut zu meistern. Ralf verlor sich in seiner Arbeitswelt, die Mutter zu Hause. Tim konnte die ständige Streiterei seiner Eltern nicht mehr ertragen. Das Leben zu Hause hing ihm zum Halse heraus. Er hatte nie den Vater gehabt, den er sich gewünscht hatte. Nie hatte er sich mit ihm über wirklich wichtige Dinge unterhalten. Immer hatte er alles alleine meistern müssen. Er hatte sehr unter dieser Distanz zu seinen Eltern gelitten. Er hatte längst begriffen, dass er nicht in den ursprünglichen Lebensplan seiner Eltern passte und dass das etwas mit der gestörten Beziehung seiner Eltern zu tun haben musste. Wie gerne hätte er es von seinem Vater erfahren. Wie gerne hätte er von seinem Vater gehört, dass Mama und er ihn trotzdem lieben und dass sie nie bereut hätten, seine Eltern zu sein. Doch er hatte es nie gehört. Auch nicht gespürt. Nicht von seinem Vater, der war immer ernst und kühl gewesen. Er hatte dieses Leben satt. Deshalb verbrachte er auch immer öfter und immer längere Zeit mit Claudia, seiner Freundin. Bei ihr fand er, was er zu Hause nie empfunden hatte. Es war ein schönes Gefühl, geliebt zu werden. Er genoss diese Geborgenheit und fühlte sich von ihr angenommen wie sonst von niemandem.
Es war an einem Freitag, als Ralf es erfuhr. Er kam später als gewöhnlich von der Arbeit. „Erstaunlich, in der Küche ist noch Licht. Dabei wollte Johanna doch schon früh schlafen gehen. Vielleicht ist es ja auch Tim, der noch etwas zu essen braucht." Ralf stieg aus dem Wagen, schaute durchs Küchenfenster und erblickte Johanna. Sie saß am Tisch, hatte ihren Kopf auf die Tischplatte gelegt und schien zu schlafen. Doch er wusste, dass sie nicht schlief. Irgendetwas musste geschehen sein. Sonst würde sie nicht auf ihn warten.
Als er die Tür öffnete und ins Haus trat, hob sie ihren Kopf an und ihre Blicke trafen sich. Ihre vom Weinen angeschwollenen Augen teilten ihm mit, dass sie sich auf einen neuen Lebensabschnitt vorzubereiten hatten, und zwar anders, als sie ihn sich vorgestellt hatten.
Fussnoten:
| Eugen Friesen ist Student der Literaturwissenschaft an der Nationalen Universität, Asunción. |
Vewaunte hab’ wie aullaweajen
Uwe Friesen
Daut weea em scheenen Farjoha 2001. Etj weea aus Gaust bie Thiesses en eene mennische
Kolonie en Brasilien. Em
Chaco saje se, daut dee Menniste dort em ütstoawe send. Eenmol, wiels see väle aufwaundre sene, no dee Grootstäda, oda uck nom Ütlaund. Toom Biespell no Caunada, daut mennische Paradies hia opp Eaden. En uck, wiels see sich emma mea unja daut latinsche ooda nationale Voltj mische, so daut dee leewste plautdietsche Sproak en daut von Sibirien en de Ukraine metjeschlappte Oafgoot so aus Borschtsch, Lewaworscht oda Repspea – en Jefoha send, veloare to gohne.
Bie Thiesses weare noch een poa Pannasch enjedunge. See kaume üt eene aundre
Kolonie von
Paraguay auls etj. En so aus daut eenmol es, wann Menniste von hia en dort, von ditsied en jantsied tooptraffe, dann woat spezeat, daut dee Spautze oppem Dack daut schewietre vejeiht. Maun räd äwa aullet meajelje. Dee Chaqueños rede vom Wada, daut ploagt je eant aus de Lies dem Hund oppem Fall. De oostparaguajsche Warteletasch (?) bekloage sich, daut dee Wirtschaft ewahaupt nicht deit, en daut eene gaunze Siedlung nich mea Weit en Soja oppe Been brinjt aus noch ver weinje Joahre een eensja velüsda Büa. Dee brasiliaunsche Sestre en Breeda maltje, daut dee Holländasch eahre Idasch meist opschlappe, en halpe deit daut so vel aus nuscht, saje see, wiels de Pries mang dem Silo lidje blift, en de Real vom Wind veblost woat.
Oba wann se eascht aula toop send, dann woat boold ewa dee Vewaundschaft jeplüdat, so aus wann in latinscha Redna een spaunendet Footbaulspell äwa Radio nosajt.
Auls dan tweschen dem Jubiläumstrubbel Thiesses, Pannasch en etj mol eene Üleflucht Ruh funge, weare dee Benja boolt aum Enj jefot, en maun zoddad en oakad aum Knoppe romm, ohne to weete, woa daut hangohne wurd. Uck Uruguaya mengde sich doa too en spezeade voll mang. Met eenst sajt Fru Panna: „Jo. Mien Schwiavoda, dem storf siene Fru uck mol, en mien Maun, dem fried etj mie, auls hee tjeene Mutta haud. Nu haft’a wada eene, en etj hab `ne Schwieama." Daut en mennischa Wittwa friet, es je nich onbekaunt, oba dise weare aul beid meist en bet ewaällat, noch ütte rusche Revolution.
„Gaunz interessaunt", meend Thiesche, „en wea send de Lied?"
„Schwieavoda es oole Tjnals Panna, en siene nieje Leewste es Tientje Rampel üt dem
Chaco." „Dü meenst," fong Derksche üt Uruguay aun, „dü meenst dee Hendrik Rampelsche, dee Plüda-Tientje von Kroonsfeld?" „Jo, dee meen etj, tjanst dü dee vleicht uck noch en Uruguay?"
Nü wea uck Thiesse nieschierig jeworde. `Daut kaun je noch interessaunt rommkome’ docht hee opp Stelles. Uck dee aundre Manna haude eahre Wirtschaftsjespräche rütjeschowe. Dee Frües weare je mol wada opp’em rachten Wach, waut nieet toop to dreihe. Daut kunn maun nicht vepausse.
„Daut es miene Mame eahre Nicht -Steefnicht. See woss mol bie dise Femilje opp, aus Rampels daut so sea knaup jintj enne Aunsiedlung em
Chaco", ertjlead Derksche en strohld.
„Jo, en soo send wie vewaunt gaunz dicht bie segoa en wie weete daut aulla nicht." Omtje Panna haud sitj bott nü weinig interesseat aun dise Bekaundarie, oba nü stund hee opp, rejt dee nie entdajte Frindschaft dee Haund, kloppad den en bet oppe Schulla en sed wieda nuscht.
Uck Thiesse en Derkse haude dee gaunze Tiet dee Leppe toopjedreiht. See wisste: Bie soone earnste Jesprächsrund durf tjeen Maun to Woat kome, daut wea je aul emma bie dee Menniste Fruessach. Oba nü floach Panna daut doch ewa dee Leppe: „Jo, jo. Vewaunt send wie Menniste aula, en wann jie noch lang jenoach romräde een seatje, send dee schwoate Gloowensbreeda en -sestre üt Afrika uck boold noch onse leibliche Breeda en Sestre."
Buchbesprechungen
Ratzlaff, Gerhard: Ein Leib – viele Glieder, Die mennonitischen Gemeinden in Paraguay.
Mit dem Buch „Ein Leib – viele Glieder" legt Gerhard Ratzlaff, Lehrer am
Instituto Bíblico Asunción und Leiter des Geschichtsarchivs der Mennoniten
Brüdergemeinden, ein Werk vor, das er im Auftrage des Gemeindekomitees verfasst hat. Nach seinen eigenen Worten schreibt er dieses Buch „nicht nur über, sondern für die Gemeinden" in
Paraguay. Er sieht also seine Leserschaft vor allem unter den paraguayischen deutschsprachigen Mennoniten selbst. Da, wie er darstellt, die Vielfalt der Gemeinderichtungen und Sprachen unter den
Mennoniten in Paraguay besonders groß ist, geht es also darum, die Kenntnisse der Mennoniten über einander zu vertiefen und das gemeinsame Geschichtsbewusstsein zu entwickeln. Die Leser sollen auf diese Weise in ihrem Gemeindebewusstsein gestärkt und zu einem christlichen Leben motiviert werden. Hinsichtlich seiner Aufgabe als Geschichtsschreiber betont Ratzlaff, dass Geschichtsschreibung für ihn zugleich auch Geschichtsdeutung sei. Dabei verweist er auf die Sicht der Mennoniten, die ihre Einwanderung in den
Chaco als einen Plan Gottes sehen, der sie beauftragt habe, die Indianer dieser Zone zu missionieren.
Diese Sicht ist sicher nicht ganz unproblematisch, da sie vom Ansatz her die Gefahr in sich birgt, Glaubensaussagen und den geschichtlichen Forschungsbefund nicht säuberlich zu trennen.
Seinen Standpunkt bestimmt Ratzlaff weiter, indem er sich dem deutsch-mennonitischen, fortschrittlich gesinnten Lager zuordnet. Dabei räumt er ein, dass bestimmte Gruppierungen wie die eher konservativ gesinnten Mennoniten seine Standpunkte und Sichtweisen nicht vollständig teilen dürften.
In seinem Buch stellt Ratzlaff zunächst die gemeinsame Geschichte dar, die in den Niederlanden beginnt und über Preußen nach Russland führt. Hier kommt es im 19. Jahrhundert zu den für das heutige Gemeindeleben entscheidenden Weichenstellungen: Im Zuge der Erweckungsbewegung, die durch deutsche pietistische und evangelisch-lutherische
Prediger auch nach Russland und in die Mennonitengemeinden getragen wird, kommt es zu den zwei Aufbrüchen, die bis heute die Entwicklung der aus der russischen
Tradition stammenden Mennoniten bestimmen: die Entstehung der
Brüdergemeinden und die der Allianzgemeinden, die heute als
evangelisch-mennonitische Bruderschaft fortbestehen. Im
Paraguay von heute gibt es weiterhin alle vier Richtungen, diejenige der Altkolonier, die die Aufbruchbewegungen des 19. Jahrhunderts nicht mitgemacht haben, die
Mennonitengemeinde, sowie die Brüdergemeinde und die
evangelisch-mennonitische Bruderschaft. Dabei zeigt sich deutlich, dass die Brüdergemeinde mit ihrer Form des Gemeindelebens so stark auf die anderen Gemeinden eingewirkt hat, dass sich ihr Gemeindemodell, wenn man einmal von der Untertauchungstaufe absieht, weitgehend durchgesetzt hat. So gibt es heute in allen Gemeinden, die nicht mehr strikt dem Modell der Altkolonier anhängen, Gemeindestunde, Bibelstunde, Sonntagsschule, Jugendarbeit, Hauskreise und vieles andere mehr, die modernen Formen des Gemeindelebens der Mennoniten
Brüdergemeinden.
Nachdem Ratzlaff diese gemeinsame Geschichte dargestellt hat, stellt er die einzelnen Gemeinden vor. Auch hier folgt er dem Muster, zunächst mit der Geschichte in Russland zu beginnen und dann die Entwicklung über Aus- und Einwanderung, Ansiedlung bis zur Gegenwart zu verfolgen. Dann wird der jeweilige Stand der Gegenwart dargestellt, wobei vor allem auch die verschiedenen Arbeitszweige wie Missionsorganisationen, Ausbildungsstätten und anderes dargestellt werden. Vor den Augen des interessierten Lesers entsteht so ein breites Panorama der unterschiedlichen Entwicklungen der Gemeinderichtungen. Für viele Leser ist es sicherlich neu, wenn er die traditionellen Mennoniten betrachtet oder von den konservativen amerikanischen Mennoniten berichtet, die einige kleine Siedlungen in Ostparaguay gegründet haben. Diese stammen historisch aus dem schweizerisch-süddeutschen Raum und unterscheiden sich in Gemeindeform wie auch im Umgang mit der nationalen Bevölkerung grundlegend von den russlanddeutschen Mennoniten.
In zwei weiteren Kapiteln werden jeweils die verschiedenen indianischen und die lateinparaguayischen Missionsgemeinden dargestellt. Und in einem abschließendem Kapitel, das gut ein Drittel des Buches einnimmt, werden die verschiedenen Einrichtungen beschrieben, die ein Großteil der in
Paraguay lebenden Mennoniten gemeinsam betreibt. Hier kommt natürlich Ratzlaffs Ansatz voll zum Tragen, von dem zu berichten, was die Gemeinden aufbauen kann. Sicher dürfen die Gemeinden Paraguays nicht ohne Stolz auf ihre gemeinsamen vorwiegend sozialen Initiativen schauen. Allerdings fällt beim Lesen auf, dass es in den sechziger und siebziger Jahren ein größeres Engagement und eine lebendigere Debatte hinsichtlich der Frage eines Ersatzdienstes und des Einsatzes der Jugendlichen im Christlichen Dienst gegeben hat. Vielleicht kann das Buch hier eine stärkere Besinnung bewirken.
Insgesamt liegt die besondere Stärke von „Ein Leib – viele Glieder" in der großen Fülle des verwendeten Quellenmaterials, das Ratzlaff geschickt ausgewählt hat. Es
macht das Buch anschaulich, lässt den Leser das Leben der verschiedenen Persönlichkeiten, Gemeindeleiter und
Prediger wie auch einfache Glieder, spüren. Die mitunter auch harten Auseinandersetzungen aus der Geschichte treten uns lebendig vor Augen.
So erreicht dieses Buch sein aufgetragenes Ziel sicherlich, über den vielgliedrigen Leib der Mennoniten Paraguays und seine Geschichte zu informieren und zwar so, dass dieser Bericht auch das Interesse der Angesprochenen weckt.
Was noch beschrieben werden muss, das ist ein weiteres Buch, das alle die Fragen aufnimmt, die für die weitere Entwicklung der mennonitischen Gemeinden in
Paraguay von Bedeutung sind: – Wie können die Beziehungen zwischen deutschstämmigen, indianischen und lateinparaguayischen Gemeinden enger werden, so dass auch hier die Einheit spürbarer wird? Welche Rolle wollen die mennonitischen Gemeinden im größeren Leib Christi spielen, d.h. welche Stellung wollen sie zu den anderen christlichen Gemeinschaften einnehmen? Wie wollen sie zukünftig mit ihren internen Problemen umgehen: Peter P. Klassen hat mehrfach auf die Probleme hingewiesen, die dadurch entstehen, dass die
Mennonitenkolonien auch „Reich dieser Welt" sind. Die Verführung,
Macht auszuüben ist groß und sie wird noch größer dann, wenn man dieses Problem leugnet und wenn man nicht wahrnimmt, dass Gemeinden, Glieder und Kolonien auch ökonomisch einen erheblichen Machtfaktor darstellen. Das Hineinwachsen in die Konsumgesellschaft bleibt ebenfalls ein Problem, auf das die Gemeinden noch keine Antwort entwickelt haben: Wie stellen sich die Gemeinden zu wirtschaftlichem Wachstum, das immer auch auf Kosten anderer Menschen und der Natur geht, wie zu Fragen des sozialen Ausgleichs, zu Modellen eines einfachen Lebensstils, den die
Bibel nahelegt, wie halten sie den Gedanken des Dienens auch unter den nachwachsenden Generationen aufrecht? Hier reicht es sicher nicht, nur an die bisher geleisteten Dienste und aufgebauten Einrichtungen zu erinnern, sondern hier muss die Gegenwart einer kritischen Analyse im Sinne des „Prüfet alles…" unterzogen werden. Aber dies war nicht mehr die Aufgabe dieses Buches.
Michael Rudolph
Regina Löneke: Die „Hiesigen" und die „Unsrigen" Werteverständnis mennonitischer Aussiedlerfamilien aus Dörfern der Region Orenburg/Ural.
N. G. Elwert Verlag Marburg 2000, 425 Seiten (mit einigen Bildern).
Unter den Hunderttausenden von Umsiedlern oder Aussiedlern, die seit etwa 1970 aus Osteuropa in die Bundesrepublik Deutschland kamen, waren auch viele Mennoniten aus der damaligen Sowjetunion. Wie viele es waren, darüber schwanken die Angaben, denn es ist nicht ganz einfach festzustellen, wer ein
Mennonit ist. Jedenfalls gibt es heute, geballt in einigen Gegenden Deutschlands, viele Gemeinden der mennonitischen Aussiedler.
Über diese Mennoniten hat Regina Löneke eine Untersuchung vorgelegt, die in der „Schriftenreihe der Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde" erschienen ist. Sie hat sich bei ihrer Arbeit auf eine Gruppe beschränkt, die aus den Mennonitendörfern bei Orenburg stammt und sich 1990 in der
Gemeinde Brakel im Kreis Höxter in Ostwestfalen angesiedelt hat. In Deutschland formieren sich die Mennoniten nicht in erster Linie in Siedlungen oder gar in Dörfern, wie das in Russland bis in die Zeit der Sowjetunion der Fall war, sondern in Glaubensgemeinden. Inwiefern diese Gruppe in Brakel nun als beispielhaft auch für andere mennonitische Aussiedlergemeinden in Deutschland gelten kann, wäre vielleicht eine Frage, obwohl so viel Generelles behandelt wird, dass es wohl auch für die meisten anderen Gruppen zutrifft. Bei dieser untersuchten Gruppe geht es um eine Mennoniten-Brüdergemeinde mit „baptistisch-fundamentalistisch orientierter Richtung", und Löneke stellt fest, dass „sie sich vor jeder offiziellen Registrierung auch innerhalb ihrer weltweiten mennonitischen Gemeinschaft verschließen, um sich damit vor Verweltlichung abzugrenzen."
Damit ist wohl auch ein Charakteristikum für sehr viele mennonitische Aussiedlergemeinden gegeben, und daraus resultiert dann auch die Kernfrage der Untersuchung: Wie integrieren sich diese Mennoniten in ihre neue Umwelt? Der Titel „Hiesige" (die dort lebenden Deutschen) und „Unsrige" (die Aussiedler) schon soll die Problematik zum Ausdruck bringen.
Interessant ist gleich zu Anfang die Frage nach der mennonitischen Identität, eine Frage, die das Mennonitentum heute weltweit bewegt. Wer ist ein
Mennonit? Was kann als Kriterium gelten? Ist es ausschließlich die bewusste Glaubensüberzeugung, sind es die mennonitischen
Familiennamen und der große Sippenverband, ist es die plattdeutsche Sprache mit Sitte und Brauchtum? Die bei dieser Frage entstehende Unsicherheit war auch der Grund dafür, dass bei der Untersuchung in den Auffanglagern keine ganz genauen Zahlen ermittelt werden konnten.
Viele der Befragten gaben sich als
Baptisten aus. Dabei waren 50% der Namen dieser Leute einwandfrei mennonitisch, d.h. dass ihre Vorfahren zu einer Mennonitenkolonie gehört hatten. Die große Unsicherheit lässt sich aus dem Jahrzehnte langen Leben unter der Sowjetherrschaft erklären. In dieser Zeit wurden die
Prediger verbannt, die Gemeinden zerstört, die Versammlungen verboten. Viele Mennoniten haben sich dann den nach 1943 erlaubten Organisationen der russischen
Baptisten angeschlossen. Dabei ging bei vielen auch das Geschichts- und Herkunftsbewusstsein sehr oft verloren.
Ein Mitarbeiter der Mennonitischen Umsiedlerbetreuung berichtete: „Oft kommen wir in unsern Gesprächen mit den Aussiedlern auf das Mennonitentum zu sprechen. Wenn sie angegeben haben, dass sie
Baptisten, Pfingstler oder Adventisten sind, fragen wir sie, ob sie nicht Mennoniten seien, da sie doch von Mennoniten abstammen. `Natürlich’, sagen sie, `sind wir Mennoniten. Sind das nicht die gleichen wie die
Baptisten‘?"
Andere begrenzen die Zugehörigkeit zur mennonitischen Gemeinschaft auf die Einhaltung bestimmter Richtlinien, wie z.B. die Ablehnung eines Fernsehers oder die Enthaltsamkeit von alkoholischen Getränken.
Bei der Brüdergemeinde in Brakel untersucht Löneke dann alle Seiten ihres Lebens und ihrer Lebenshaltung, die
Bildung, das Familienleben, das Gemeindeleben, die Jugendarbeit, ihre Sprache und dann natürlich ihre Einstellung zu ihrer neuen Umwelt in Deutschland.
Sie haben es nicht leicht. Unter dem langen Druck, den diese Menschen unter der sowjetischen Herrschaft erlitten haben, unter der Verfolgung als Christen und der Diskriminierung als Deutsche hatten sich bei ihnen Traumvorstellungen von Deutschland gebildet. Deutschland, das Land der Freiheit, das Paradies, in das sie alle Wunschvorstellungen ihres entbehrungsreichen Lebens, einschließlich das einer soliden Frömmigkeit projizierten. Sie träumten von einer menschlichen Gesellschaft, die ihre Ideale von Redlichkeit, Ordnung und Sittlichkeit verkörperte.
Das führte, als sie nun nach Deutschland gekommen waren, erst einmal zu einer schweren Enttäuschung auf der ganzen Ebene. Sie kamen in eine Umwelt, die in vielen Stücken das Gegenteil von dem war, was sie erträumt hatten, jedenfalls was Sittlichkeit und Moral, vor allem unter der Jugend, anging, und diese Umwelt war in keiner Weise bereit, sich auf ihre Ansprüche einzustellen.
Löneke versucht dann, sich ein Bild von der religiösen Grundhaltung dieser Menschen zu machen; denn darin sieht sie einen Hauptgrund für die Integrationsschwierigkeiten. Natürlich ist eine Brüdergemeinde wie die in Brakel in den Jahrzehnten der Not und der Isolierung in Russland und in der bewussten Abgrenzung von ihrer Umwelt in einer bestimmten Glaubenshaltung geprägt worden.
Doch diese Haltung wurde in Deutschland dann noch besonders verstärkt. Die von der
Gemeinde geforderte Bekehrung vor der
Taufe ist weitgehend von Evangelisationsversammlungen abhängig. Die unter den evangelikalen Gemeinden in Deutschland bekannten Evangelisten wie Gerhard Hamm, Wilhelm Pahls, Johannes Reimer, Abraham Fast und einige mehr fanden schnell Zugang auch zu diesen Gemeinden, und sie trugen sehr stark zur weiteren Prägung ihrer Grundhaltung bei. Ein Charakteristikum dieser Evangelisationspredigten ist, (Löneke gibt davon einige Muster), dass die Welt, in diesem Fall die Umwelt in Deutschland, zunächst als sündig und verworfen dargestellt wird, um dann das Heil des Evangeliums anzubieten.
Auf diese Weise wurde – so Löneke – der Kontrast dieser mennonitischen
Gemeinde zu ihrer Umwelt noch verstärkt. Sie stellt fest: „Die von mir untersuchten mennonitischen Aussiedler und Aussiedlerinnen nahmen das sie umgebende soziokulturelle Umfeld in vielen Bereichen nur mittelbar durch die Interpretation ihrer
Prediger und Evangelisten wahr. Sie bewerteten Lebensformen und Werte der hiesigen
Kultur anhand von Kriterien, die sie aus dieser Bibelauslegung bezogen … Die hiesige
Kultur und Lebensweise erschienen den Befragten als Bedrohung für ihre religiösen Werte … und bewirkten erneut einen Rückzug in ihre Familien und Gemeinden. … Ihre Werte und Grundhaltungen standen in vielen Bereichen konträr zu den Lebensweisen in der Bundesrepublik Deutschland." Eine noch stärkere Isolierung ist dadurch auch in der neuen Heimat – ebenso wie damals in der Sowjetunion – die Folge.
Andererseits – so stellt Löneke fest – „gibt gerade diese geschlossene religiöse Gemeinschaft dem einzelnen Mitglied Rückhalt und Sicherheit und hilft, sich in der teilweise fremden deutschen Gesellschaft einzurichten. Damit werden dann kontrollierte Akkulturationsprozesse gefördert, die neue Formen des Umgangs mit der hiesigen
Kultur einleiten … Grundlegende Veränderungen der religiösen Werte können nur durch eine erweiterte Bibelauslegung erfolgen. Die zunehmende
Bildung der Kinder dieser Gemeinschaft kann Einfluss auf die Fortentwicklung ihrer speziellen Ausprägung mennonitischer Lebensformen haben und letztlich bewirken, dass mit der Öffnung gegenüber aufgeklärten Denkweisen das Weltbild der Mennoniten aus Russland aufgeweicht und weiterentwickelt wird."
Das Buch enthält außerdem ein sehr vollständiges Literaturverzeichnis zum Thema.
Peter P. Klassen
Gerd G. Giesbrecht: Ich sah der Lengua Hütten. Erfahrungen und Beobachtungen in der Missionsarbeit
Filadelfia 2000, 275 Seiten.
Es ist logisch, dass die Interpretation einer Geschichte erst nach den Ereignissen selbst erfolgen kann. Etwas mehr als sieben Jahrzehnte der Begegnung, Missionierung und des Zusammenlebens mit den Ureinwohnern liegen jetzt hinter uns, und die Dokumentation – deskripitive wie auch interpretative – dieses Prozesses hat sich neuerdings vermehrt. Auch dieses Buch ist in diesem Kontext angesiedelt. Der Autor ist ca. zwei Jahrzehnte lang direkt in der Missionsarbeit tätig gewesen, hat aber auch vorher und nachher vielfältige Beziehungen zu den
Enlhet-Indianern gepflegt. Er kann als Sohn des ersten
Enlhet-Missionars manche Einblicke in den Werdegang der Missionierung geben, die einem Außenseiter unzugänglich wären – die womöglich auch nicht ausreichend dokumentiert sind.
Das vorliegende Buch ist Produkt eines längeren Reifeprozesses. Es begann als Materialsammlung während der Feldarbeit (1964-85), verwertete die Aufzeichnungen von Missionar G. B. Giesbrecht und interpretiert dieses Material nach den Erkenntnissen evangelikaler Missionsanthropologie, wie sie vor allem durch G. W. Peters hier im
Chaco bekanntgeworden ist.
Das Buch gliedert sich in vier Teile:
I. Der geschichtliche Hintergrund der Chacovölker und der mennonitischen Einwanderung.
II. Die
Kultur und Weltanschauung der
Enlhet-Indianer.
III. Die verschiedenen Phasen der Missionstätigkeit, auf die jeweilige Rolle des Missionars fokussiert.
IV. Die ganzheitliche Entwicklungsarbeit durch die
ASCIM.
Rückblickend muss man feststellen, dass die mennonitischen Einwanderer ohne jegliche Vorbereitung für eine Begegnung mit den
Indianerkulturen in den
Chaco kamen. Das äußere Erscheinungsbild prägte denn auch meist das innere Konzept welches sich die Einwanderer von den Indianern bildeten (S. 49). Und dieses Konzept, wurde sehr bald in eine Aufgabe umgesetzt – eine missionarische und zivilisatorische Aufgabe, wie sie sich im ursprünglichen Statut des Missionsbundes widerspiegelt. Was es der frühen Missionsarbeit an Erkenntnissen mangelte, wurde durch Überzeugung und Hingabe wettgemacht. Somit war die Evangelisierung und Sesshaftmachung bereits voll im Gange, als der Anthropologe Jakob A. Löwen 1964 engagiert wurde, die
Kultur der
Enlhet zu studieren und diese für die mennonitischen Einwanderer zu interpretieren. Dadurch wurde manch ein Aspekt der Missionsarbeit erhellt, manch ein schon eingeschlagener Weg korrigiert. Auch wurden die Missionare befähigt, zielbewusster in der Erforschung indianischer
Kultur und Sprache vorzugehen, was wiederum zu einer festeren Basis in der Verständigung führte.
Das vorliegende Buch reflektiert diese Phase in der Begegnung, die in gewissem Sinne eine Aha-Erfahrung für viele Mennoniten wurde. Man sah erstmals die Komplexität und auch den Reichtum einer ganz anderen
Kultur hinter der Fassade der äußeren Erscheinung. Man begann zu verstehen, wieso die
Enlhet auch nach zahlreichen Versuchen nicht zu bewegen waren, mennonitische Denk- und Handlungsweisen anzunehmen.
Die Geschichte des interkulturellen Miteinanders im
Chaco geht weiter. Die bisher gesammelte Erfahrung stellt eine Bereicherung dar, gerade auch für die Herausforderung der Zukunft. Die
Enlhet in ihrer kulturellen Eigenart zu verstehen, ist die eine Seite der Münze, sich selbst in Bezug zur anderen
Kultur besser zu verstehen, wäre die Kehrseite. Dazu wird die Geschichte der Begegnung Indianer-Mennoniten wieder und wieder, von verschiedenen Perspektiven her, aufgerollt werden. Nur wenn menschenwürdige Lebensmöglichkeiten für alle Beteiligten in Aussicht stehen, wird man sagen können, dass die Begegnung ein Segen war.
Gundolf Niebuhr
Sowohl von offizieller als auch von privater Seite war man anlässlich des 75-jährigen Jubliäums der
Kolonie Menno darauf bedacht, die zurückgelegte Lebensstrecke in Buchform zu dokumentieren. Der Geschichtsverein hat zu diesem Zweck viele historische Fotos gesammelt und sie zusammen mit informativen Begleittexten in einem Bildband veröffentlicht. Während der Bildband in den Texten vor allem die institutionelle Entwicklung der
Kolonie berücksichtigt, beschreiben einige Bürger ihre ganz persönlichen Erfahrungen. Die Bücher ergänzen einander, da auf der einen Seite die strukturellen Veränderungen sichtbar werden, auf der anderen Seite persönliche Schicksale den Leser mit in das Alltagsleben hineinnehmen.
1. Geschichtskomitee der Kolonie Menno (Hrsg.): Unter der heißen Sonne des Südens. Loma Plata, Paraguay, 2002. 228 Seiten. Im Vorwort nennt Uwe Friesen, der Leiter des Geschichtskomitees der
Kolonie Menno, die Absicht der Herausgeber: „Dieser Bildband soll den Nachkommen der Einwanderer – 75 Jahre nach dem Neunanfang im
Chaco Paraguays – dazu dienen, Teile ihrer eigenen Geschichte mitzuerleben. Vergangene Zeiten sollen nicht vergessen, sondern immer wieder bewusst an die kommenden Generationen herangebracht werden" (S. 8).
Das Buch beginnt mit einer Reihe von Fotos, die mit der Expeditionsreise im Jahre 1921 anfangen und den Abschied in Kanada sowie den Neubeginn im paraguayischen
Chaco zeigen.
Anschließend gibt
Prediger Abram S. Wiebe einen Überblick über die Entwicklung der
Gemeinde. Die Bewohner der
Kolonie Menno gehörten in Kanada zur Chortitzer, zur
Bergthaler oder zur
Sommerfelder Gemeinde, schlossen sich aber in den fünfziger Jahren zur
Mennonitengemeinde Menno in
Paraguay zusammen. Im Laufe der Zeit wurde diese große
Gemeinde in kleinere Gemeinden aufgeteilt, damit sie ihre Aufgaben in
Gemeinde und Mission besser erfüllen konnten. Maßgeblichen Einfluss auf die
Gemeinde hatte der langjährige Älteste Martin C. Friesen. Bilder von der ersten Kirche in Osterwick, von Gemeindeveranstaltungen, Sängerfesten und Jugendaktivitäten sowie von der ständig wachsenden Missionsarbeit vermitteln anschaulich die anhaltende Weiterentwicklung der
Kolonie auf gemeindlicher Ebene.
Große Veränderungen erlebte die
Kolonie Menno vor allem auf dem Gebiet der Verwaltung und des Schulwesens. Die Veränderungen auf dem Gebiet der Verwaltung werden von dem ehemaligen Oberschulzen Jacob N. Giesbrecht dargestellt. Der Weg von der traditionellen Schule, die noch ganz dem
Lehrdienst der
Gemeinde unterordnet war, bis hin zur modernen Primar- und Sekundarschule, die der Schulverwaltung unterstellt sind und sich nach den Vorschriften des Erziehungs- und Kultusministeriums in der Landeshauptstadt zu richten haben, war lang und beschwerlich. Diesen Weg hat der erfahrene Schulfachmann Heinrich Ratzlaff ausführlich und sachkundig beschrieben.
Auch das Gesundheitswesen, die Sozialarbeit, das Abgabensystem, das die verschiedenen Abteilungen der „
Asociación Civil Chortitzer Komitee" erst ermöglicht, werden von sachkundigen Autoren dargestellt. Der Bildbericht über die Indianer, „unsere Nachbarn", wird nur mit einem sehr kurzen Text eingeleitet. Hier hätte man sich eine ausführlichere und differenziertere Darstellung gewünscht, da diese Bevölkerungsgruppe sehr eng mit der Entwicklung der Mennonitensiedlungen verbunden ist.
Die wirtschaftliche Entwicklung der
Kolonie Menno wird besonders deutlich, wenn man sich die Präsentation der verschiedenen Abteilungen der „Sociedad Cooperativa Colonizadora
Chortitzer Komitee" vor Augen hält. Uwe Friesen beschreibt hier, wie die Bauern in gewohnter Weise mit dem Ackerbau begannen. Man pflanzte Baumwolle, Erdnüsse, Rizinus, Kafir, Bohnen und vor allem auch Gartenfrüchte. Später intensivierte man die Milch- und Fleischproduktion, die nicht ganz so stark von Witternungseinflüssen abhängig war und mit der man auch stabilere Preise erzielen konnte. Industrieanlagen und Handwerksbetriebe, die sehr bescheiden anfingen, wurden durch zunehmende Geldmittel und erworbenes „Know how" zu leistungsstarken Einrichtungen ausgebaut. In den letzten Jahrzehnten gewinnt der Handel und auch die Vermarktung der eigenen Produktion immer mehr an Bedeutung.
Alles in allem hat das Geschichtskomitee mit diesem Buch ein optisch eindrucksvolles Dokument der Siedlungsgeschichte seiner
Kolonie dargestellt. Die vielen Fotos vermitteln nachhaltige Eindrücke aus der schwierigen, letztlich aber doch erfolgreichen Erlebniswelt der Bürger dieser Pioniersiedlung im
Chaco. Die Texte erhellen die Zusammenhänge und Hintergründe der einzelnen Koloniezweige. Der nachdenkliche Leser hätte sich aber gewünscht, wenn neben der Darstellung auch die kritische Analyse und die Perspektiven für die Zukunft stärker berücksichtigt worden wären. Hierbei hätte dann das Zusammenleben mit den anderen Ethnien in diesem Raum einen höheren Stellenwert einnehmen können. Denn auf Dauer ist im Raum der Mennonitensiedlungen nur eine gemeinsame Zukunft vorstellbar.
2. Johann W. Töws: Unser Leben in Paraguay. Loma Plata 2002. Der Autor ist der Enkel von Bernhard Töws, der 1921 Mitglied der Expeditionsgruppe aus Kanada war, die unter beschwerlichen Verhältnissen den paraguayischen
Chaco als zukünftiges Siedlungsgebiet der Mennoniten erkundet hat. Bernhard Töws war es jedoch aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr vergönnt, selber im
Chaco anzusiedeln, doch seine Briefe an seinen Sohn im
Chaco konnte der Autor für seine Darstellung verwerten. Außerdem standen ihm für seine Darstellung das Tagebuch seines Großvaters, Aufzeichnungen seiner Eltern und eigene Notizen zur Verfügung.
Als einjähriges Kind begann Johann W. Töws 1927 zusammen mit den Eltern und neun Geschwistern sein Leben im
Chaco. Auf Grund der ihm zur Verfügung stehenden Materialien beschreibt er kurz den Aufenthalt im Hafen Casado, die Ansiedlung im Dorf Waldheim und die ersten Versuche im Ackerbau.
Die Darstellung seiner eigenen Erinnerungen beginnt Töws mit der Schulzeit. Vorzeitig begann er bereits im Alter von fünf Jahren den Schulunterricht, lernte lesen, schreiben und rechnen nach der traditionellen Weise und wurde mit zwölf Jahren aus der Schule entlassen. Sein Wunsch, die
Zentralschule in
Filadelfia zu besuchen zerschlug sich, da die
Gemeinde eine Weiterbildung grundsätzlich verbot.
Den
Chacokrieg (1932-35) erlebte Töws teilweise bei der Feldarbeit, teilweise im Krankenhaus in
Isla Poí, wo er mehrere Tage interniert war. Feindliche Soldaten bekam er nicht zu Gesicht, wohl aber sah er die feindlichen bolivianischen Flugzeuge, die Bomben abwarfen oder sich einen Zweikampf mit paraguayischen Flugzeugen lieferten. Der Kontakt zwischen Mennoniten und paraguayischen Offizieren und Soldaten war für beide Seiten von Vorteil, denn diese erhielten Nahrungsmittel und jene konnten endlich einmal ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Der weitere Lebensweg von Johann W. Töws ist einerseits gekennzeichnet durch verschiedene berufliche Aktivitäten, andererseits durch langjährige Missionsarbeit unter den Indianern. Seine ersten intensiven Kontakte mit den Indianern knüpfte er, als seine
Familie den indianischen Waisenknaben Erdmann in ihr Haus aufnahm. Mit ihm war er ständig zusammen, gemeinsam verscheuchten sie die Papageien von den Kafirfeldern und sie trennten sich erst, als Erdmann mit 15 Jahren ein Indianermädchen heiratete und für mehrere Jahre bei der Sippe des Indianermädchens lebte.
Mit 21 Jahren fing Töws an, sich selbständig zu machen. Er transportierte Waren für die Kooperative, richtete eine eigene Wirtschaft ein und verdiente sein Geld durch Zaunsetzen für die
Kolonie Menno. Zeitweilig arbeitete er in der Palosantofabrik der
Kolonie Fernheim auf Laguna Porá. Nachdem er 1950 geheiratet hatte, zog er mit seiner
Frau zur
Viehstation Río Verde. Nachdem er auch noch bei der Gründung der Estancia Cabeza de Tigre mitgewirkt hatte, begann er mit der Missionsarbeit, die ihn mit einigen Unterbrechungen jahrzehntelang festhielt. Töws beschreibt in realistischer Weise seine Erfahrungen während dieser Zeit. Während er abwechselnd die Funktionen des Wirtschaftsberaters, des Lehrers und Missionars wahrzunehmen hatte, musste seine
Frau die Funktion einer Krankenschwester erfüllen. Dabei erlebten sie Situationen, die ihre Kräfte bis zum Äußersten forderten.
Neben diesen vielen Tätigkeiten gelang es Johann W. Töws immer wieder, auch seine eigene wirtschaftliche Existenz zu sichern und weiter auszubauen. Zeitweilig war er Mitbesitzer einer Zieglei und erweiterte seinen Viehzuchtbetrieb im Laufe von 45 Jahren von 37 auf 3.000 Rinder. So kann er heutzutage seinen wohlverdienten Ruhestand genießen, solange sein inzwischen labil gewordener Gesundheitszustand das noch zulässt.
Die Aufzeichnungen von Johann W. Töws waren ursprünglich nur für die eigenen Verwandten gedacht. Da ihn aber immer wieder Schüler aus der
Zentralschule über seine Erfahrungen im Laufe seines langen Lebens befragten, entschloss er sich, sie in Buchform zu veröffentlichen. Damit stehen sie heutzutage allen Lesern zur Verfügung und geben Einblick in eine interessante und spannungsreiche Erlebniswelt eines Bürgers der
Kolonie Menno und darüber hinaus in die Lebenswirklichkeit der Bewohner des paraguayischen
Chaco.
3. Frau H. B. Töws (Maria geb. Wiebe): Meine Erinnerungen und Erlebnisse in Canada und Paraguay. o.O. und o. J., 83 Seiten. Maria Töws, die Mutter des oben genannten Johann W. Töws, berichtet über ihre Lebensgeschichte, weil, wie sie schreibt, „der Herr mit mir sehr tiefe Wege gegangen ist, und ich von vielen Menschen gebeten wurde, meine Erlebnisse mit dem Herrn zu beschreiben". In der Tat, diese
Frau hat in ihrem Leben viel gelitten. Sie wurde 1889 in Neuanlage bei Gretna,
Manitoba, geboren. Die Schuljahre waren für sie die schönste Zeit. Sie hatte neun Geschwister und musste früh bei der Feldarbeit mithelfen.
Bereits als Kind hatte sie manche Leiden zu ertragen. Einmal wurde sie beim Brunnengraben fast verschüttet, das andere Mal verbrannte sie sich mit dem Kaffeewasser das Bein. In der Jugendzeit half sie auf verschiedene Weise ihren Eltern, ließ sich taufen und heiratete 1908 Heinrich B. Töws. Wirtschaftlich schwere Zeiten veranlassten ihre Eltern sowie auch das junge Paar mehrmals den Wohnort zu wechseln. Schließlich wanderte sie im Jahr 1927 mit ihrem Mann und ihren zehn Kindern nach
Paraguay aus. Die Erlebnisse in diesem südamerikanischen Land bilden den Schwerpunkt ihrer Lebensbeschreibung.
Ausführlich beschreibt Maria Töws ihre Schiffsfahrt über den Ozean sowie ihre mehrtägige Reise mit dem Ochsenfuhrwerk in den
Chaco. Nachdem sie elf Monate in
Loma Plata gewohnt hatten, zogen sie im August 1928 nach Waldheim. Sie begannen in einfachen Verhältnissen: „Den ersten Tag stellten wir unsere Zelte auf und luden unsere Sachen ab und machten wieder alles fertig, in den Zelten zu wohnen. Wir hatten vier Zelte, zwei Schlafzelte, ein großes Zelt, wo wir wohnten und auch aßen, und ein Zelt, wo wir unsere Kisten drinnen hatten. Den zweiten Tag stellten wir einen Hühnerstall auf. Vier Pfosten wurden aus dem Busch geholt und eingegraben und dann mit Maschendraht umzogen. Das Dach wurde von Zinkblech gemacht" (S.29).
Krankheiten verhinderten den raschen wirtschaftlichen Aufstieg. Ein Sohn und eine Tochter waren abwechselnd an Typhus erkrankt und waren wochenlang ans Bett gefesselt. Einige Personen wurden von Schlangen gebissen, doch alle blieben am Leben. Schließlich hatte auch
Frau Töws selber an Krankheiten zu leiden. Doch den schwersten Kampf hatte sie zu bestehen, als sie 1944 Krebs an der Zunge bekam. Mehrmals musste sie deswegen nach
Buenos Aires fahren und hatte sich vieler sehr schmerzhafter Behandlungen zu unterziehen, die damit endeten, dass ihr der Unterkiefer und Teile der Zunge wegoperiert werden mussten.
Frau Töws wurde gesund, doch ihr Mann starb 1953 an Herzschlag.
Nachdem einige ihrer Kinder nach Kanada gezogen waren, kehrte auch
Frau Töws 1956 in das Land ihrer Geburt zurück. Es gab ein frohes Wiedersehen mit Verwandten und Bekannten. Doch auch hier hatte sie unter Krankheiten zu leiden, worüber sie in Tagebuchform berichtet. Das Buch schließt mit besinnlichen Gedanken zu ihrem 70. Geburtstag und mit der Bitte zu Gott: „Herr, verlasse mich im Alter nicht!"
Das Buch ist in schlichter Sprache abgefasst worden und zeigt die Wirklichkeit des Alltagslebens. Es ist allein schon deswegen ein wichtiges Dokument aus der Anfangszeit der
Kolonie Menno, weil es von einer
Frau geschrieben wurde, die sich zwar selber noch
Frau H.B.Töws nennt und nicht einmal ihren Namen Maria auf das Titelblatt schreibt, dennoch aber den Mut hat, mit ihren Aufzeichnungen an die Öffentlichkeit zu treten. Dafür sollten wir ihr dankbar sein.
4. Heinrich Ratzlaff (Hrsg.): Das kurze, leidvolle Leben des Heinrich J. Töws. Loma Plata 2001, 28 Seiten. Heinrich Ratzlaff, der Archivar der
Kolonie Menno, hat in dieser Broschüre zwei aufregende und zum Nachdenken anregende Dokumente veröffentlicht. Hier der Sachverhalt: In der Schule in Altona,
Manitoba, werden am 9. Oktober 1902 drei Männer und drei Schülerinnen angeschossen und der Schütze versucht anschließend, sich selber zu erschießen. Er überlebt, ist jedoch erblindet und mehrere Tage bewusstlos. Eine Schülerin stirbt an den Folgen der Schussverletzungen.
Dieser Vorfall ist für die Leser im
Chaco bedeutungsvoll, weil er sich in einem mennonitischen Umfeld abspielte und der Täter ein
Mennonit war. Der Schütze, Heinrich J. Töws, war der Bruder des Delegaten Bernhard Töws, der 1921 an der Chacoexpedition teilnahm. Bei den Dokumenten handelt es sich erstens um einen Brief, den der Lehrer Heinrich J. Töws am 15. Februar 1900 an seinen Freund Jacob Braun in Kanada geschrieben hat, und zweitens um eine Beschreibung des Ereignisses von seinem Bruder Bernhard Töws. Beide Dokumente sind zum besseren Verständnis von Heinrich Ratzlaff eingeleitet worden.
Der Brief offenbart den zerrütteten Seelenzustand eines intelligenten, aber im Leben gescheiterten Menschen. Seine Lehrerausbildung hat er nicht beendet, er ist krank und kämpft ums finanzielle Überleben. Die mennonitische Gesellschaft hat er verlassen, weil er sich in sie nicht integrieren konnte, leidet aber daran und ist am Verzweifeln: „Mir däucht mein Grab nahe, nahe zu sein, und was bringe ich mit? Weiter nichts aus dem ganzen reichen Leben als Irrtümer, Sünden, Krankheit; einen verstümmelten Körper, eine verödete Seele, die Brust voll Kummer und ein Alter voll Reue" (S.6). Seine letzte Hoffnung sind noch drei Freunde aus Altona, die ihm Briefe geschrieben haben, und vor allem seine Mutter, die für ihn betet. Doch er weiß: „Bis zum Kreuz Christi mag eine Mutter ihr Kind bringen, aber glauben muss jeder für sich selbst" (S.9).
Das Dokument seines Bruders Bernhard beschreibt kurz den Vorfall und dann vor allem die Besuche und Gespräche mit ihm im Krankenhaus und im Gefängnis. Der Leser erfährt, dass Heinrich J. Töws seine Tat offenbar im Zustand der Bewusstseinstrübung verübt hat und später vor allem darunter leidet, dass er ein Mädchen erschossen hat. Nach vielen Gebeten und hartem Ringen findet er Vergebung bei Gott und den Menschen und stirbt am 19. Januar 1903 im Gefängnis.
Die Broschüre schließt mit 26 Strophen eines Liedes, das Abram Harder über „diese traurige Geschichte" verfasst hat.
Jakob Warkentin
5. Braun, Jacob A. Im Gedenken an jene Zeit. Mitteilungen zur Entstehungsgeschichte der Kolonie Menno, Loma Plata, 2001, 120 Seiten. Der Autor des Buches „Im Gedenken an jene Zeit" kam mit 17 Jahren in den paraguayischen
Chaco. Jacob A. Braun gehörte zu den Pioniersiedlern und hat die ganze Ansiedlung der aus Kanada eingewanderten Mennoniten bewusst miterlebt. Die Tendenzen der heutigen Geschichtsschreibung konzentrieren sich darauf, nicht nur eine „Geschichte der Helden" zu schreiben, sondern auch auf den gesamten Prozess der geschichtlichen Entwicklung acht zu geben und in diesem Sinn kann das vorliegende Büchlein ganz bestimmt einen bedeutenden Beitrag liefern. Das Buch, mit einer interessanten Umschlaggestaltung, enthält rund 120 Seiten eindrucksvoller Geschichten, die Ende der sechziger Jahre von Braun in Kanada geschrieben wurden. Der Hauptteil des Buches beinhaltet die Auswanderung der Mennoniten aus Kanada und ihre Ansiedlung im zentralen
Chaco. Die Berichte aus der Ansiedlungszeit im
Chaco beziehen sich größtenteils auf die Verwaltungsarbeit und wirtschaftlichen Aktivitäten während der ersten Jahre des Bestehens der jungen
Kolonie.
Der Vorteil dieser Berichterstattung ist, dass Braun ein „Insider" der damaligen geschichtlichen Ereignisse ist. Weniger positiv ist die relativ späte Aufzeichnung seiner Erinnerungen, die manchmal einige zeitliche Unklarheiten erkennen lassen. Schon bald nach der Ankunft in Puerto Casado kamen die Leitereigenschaften von Jacob A. Braun voll zum Zuge. Er übernahm mit die Hauptverantwortung des Siedlungsprojektes. Nachdem in den vierziger Jahre andere Personen die Hauptverantwortung in der
Kolonie Menno übernahmen, verpflichtete er sich für die Abwicklung der Geschäfte in Asuncion. Nach einiger Zeit verschlug ihn das Schicksal zurück nach Kanada, wo er dann nach dem Tod seiner
Frau seine Erinnerungen aufgeschrieben hat. Sie bestehen größtenteils aus Mitteilungen und Briefen die an Martin W. Friesen und hauptsächlich an Jacob D. Harder gerichtet sind.
Die Reihenfolge der beschriebenen Themen wirkt im ersten Ansatz etwas verwirrend, und einen Gesamtzusammenhang erhält man erst, nachdem man das Buch ganz gelesen hat. Inhaltlich spiegelt es eine breite Palette von Themen wieder, die mit allgemeinen Gedanken zur Täufergeschichte und der Auswanderung nach
Paraguay ansetzt. Nach weiteren allgemeinen Abhandlungen wie Schulwesen, Verweigerung des Militärdienstes und Gründe zur Auswanderung, wird dann konkret auf die Ankunft der kanadischen Mennoniten in Puerto Casado Bezug genommen. Die ersten Erfahrungen in Puerto Casado und die ganze Organisationsarbeit, um die Übersiedlung in den zentralen
Chaco einzuleiten, werden ziemlich ausführlich behandelt. Sehr interessant wird auch der Entstehungsprozess des „
Chortitzer Komitee" und die allmähliche Auflösung des „
Fürsorgekomitee" geschildert. Erlebnisse aus dem administrativen Bereich des ersten Jahrzehntes der Ansiedlung wie z.B. der Aufgabenbereich der verschiedenen Verwaltungsorgane, Gründung des Kolonieladens, Kauf und Installierung von Industrieanlagen, Auswirkungen des Chacokrieges auf die Mennoniten, wirtschaftliche Kontakte mit der Landeshauptstadt Asuncion usw. nehmen einen breiten Raum ein.
Wenn die geschichtlichen Darstellungen von Braun auch nicht in wissenschaftlicher Form geschrieben sind, so bilden sie doch einen sehr wichtigen Bestandteil in der Geschichtsschreibung der
Kolonie Menno, da sie die authentischen Erfahrungen eines wichtigen Mannes der Kolonisierung des paraguayischen
Chaco widerspiegeln. Auffallend ist wohl auch, wie selten über den Sinn dieses Kolonisationsprojektes philosophiert wird. Dagegen beinhalten die Berichte aber wertvolle, informative und dokumentarische Elemente. Lesenswert ist dieses Buch auf alle Fälle und besonders, wenn man sich für die alltäglichen verzwickten Umstände der Ansiedlungszeit der ersten mennonitischen
Kolonie in
Paraguay interessiert.
Hans Theodor Regier
Hiebert, Abram W. und Jacob T. Friesen. …eine bewegte Geschichte… die zu uns spricht. Materialien zur Entwicklungsgeschichte der Kolonie Menno. Ein Beitrag zur 75. Gedenkfeier Juni 2002, Loma Plata, 2002, 330 Seiten. Die Jubiläumsfeier zum 75-jährigen Bestehen der
Kolonie Menno hat auch für die Geschichtsschreibung der
Mennoniten in Paraguay einige wertvolle Beiträge geliefert. Dazu zählt ganz bestimmt auch die Materialsammlung zur Entwicklungsgeschichte der
Kolonie Menno von Abram W. Hiebert und Jacob T. Friesen. Beide Autoren sind eng mit dem Aufbauprozess dieses Siedlungsunternehmens im zentralen
Chaco verbunden. Besonders Abram W. Hiebert hat jahrzehntelang im Dienst der Gemeinschaft gestanden. Seine Arbeit für die Gemeinschaft begann im ersten kleinen Kaufladen der
Kolonie Menno. Nach der Ausführung verantwortungsvoller Arbeiten in der Kolonieverwaltung innerhalb der
Kolonie Menno zog Hiebert gemeinsam mit seiner
Familie Anfang der fünfziger Jahre nach
Asunción, wo er die Leitung der Vertretung Mennos in der Landeshauptstadt übernahm. Seine Hingabe und der breite Erfahrungsrahmen waren für den Aufbau der Gemeinschaftsarbeit von großer Bedeutung.
In der Einleitung dieses Werkes wird von Jacob T. Friesen darauf hingewiesen, dass die Zielsetzung des Buches darin besteht, an erster Stelle den Bürgern der
Kolonie Menno ihre Geschichte in Form von Berichten eines Zeugen erster Hand zugänglich zu machen. Es geht also nicht um eine wissenschaftliche Abhandlung der Geschichte Mennos, sondern darum, dem interessierten Leser eine übersichtlich gegliederte Berichterstattung des geschichtlichen Prozesses dieser Siedlung zu ermöglichen.
Das umfassende Buch mit 330 Seiten, ist in vier Hauptteile gegliedert. Im ersten Teil geht es um die Einwanderung der kanadischen Mennoniten um 1927 unter der Verwaltung des „Fürsorgekomitees". Weiter werden der Anfang der neuen Ansiedlung und die ersten Schritte ihrer Entwicklung bis 1936 geschildert. Im zweiten Teil wird die Gründung der „Sociedad Civil
Chortitzer Komitee" während der ersten Entwicklungsstufe und der kolonisatorischen Erweiterung während der Jahre 1936 bis 1961 beschrieben. Ein gewisser Stabilisierungsprozess kann in diesem Zeitraum festgestellt werden. Der dritte Teil des Buches enthält die Zeitspanne von 1962 bis 1997, in der der starke Entwicklungsfortschritt auf Grund starker finanzieller Unterstützung die Hauptthematik bildet. Unter anderem wird in diesem Zusammenhang immer wieder auf die Errungenschaften im Produktionsbereich, die Verbesserungen der Transportmöglichkeiten, die wirtschaftlichen Erfolge und Erweiterungen in den Vermarktungseinrichtungen Bezug genommen. Die gesamte Entwicklung spielt sich im Rahmen der „Sociedad Cooperativa Colonizadora
Chortitzer Komitee" und der „Sociedad Civil
Chortitzer Komitee" ab. Im vierten und letzten Teil werden einige weitere Abhandlungen zur Geschichte der
Kolonie Menno aufgeführt.
Wie es schon im Titel des Buches heißt, erwartet den Leser keine wissenschaftlich ineinander greifende Abhandlung eines wichtigen Teiles der mennonitischen Geschichte in
Paraguay, sondern mehr eine Sammlung von historisch wichtigen Materialien zur weiteren Geschichtsforschung. Besonders wertvoll ist auch die Fülle von Fotos, die wir in diesem Buch vorfinden. Viele noch nicht veröffentlichte fotografische Materialien finden hier ihren Weg zum geschichtsinteressierten Leser. Auch statistische Daten und Landkarten aus der Ansiedlungszeit ergänzen das Geschichtspuzzle in wertvoller Art. Eine gut gegliederte Aufmachung erleichtert die Lektüre der oft schweren und leidvollen Geschichte der Pioniere Mennos. Man auch sehr bald merkt, dass der Autor selber Teil dieser Geschichte ist.
Hans Theodor Regier
Zuschriften
Schlussfolgerungen in dem Aufsatz von Dr. Alfred Neufeld, im Jahrbuch 2001
Die bekennende Gemeinde Menno Simons‘ – mehr als eine konfessionelle Komponente
Biblisch – theologische Grundlinien
Will man der Krise des `Mennonitentums’ in
Paraguay sinnvoll begegnen, wird man sich auf den biblischen Charakter der
Gemeinde Jesu Christi zurückbesinnen müssen. Es mag idealistisch erscheinen, von der
Gemeinde her etwas am allgemeinen Mennonitenbegriff in
Paraguay verändern zu wollen und dem Triumph der soziologischen These vom `mennonitischen Völklein’ und seiner mennonitischen Exklusivkultur entgegenzutreten. Aber uns bleibt keine andere Wahl! Und wenn die
Gemeinde hier nicht ihren prophetischen Auftrag wahrnimmt und fähig ist, mennonitische
Gemeinde für jedermann zu schaffen, dann lädt sie historische Schuld auf sich und wird dem Projekt Gottes mit seiner
Gemeinde in dieser Welt nicht gerecht.
Folgende Überlegungen können uns bei dieser Aufgabe eine theologische Basis liefern:
- Von der Bibel her, und wieder seit der Reformation, haben Kirchenverbände nur eine Existenzberechtigung, wenn ihre Lehre und Praxis in der Schrift verankert sind. Das bedeutet für unsere Thematik schlicht und praktisch: Mennonitisch sein muss bedeuten, biblisch zu sein! So wollte es Menno Simons. Die ganze Rückbesinnung auf unsere täuferische Identität kann ja nur dem Zwecke dienen, in unserer Zeit der Schrift gegenüber treu zu sein.
- Das Evangelium bringt immer eine erneuerte Kultur hervor. Es ist ein schwaches, blutleeres Evangelium, wenn es nicht das kulturelle Umfeld verändert. Wenn die Jesusnachfolger nicht interessiert sind eine Jesuskultur zu leben, sind sie keine Nachfolger. Die Bibel spricht hier sogar von einem Bürgerrecht, d.h. von einer Alltagskultur und Nationalität, die vom Himmel aus und von der Gottesherrschaft her geprägt ist. Diese Gemeindekultur ist immer auch eine Gegenkultur zur Welt. Sie ist aber nicht vorrangig an einige Elemente gekoppelt, die unsere sogenannte mennonitische Kultur ausmachen, wie etwa Sprache, Verwandtschaft, Territorium, Sitten und Gebräuche bei Hochzeiten, Beerdigungen, Gottesdiensten usw. In dieser Hinsicht ist die Gemeindekultur niemals eine ausgrenzende Stammeskultur.
- Christen finden ihre Identität vorrangig in der Zugehörigkeit zu Jesus und zur Familie Gottes. Nationale Identitäten und kulturelle Hintergründe spielen zwar auch eine wichtige Rolle, unterordnen sich aber dieser primären Zugehörigkeit. Bei den schrecklichen Stammesrivalitäten zwischen den Hutu und Tutsi in Ruanda gab es auf beiden Seiten evangelische Christen und Pastoren, die sich blutig bekämpften. Dr. Dalton Reimer, MB-Friedensforscher in Fresno, bemerkte dazu treffend:
„Die Zugehörigkeit zum Stamme der Hutu oder der Tutsi war für sie wichtiger als die Zugehörigkeit zum Stamme Jesu" (für Freunde der griechischen Sprache: Es gibt eine heilsgeschichtliche Differenz zwischen `laos und ethnos’).
- Was Paulus von seiner missionarischen Existenz behauptet, gilt auch für die Gemeinde Jesu: `Den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, allen alles, um möglichst viele zu gewinnen’. Oft haben unsere Gemeinden gedacht, sie müssten die Hüterin der deutschen Sprache und Tradition sein sowie der althergebrachten Form von sozialem und zivilem Zusammenleben mit angehängtem Schulsystem im Rahmen einer `mennonitischen Kolonie‘. Die Gemeinde soll ja tatsächlich eine Art Himmelskolonie auf Erden sein. Aber das `Schleppen’ dieser Art von `Kulturkarren’ sollte die Gemeinde lieber anderen sozialen Kräften überlassen und nur sekundär ihre Identität daran binden. Denn diese Dinge machen es soviel schwerer Mennonit zu werden, als Christ zu werden. Das Vorbild von der `Selbstentäußerung’ Christi ist hier für die Gemeinde obligatorisch. Als Gemeinde sollten wir eine christliche Alltagskultur entwickeln, die andere Christen nicht ausgrenzt.
- Gemeinde für die Welt sein. Als mennonitische Einwanderer in Paraguay haben wir lange an einem historischen Flüchtlingskomplex gelitten. Wir suchten einen Flecken, wo wir in `Ruhe und Stille unseres Glaubens leben konnten’, und empfanden von daher auch außenstehende Beobachter eher als eine Bedrohung. Wir waren ja auch tatsächlich Flüchtlinge, Gäste und Fremdlinge in diesem Land, eine Situation, die uns mit der neutestamentlichen Urgemeinde verbindet. Aber gerade die Apostelgeschichte lehrt uns, wie die ersten Christen ihren Flüchtlingsstatus immer wieder in eine Sendung verwandelten und ein Apostelbewusstsein (Gesandte Jesu) entwickelten. Gemeinde Jesu ist eben für die Welt und um der verlorenen Welt willen da. Nachfolger Jesu, und das galt fürs Täufertum und die MB’s, wollen eben gerade nicht `weltflüchtig’, sondern `welttüchtig’ sein.
- Die Zentralität der Gemeinde wiederentdecken. Es will so scheinen, als hätte die täuferische Theologie eine ganz große Zukunft im 21. Jahrhundert. Theologen wie Yoder, Driver, Hauerwas und Sider gehören schon seit Jahren zu den meistgelesenen Autoren im Bereich neuer theologischer Modelle (Siehe entsprechende Literaturangaben in der Bibliographie). Sie alle weisen auf die Zentralität der Gemeinde im Projekt Gottes hin. Die Gemeinde ist `Alternativkultur’, `Himmelskolonie’, `Zeugnisgemeinschaft’, `das Medium, das die Botschaft Gottes ist’.
Schlussfolgerungen: Spannungsfelder und Hausaufgaben
Fragt man nach der `konfessionellen Komponente’ der mennonitischen Identität in
Paraguay, so scheinen aus der Perspektive täuferisch-biblischer Theologie und Reflexion einige `Hausaufgaben’ fällig zu sein. Und weil ich mich selbst als Teil dieser Identität ansehe, brauche ich im Weiteren die Wir-Form.
Offensichtlich können diese Hausaufgaben nur unter dem Bewusstsein stattfinden, dass sich die mennonitische Identität in
Paraguay innerhalb von verschiedenen Spannungsfeldern bewegt. Theologie und Identität stehen nun einmal nicht im leeren Raum, sondern werden von Geschichte und Empirie mitbestimmt.
Spannungsfelder
Folgende Bereiche, die hier nur angedeutet werden können scheinen mir beachtenswert zu sein, für die Entfaltung täuferischer Identität in
Paraguay.
- Gemeindeorientierung im Rahmen einer ethnischen Minorität.
- Täuferische Schulkonzepte im Rahmen des öffentlichen-allgemeinen Schulwesens.
- Politische Präsenz im Rahmen jesuanischer Ethik und Treue zur Gemeinde Christi.
- Wirschaftsethik im Rahmen der `Alternativkultur’ der Gemeinde.
- Praxis der Friedenskirche im Rahmen von Korruption, Kriminalität und Ungerechtigkeit.
- Gemeinde für jedermann im Rahmen des Kulturfeldes einer ethnischen Minorität.
- Täuferische Missionstheologie im Rahmen von Volkskatholizismus und Stammesreligion.
Hausaufgaben
Die oben angedeuteten Spannungsfelder scheinen uferlos zu sein. Konkrete Schritte sind meines Erachtens in der unmittelbaren Zukunft dennoch möglich und fällig.
Zur nationalen Identität:
National gesehen sind wir Kinder von Einwanderern in
Paraguay, wie der Rest der paraguayischen Bevölkerung auch. Unsere Einwanderung geschah etwas später, wir stammen von deutschen Eltern ab und suchen deutsche und paraguayische Identität in gleicher Weise zu fördern. Dazu bedarf es keiner dritten Nationalität, genannt `mennonitisch’.
Zur Kommerzialisierung der Konfession:
Die Gemeinden erklären sich zum Wächter über den rechten Gebrauch des Namens
Mennonit. Sie erlauben weder seine Kommerzialisierung, noch seine Reduktion auf ein völkisches und soziologisches bzw. wirtschaftliches Phänomen.
Zur Gefahr einer mennonitischen Stammesreligion:
Die Gemeinden sind ständig auf der Hut, ihre Identität nicht vorrangig an die Elemente Verwandtschaft, Sippengemeinschaft, eigenes Territorium und eigene religiöse
Kultur zu binden, die nur für Stammeseingeweihte zugänglich ist. Sie suchen bewusst,
Gemeinde für jedermann zu sein.
Zur Frage, ob ‘mennonitisch’ oder ‘missionarisch’:In Gemeinde und Mission wird man vermehrt bestrebt sein, mennonitisch zu werden, um bibeltreu zu sein. Das bedeutet konkret, unsere mennonitische Theologie nicht aus der Tradition, sondern aus der Schrift zu begründen und an der Geschichte zu illustrieren, um sie für jedermann zugänglich zu machen.
Zur Nützlichkeit von K.f.K. und Gemeindekomitee:
Die Strukturen von K.f.K. und Gemeindekomitee müssen neu überdacht werden, um sie von der Gefangenschaft im mennonitischen Volksgedanken zu lösen. Sie dürfen nicht Machtstrukturen sein, sondern haben ihre Existenzberechtigung nur, insofern sie dynamischen Gemeindebau fördern und nicht behindern. Ihre Hauptfunktion muss die Pflege intergemeindlicher Freundschaft und die Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben sein.
Zur Frage `mennonitischer’ Zivilrechte:
Die Gemeinden werden den Kolonieleitungen behilflich sein müssen in der Frage um die sogenannten Bürgerschaftsrechte. Sie werden wachsam darauf achten, dass religiöse Überzeugungen oder rassische Zugehörigkeiten nicht die Einschränkung ziviler Rechte mit sich bringen.
Zur bikulturellen Identität:
In Fragen kultureller Identität sollten die Gemeinden bewusst den bereits vom Schulsystem eingeschlagenen Weg der Bikulturalität begleiten und fördern.
Gemeinde ist, wie Jesus Christus selbst, immer bi- bzw. multikulturell, da sie Himmelskultur und lokale Kulturen miteinander verbindet. Deshalb ist Bikulturalismus für die
Gemeinde keine Bedrohung. In diesem Kontext dürfen auch kulturelle Mischehen nicht mehr als `Katastrophe’ angesehen werden, für die es in den Gemeinden keinen Raum gibt, so deutlich man auch in der vorehelichen Beratung auf die zu erwartenden Schwierigkeiten hinweisen mag.
Zum Mennonitentum in Paraguay und seiner Geschichtsschreibung:
Die Gemeinden werden der Versuchung zu widerstehen wissen, ihre Identität und Geschichte in der Kategorie eines nostalgischen Heimatkundevereins zu konzipieren. Dabei werden die verstärkten Beziehungen zu internationalen mennonitischen Verbänden, besonders der mennonitischen Weltkonferenz uns helfen können, eine klare Sicht für das `eigentliche’ Mennonitentum zu entwickeln und uns nicht `im Sonderfall
Paraguay‘ zu isolieren.
Zum besseren Verständnis des biblischen Gottesvolk-Gedankens:
Der mennonitische Volksgedanke wird einem biblischen Gottesvolkgedanken weichen müssen. Die
Gemeinde Jesu ist eben das `Volk für alle Völker’. Denn es ist ja
das Kreuz von Golgatha, das gemeinsame Heimat stiftet und nicht historische Schicksalsgemeinschaft. Es sind eben die `
Blutströpfchen von Golgatha‘, dieser `
Strauss von Sarons Rosen‘, der verlorene Sünder zu einer neuen Gottesfamilie zusammenschweißt, auch über Verwandtschafts-, Sippen-, und territoriale Siedlungsgemeinschaften hinaus. Und
`das Vaterhaus, das immer nah ist‘, ist die Himmelskultur des anbrechenden Reiches Gottes. Diese Vaterhauskultur sucht die
Gemeinde glaubwürdig in der Welt zu vertreten.
Zur Frage: `Wie wird man Mennonit‘?
Zu dieser unserer entscheidenden Frage, von der die Zukunft des Mennonitentums in
Paraguay abhängt, hat Peter P. Klassen kürzlich in einer Fernsehreportage über Alltagskultur in
Filadelfia eine wegweisende Antwort geliefert. Der Journalist Rubín wollte wissen, wie ein Außenstehender
Mennonit werden kann. Darauf Klassen etwa wie folgt:
„Nun, die Antwort ist sehr einfach. Sie müssen sich zu Jesus Christus bekehren, Sie müssen sich auf ihren Glauben taufen lassen und sich verbindlich einer
Gemeinde anschließen. Es gibt tausende indianische, afrikanische und indische Mennoniten, die diesen Weg gegangen sind".
Des Rätsels einfache Lösung also:
Mennonit wird man durch Bekehrung! Der Jude Rubín glaubte nicht, dass das so einfach wäre. Wir aber können einiges dazu tun, damit es einfacher wird.
Aber auch das Gegenteil ist der Fall: Wo keine Christusnachfolge mehr sichtbar wird, wie sie
Menno Simons gelehrt hat, wo die verbindliche Zugehörigkeit zur
Gemeinde Jesu Christi, die ja die
Gemeinde Menno Simons‘ war, verlorengegangen ist, da hat man wohl kein Recht von mennonitischer Identität zu reden. Da müssten für die folkloristischen Elemente und die Pflege der plattdeutschen
Kultur andere Etiketten gefunden werden.